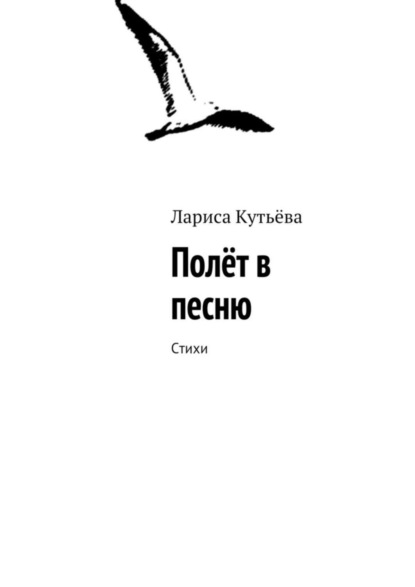- -
- 100%
- +
Die moderne Großstadt und die bürgerliche Gesellschaft, deren reibungsloses Funktionieren kontrollierten Abläufen, diszipliniertem Verhalten und strikten Affektregulierungen zu verdanken war, benötigte eine Projektionsfläche, einen Sehnsuchts- und Ruheort, wie ihn die Sommerfrische gleichsam auf utopische, fast schlaraffenlandähnliche Weise darstellte. Nicht zufällig kam damals etwa für das Salzkammergut der romantisch geprägte Begriff der »Seelenlandschaft« auf.
In der Sommerfrische konnte man zumindest temporär andere Sinneseindrücke genießen und die gesundheitsfördernde Wirkung einer Orts- und Zeitveränderung spüren. Schon die Reise dorthin war – mit jedem Kilometer, den man sich von der Stadt entfernte – erlebte Entspannung. Peter Altenberg brachte dies auf seiner Fahrt mit der Südbahn hinaus ins Gebirge so zum Ausdruck: »Meidling, Liesing, Guntramsdorf, Mödling, Baden, näher, näher, immer näher, die Luft immer frischer, gebirgiger, endlich Payerbach.« Stieg man aus dem Zug aus, war man eigentlich schon ein anderer.
Der Luftwechsel war stets einer der unmittelbarsten Eindrücke, der sich gleich nach der Ankunft offenbarte. »Luftkurort« oder gar – wie etwa im Fall des Semmering – »Höhenluftkurort« waren Attribute, die jeden Sommerfrischeort zusätzlich adelten. Geradezu euphorische Beschreibungen tauchten dann auch auf, vom hier herrschenden »würzigen Hauch der Bergwälder«, dem »harzduftenden Atem der Tannenforste« oder generell von Naturgerüchen, die »köstlich und heilkräftig« seien, eine auch für die Nase ideale Abwechslung zur stickigen Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
Die Sommerfrischeorte kehrten ihre atmosphärischen Vorzüge werbemäßig gebührend hervor. In Bad Ischl etwa waren die Häuser direkt am Fluss aufgrund des in der Luft liegenden Salzgeruchs bei den Gästen besonders beliebt. Die wohltuende, jodangereicherte Luft wurde sogar zum Exportprodukt und als »Ischler Luft« in Flaschen gefüllt und verschickt.
Vom Geruch der Gegend um Reichenau an der Rax wiederum schwärmte erneut Peter Altenberg. Seit Kindheitstagen hielt er sich regelmäßig am Thalhof auf, der dortige feuchtkühle Duft nach »Nadelwald und Bergwiese« war tief in ihn eingeschrieben. Aber auch in anderen Sommerfrischen registrierte der sensible Dichter markante Düfte, etwa in Bad Vöslau, wo er den Duft nach Tannenharz und Lindenblüten und die Millefleursgerüche der Hausgärten pries, oder an den Salzkammergut-Seen, wo Altenberg die Landungsstege der Dampfschiffe liebte, die rochen »wie von jahrelang eingesogenem Sonnenbrande«.
Doch Vorsicht! Wie beim Thema Sommerfrische generell, sollten wir uns vor einer allzu großen retrospektiven Idyllisierung hüten. Realiter gab es durchaus so etwas wie Geruchskollisionen, wenn sich etwa am Semmering mit der steigenden Zahl an Zugfahrten Sommerfrischler über den Rauch und Ruß der Eisenbahn beschwerten. Ein ähnlich dramatisches olfaktorisches Aufeinanderprallen von Natur und Kultur registrierte dort auch der Journalist und Schriftsteller Franz Servaes, der sich auf seinen Waldspaziergängen über die Parfums der feinen Damen empörte, die »den herrlichen Wohlgeruch des Laubmeeres mit ihren künstlichen Düften unpassend durchräuchern«. Die Städter kämpften um die Ungetrübtheit ihrer Naturgeruchsidyllen.

Ansichtskarte, um 1900
Auch die akustischen Projektionen auf die Sommerfrische, auf den dort herrschenden Frieden für die Ohren, waren stark und mächtig und – erneut – nicht frei von Klischees. Der steigenden Zahl an »Strebern nach Ruhe« trugen die Sommerfrischeorte bereitwillig Rechnung. So bewarb sich der Semmering mit seiner »ernsten Ruhe des Hochgebirges« als das »wunderbare Stahlbad für den erschöpften Großstädter«. Der kleine Ort Prein an der Rax galt als ruhigster Ort in der Umgebung von Reichenau. In Zell am See lockte der Gebirgssee mit seiner »stillen Pracht«.
Die Stille – besser gesagt: die Geräusche der Natur, denn ganz still war es naturgemäß nie –, die so ganz anders anmutete als die täglich in der Stadt gehörte »Lärmsymphonie«, korrespondierte mit der Naturästhetik jener Zeit, die das Kleinräumige, Niedliche, Friedvolle und Milde bevorzugte. Die Berge umrahmten das harmonische Bild des ruhigen Verweilens auf Aussichtswarten, Ruhebänken, Veranden und Balkonen. Allesamt Plätze zum Hineinhorchen in die Stille. Die in der Sommerfrische zunehmend perfektionierte Inszenierung der Natur hatte somit eine zentrale akustische Komponente, die zur stillen Betrachtung der Umgebung anleitete, zur bewussten Wahrnehmung des Waldesrauschens, der tosenden Wasserfälle oder der Wellen, die leise ans Seeufer plätscherten.
Derartige Lautsphären schätzten insbesondere Schriftsteller und Musiker, die uns in ihren Werken und Korrespondenzen zahlreiche Belege für die vor Ort verspürte akustische Erholung überlieferten. Bekannt ist erneut Peter Altenberg, der von Gmunden am Traunsee als seiner »Ruhe-Idylle« schwärmte; Raoul Auernheimer, der sich in einem Brief an Arthur Schnitzler geradezu euphorisch über die »köstliche Luft und noch köstlichere Stille«, die am Semmering herrsche, äußerte, oder Anton Wildgans, der in Mönichkirchen am Wechsel ganz beglückt über sein »Mansardenzimmer, das über allem Lärm in wunderbarer Friedlichkeit thront«, war. Und Jakob Wassermann, seit 1904 in Altaussee auf Sommerfrische, hielt in seinen Tagebucheintragungen fest: »Die Städter haben eine närrische Vorliebe für das, was sie Ruhe nennen.«
Nun waren Künstler und Intellektuelle in ihrer auditiven Sensibilität und Durchlässigkeit gewiss Ausnahmeerscheinungen, jedenfalls aber waren die Ohren der Stadtbewohner in der Sommerfrische mit einem akustisch völlig anderen Ambiente als in der Stadt konfrontiert. Allerdings war von Ruhe bisweilen nicht viel zu bemerken. Die Geräusche der Landarbeit, vor allem der Tiere am Bauernhof, forderten so manche großstädtischen Ohren heraus. In einem launigen Artikel beschrieb der Feuilletonist Eduard Pötzl die ihn quälenden »Landplagen«: von der Grille, die pausenlos zirpt, dem Nachbarhund, dessen Geheul nicht enden will, bis hin zur lautstark muhenden Kuh und dem frühmorgens krähenden Hahn. Und er war nicht der Einzige, der sich darüber beschwerte.
So war es paradoxerweise oft genau umgekehrt: Stellte man – etwas vereinfacht – Stadt und Land im Sommer akustisch gegenüber, war eine deutliche Lärmumkehr zu erkennen. Die Sommerfrische erwies sich mit ihren vielen Gästen und den ungewohnten Lauten der Natur mitunter als unruhiger als die still und entleert zurückgelassene Großstadt. Zufrieden stellte ein Daheimgebliebener über Wien fest: »Aber eines Vortheiles genießen wir wenigstens in der sommerlich todten Stadt: Sie ist ruhiger geworden. Wo man sonst vom tausendstimmigen Straßenlärm halb taub wurde, ist es nun still und stumm.«

Karikatur, 1928
War der Erholungswert der Sommerfrische – wie vielfach bei heutigen Urlaubsreisen auch – also schon damals nur Fiktion? Die zahlreichen, oft satirisch untermalten Reportagen über nicht eingelöste Erwartungen legen diese Interpretation zumindest nahe. Kritiker wie Pötzl argumentierten ebenfalls in diese Richtung und meinten süffisant, dass sich die Sommerfrischen letztlich »von einem Wiener Kaffeehaus nur durch die schlechtere Bedienung und die höheren Preise unterscheiden«.
Das Ende dieser spezifischen touristischen Kultur kam in der Zwischenkriegs- und vor allem NS-Zeit, als die die Sommerfrische bis dahin tragenden jüdischen Gäste vertrieben und ermordet wurden. Die Fremdenverkehrsverbände am Weißensee in Kärnten beispielsweise beschlossen bereits um 1930 kollektiv, die Sommerfrischen an ihrem See »judenrein« zu halten.
Die Erneuerungsbestrebungen nach 1945 blieben zaghaft. Sobald man es sich wieder leisten konnte, stillte man seine Urlaubssehnsüchte in Italien und anderen fernen Destinationen. Die Sommerfrische geriet in den Ruf, altmodisch zu sein.
Erst in jüngster Zeit zeichnet sich eine Trendumkehr ab. Angesichts von Klimawandel und globalen Unsicherheiten bis hin zur Terrorangst erreicht der Urlaub innerhalb Österreichs sommerliche Rekordzahlen. Die nicht nur in Wien markant gestiegene Anzahl an »Hitzetagen« und »Tropennächten« wird diese Entwicklung hin zu einer modernen Art von Sommerfrische wohl weiter fördern.

Warenhaus Esders, um 1900
SCHAUFENSTER FÜR ALLE
125 Jahre lang zu bestehen ist in der schnelllebigen Handelsbranche keine Kleinigkeit. Auf solch ein Jubiläum kann ein Wiener Warenhaus verweisen, das bei seiner Eröffnung im Jahr 1895 als Bau der Superlative galt. Einzigartig für Wien, ja für ganz Europa. Vom Kaufmann Stefan Esders in der unteren Mariahilfer Straße errichtet, war es lange Zeit der Flagship-Store der Firma Leiner. An seine Stelle wird schon bald das KaDeWe Wien treten, erneut mit dem Anspruch, architektonische Maßstäbe von Weltformat zu setzen, denn der Entwurf stammt aus dem Büro des Star-Architekten Rem Koolhaas. Ein Standort mit einer durchaus bemerkenswerten Geschichte also.
Stefan Esders (1852–1920) stammte ursprünglich aus Belgien und hatte zuvor schon eine Kleiderfabrik in Brüssel gegründet, gemeinsam mit seinem Bruder Henri. Zahlreiche Filialen in Berlin, Paris, St. Petersburg und Rotterdam waren bereits entstanden, nun sollte in der aufstrebenden Weltmetropole Wien ein weiterer unternehmerischer Höhepunkt folgen. Esders erwarb das Eckgrundstück in der Mariahilfer Straße 18 und ließ nach Plänen des Wiener Architekten Friedrich Schachner ein für damalige Verhältnisse spektakuläres Großkaufhaus für Textilwaren errichten. Die Vorbilder dazu standen in Paris, wo sich mit legendären Etablissements wie Le Bon Marché, La Samaritaine oder Printemps bereits seit Längerem eine prominente Warenhauskultur etabliert hatte.
Der Architekt und die mit der Ausführung betrauten Baumeister Franz Kupka und Gustav Orglmeister realisierten einen kompakten, fünfgeschoßigen Monumentalbau mit Haupteingang an der Ecke. Im Inneren gruppierten sich die Räumlichkeiten um einen zentralen, mit Glas gedeckten Hof. Die einzelnen Geschoße waren durch eine repräsentative Treppenanlage verbunden, die aus edelsten Materialien bestand. Die Konstruktion des Gebäudes in Pfeilerbauweise war wegweisend, ebenso die gesamte Logistik. Die beiden untersten Geschoße – rund 12.000 Quadratmeter – dienten als Verkaufsräume, in den beiden Geschoßen darüber war die Kleiderfabrik untergebracht, im obersten Stockwerk befanden sich Wohnungen, darunter auch jene für die Familie des Eigentümers. Der Name des Warenhauses sprach für sich: »Zur großen Fabrik«.

Stefan Esders, um 1900
Die Eröffnung am 4. April 1895 war ein Festakt der Sonderklasse, sie bot ein geradezu »großstädtisches Bild voll Pracht und Glanz«, wie die »Neue Freie Presse« ehrfurchtsvoll vermerkte: »Es war ein höchst überraschender – ein wahrhaft blendender Anblick, der das massenhaft angesammelte Publicum in staunender Bewunderung gefesselt hielt. Alles war einig in dem Urtheile, daß es ein Geschäfts-Etablissement von ähnlicher Großartigkeit in Wien noch nicht gegeben habe. Sämmtliche colossalen Schaufenster im Parterre und Mezzanin – 39 an der Zahl – waren elektrisch illuminirt, und das goldige Licht der Glühlampen ergoß sich auf die hinter den riesigen Spiegelscheiben aufgehäufte Fülle der Artikel, die das neue Etablissement dem Publicum bietet.« Den ganzen Tag über, so die Zeitung weiter, drängten sich Tausende Passanten vor den Schaufenstern.
Neugier und Aufregung waren groß, präsentierte sich das Warenhaus doch gleich in mehrfacher Hinsicht als absolut innovativ. Schon der so verschwenderische Einsatz des elektrischen Lichts war einzigartig. Nur sporadisch hatte die Wiener Bevölkerung bisher Bekanntschaft mit der Qualität des neuen Lichts gemacht. Zwar gab es bereits 1882 am Graben eine erste Probebeleuchtung mit elektrischen Bogenlampen und im Jahr darauf im Prater eine große »Internationale Elektrische Ausstellung«, doch in den meisten Bereichen der Stadt dominierte nach wie vor das schummrige Licht der Gasflammen. Verkaufswaren, die in der Nacht mit elektrischem Licht inszeniert wurden, hatte man in diesem Ausmaß noch nicht gesehen.

Grundriss Erdgeschoß, 1895
Wesentlichen Anteil an dieser Faszination hatte die Anzahl und Größe der Schaufenster, die die untersten beiden Etagen einnahmen und, gemeinsam mit der Beleuchtung, zur Straße hin eine maximale Anziehungskraft erzeugten, auch das eine Novität. Erst 1880 hatte die Wiener Gemeindeverwaltung die Schaufensterbeleuchtung grundsätzlich für alle Bezirke der Stadt bewilligt. Mit der Bedingung, dass die jeweiligen Geschäftsinhaber beim Stadtbauamt um eine Konzession ansuchten und sich als »sittlich unbedenkliche Personen« erwiesen. Nach und nach erstrahlten die Schaufenster der Geschäfte seither auch abends. Die Waren erhielten eine neue Sichtbarkeit, gleichzeitig wurden die Auslagen immer größer und, so die Historikerin Susanne Breuss in ihrer lesenswerten Geschichte des Schaufensters, zu einem paradigmatischen Ort großstädtischer Konsumkultur. Eine Kultur des Sehens und Zeigens, des wirkungsvollen Inszenierens mit Glas und Licht etablierte sich. Auf architektonischer Seite führte dies zu einer zunehmenden Transparenz der Geschäftsfassaden und einer immer stärkeren Verschmelzung von Innen- und Außenraum.
Warenhäuser wie jene von Esders oder später auch Herzmansky (1897) und Gerngross (1904) waren diesbezüglich Pioniere und prägten damit das Bild der Mariahilfer Straße nachhaltig. Die Straße verlor ihren Vorstadtcharakter und avancierte zur wichtigsten Konsummeile der Stadt: Ein urbanes Aushängeschild und Symbol für Fortschritt und Modernität.
Der Wiener Schriftsteller und Journalist Paul Zifferer schilderte seinen Lesern diese eindrucksvolle Transformation am Vorabend zu Weihnachten 1910: »Jedem einzelnen, den jetzt sein Weg des Abends durch die Mariahilferstraße hinaufführt, widerfährt etwas ganz Erstaunliches und Wunderbares. Alles ringsum scheint verzaubert, altvertraute Plätze tragen ein neues, fremdes Gewand, und man schreitet wie durch lauter Prunkgemächer, deren Türen weit geöffnet stehen und deren Kronleuchter ihr Licht als strahlende Dusche über die festlich geputzte Menge ergießen.«
Stefan Esders, schon bald als »Kleiderkönig von Wien« bezeichnet, war in seinen Produktions- und Verkaufsstrategien ein Unternehmer neuen Formats. Enorm billige und erstmals auch genau ausgeschilderte Preise beeindruckten die Konkurrenz, das Angebot an Waren – man verkaufte zunächst ausschließlich Herren-, erst später auch Damenkonfektion – war für damalige Verhältnisse geradezu unglaublich. So lagerten allein 10.000 Hosen und 67.000 komplette Anzüge in dem Etablissement.
Insgesamt 120 Verkäufer standen für die Kunden bereit und erstmals kam auch eine neue Art der Warenpräsentation zum Einsatz: Lebensgroße Schaufensterpuppen, die »die modernsten Façons aller Kleidungsstücke in Schnitt und Form veranschaulichen«, galten als Sensation und zogen die Blicke der Kunden magisch auf sich.
Das Warenhaus Esders war ein in Wien bemerkenswerter »Early Adopter«, ein Unternehmen also, das – bedingt durch seine große Kundennähe – sehr früh modernste Technologien und neue Präsentationsformen ausprobierte. Ein Pionier des Fortschritts, wie später auch andere Warenhäuser oder Hotels, die hinsichtlich technologischer Ausstattung ebenfalls stets am Puls der Zeit zu sein hatten.
Der Erfolg sprach für sich. Und auch der Neid. Eine politische Debatte entbrannte, in der konservative Politiker Esders großkapitalistische Ausbeutung vorwarfen – allen voran die Christlichsozialen, die ihr kleinbürgerliches Klientel gefährdet sahen und dabei auch antisemitische Ressentiments schürten, die allerdings ins Leere gingen, da der Kaufhausbesitzer Katholik war.

Warenhaus Esders, um 1930
Bei seinen Angestellten schien Esders durchaus beliebt gewesen zu sein. Auch hier bahnbrechend, führte er ein System der Gewinnbeteiligung mittels Prämien ein, und zu seinem 60. Geburtstag stiftete er 100.000 Kronen für den Pensionsfonds seiner Belegschaft.
Der Ruf des Unternehmens ging bald weit über die Grenzen Wiens hinaus. Auch Alfred Wiener, Autor eines 1912 erschienenen Standardwerks zur Geschichte des Warenhauses, hebt das Konfektionshaus Esders im internationalen Vergleich lobend hervor.
Nach Stefan Esders Tod führte sein Sohn und danach sein Enkel die Firma weiter. Ende des Zweiten Weltkriegs kam es zu umfangreichen Beschädigungen und Plünderungen, 1964 schließlich kaufte die aus St. Pölten stammende Firma Leiner das Gebäude und nahm in der Folge umfangreiche Modernisierungen und Umbauten vor.
Danach präsentierte sich das Warenhaus als relativ nüchterner Bau, bei dem nur noch die großen Fensterscheiben in den unteren Geschoßen an die dort einst zelebrierte Schaulust erinnerten. »Vollgefressene Pupillen«, wie Joseph Roth so einnehmend formulierte, wurden durch sie keine mehr hervorgerufen. Im Inneren allerdings war noch bis vor Kurzem ein kleiner Teil der Treppenanlage original erhalten, eine reich gegliederte Eisenkonstruktion mit Geländer und filigranen Jugendstil-Verzierungen. Und dieser älteste Teil des Hauses vermochte zumindest noch ansatzweise den Glamour vergangener Tage wachzurufen. So bemerkte eine Verkäuferin spontan, dass es immer wieder ein erhabenes Gefühl sei, diese Stufen hinunterzuschreiten. Sie fühle sich stets wie ein Star. Welch schönes Kompliment für ein Gebäude am Vorabend seines Todes.

Kaufhaus Leiner, Historische Treppenanlage, 2020

Life Ball, Eröffnung 2019, Foto: Peter Payer
DIE STADT ALS EVENT
Das Ende des Life Balls hat es einmal mehr deutlich gemacht: Die Eventisierung des öffentlichen Raumes ist längst auch in Wien zur Selbstverständlichkeit geworden, zu einem bedeutsamen kulturellen und wohl auch wirtschaftlichen Faktor. Läuft ein derart renommierter Fixstarter im jährlichen urbanen Veranstaltungskalender aus, wie der seit mehr als einem Vierteljahrhundert bestehende Megaevent zugunsten der Aids-Hilfe, wird dies von vielen als unwiederbringlicher Verlust erlebt. Zumal die TV-Ausstrahlung dieses außergewöhnlichen Ereignisses, das sich von Beginn an als bunt, exaltiert und vor allem auch politisch verstand, weit über die österreichische Hauptstadt hinausreichte und man damit letztlich weltweite Aufmerksamkeit genoss. Eine zweifellos beachtenswerte Leistung in unserer zunehmend kompetitiven und markenorientierten Zeit. Wien war mit dem Life Ball auf der internationalen Landkarte präsent, er passte perfekt zum Image der Kulturmetropole an der Donau und veranschaulichte so ganz nebenbei, wie sehr sich die Stadt und das Lebensgefühl in ihr in den letzten Jahrzehnten verändert hatten. Alt und neu in perfekter Symbiose.
Dass die Straßen und Plätze der Metropolen zu Schauplätzen von Großveranstaltungen werden, ist natürlich nicht neu. Allein die Anlässe und Häufigkeiten der Ereignisse und damit zusammenhängend das Verständnis von Urbanität haben sich grundlegend gewandelt. Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich die westlichen Großstädte teils in rasendem Tempo herauszubilden begannen, kam dem öffentlichen Spektakel eine immer größere Bedeutung zu. Die Kulturwissenschaftlerin Regina Bittner bringt hier den Begriff der »urbanen Paradiese« ein, die sich in den verschiedensten Ausprägungen manifestierten, von High-Tech-Vergnügungsparks und modernen Warenhäusern bis hin zu groß inszenierten Festen und Weltausstellungen. Schon damals ging es angesichts steigender Städtekonkurrenz um Repräsentation und die Suche nach klarer Unterscheidbarkeit, gepaart mit dem Faszinosum von Differenz und Vielfalt, des Aufeinanderprallens von Vertrautem und Fremdem. Der deutsche Architekt August Endell proklamierte in seinem berühmten, 1908 erschienenen Buch eine Lobeshymne auf ebendiese »Schönheit der großen Stadt«: »Unsere Städte leben, sie umgeben uns mit der ganzen Macht der Gegenwart, des Daseins, des Heuteseins. Und gegen ihre bunte Unendlichkeit ist alle Überlieferung, sind auch die kostbarsten Trümmer tot, gespenstig und arm. Unsere Städte sind uns so unerschöpflich wie das Leben selbst.«

Sängerbundfest am Praterstern, Ansichtskarte, 1928
Der im modernen Städtebau neu konzipierte öffentliche Raum rezipierte dieses Bestreben nach umfassender Selbstdarstellung, indem er in den imperialen Zentren breite Boulevards und großzügig angelegte Plätze vorsah. Sie dienten in der Folge als repräsentative Kulisse für jene Großveranstaltungen, die zumeist zu Ehren von Herrschenden abgehalten wurden. Kaiserliche Geburtstage, Hochzeiten und Thronjubiläen fungierten als Anlässe für prächtige Umzüge und Massenspektakel. In Wien war das etwa der opulente Makart-Festzug im Jahr 1879 anlässlich des 25. Hochzeitstags des Kaiserpaares Franz Joseph und Elisabeth oder die Jahre 1898, 1900 und 1908, in denen – ebenfalls für Kaiser Franz Joseph – groß angelegte Events abgehalten wurden, die sich über die festlich geschmückte Ringstraße und weite Bereiche der Innenstadt erstreckten. Spektakuläre Einzelereignisse, die Hunderttausende Menschen in ihren Bann zogen, wurden schon damals geschickt vermarktet und prägten sich tief in das kollektive Gedächtnis der Stadt ein.
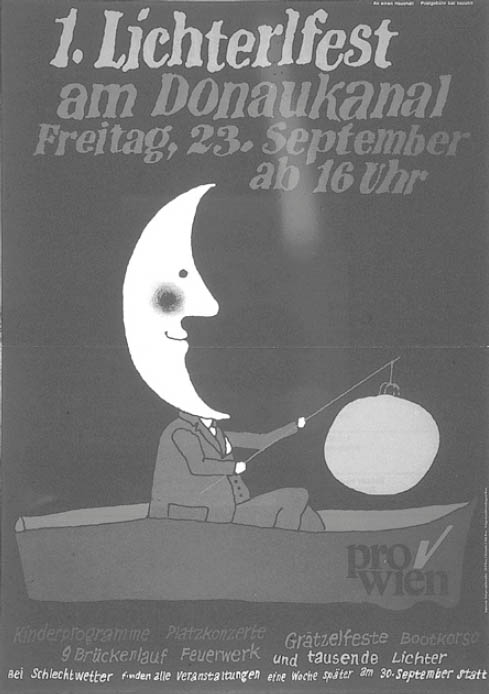
Lichterlfest am Donaukanal, Plakat, 1983
In der republikanischen Stadt der Zwischenkriegszeit verstärkte sich die Politisierung des öffentlichen Raumes. Aufmärsche der sich formierenden Massenparteien, aber auch Demonstrationen und teils gewaltsame Auseinandersetzungen gehörten im »Roten Wien« zum Alltag. Jährliche Höhepunkte waren die Maikundgebungen von Arbeiterschaft und Sozialdemokratie, die die Ringstraße und den Prater propagandawirksam in Besitz nahmen. Hinzu kamen groß inszenierte Sport- und Kulturevents wie der Schwimm- und Ruderwettbewerb »Quer durch Wien«, dem am Donaukanal Hunderttausende Zuschauer beiwohnten, das Sängerbundfest 1928 oder der im Juni 1929 abgehaltene Gewerbefestzug.
Die Ringstraße und vor allem der Heldenplatz blieben bekanntermaßen auch die wichtigsten politischen Bühnen im austrofaschistischen Ständestaat und in der NS-Zeit, ehe sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges und erfolgreichem Wiederaufbau allmählich eine deutlich entpolitisierte, mehr konsum- und freizeitorientierte Nutzung des Stadtraumes abzeichnete. Allerdings zunächst noch mit starker Stimulanz durch die politischen Parteien. Als Nachkriegspionier gilt das von der KPÖ initiierte Volksstimmefest, das 1946 erstmals im Praterstadion stattfand und seither auf der Jesuitenwiese im Prater abgehalten wird. Die SPÖ reaktivierte ihre Maikundgebungen und die Wiener Festwochen starteten ab 1951 erneut mit einem umfangreichen, mehrwöchentlichen Kulturprogramm. Im Jahr 1975 wurde der Christkindlmarkt auf den Rathausplatz verlegt, wo er sich rasch als beliebter Winterevent etablierte. Die ÖVP wiederum konnte erst Jahrzehnte später mit Erhard Busek und seinen »Bunten Vögeln« veranstaltungsmäßige Akzente setzen. Sie begründete 1978 das Wiener Stadtfest, dessen Darbietungen in der Innenstadt sogleich großen Anklang fanden, sowie ab 1983 ein Lichterlfest am Donaukanal, das heutige Donaukanaltreiben.