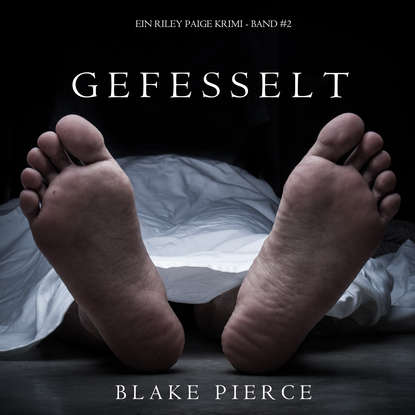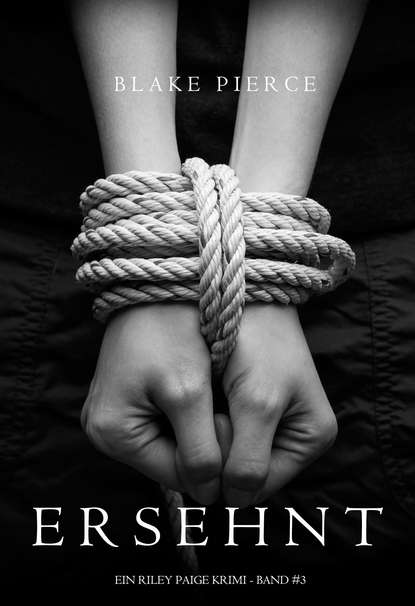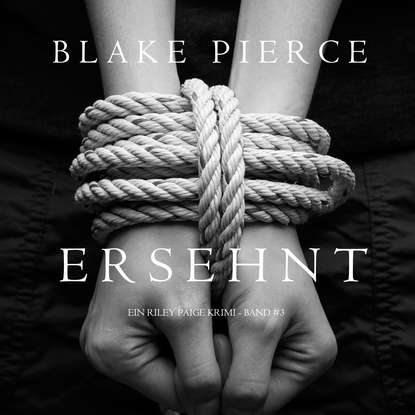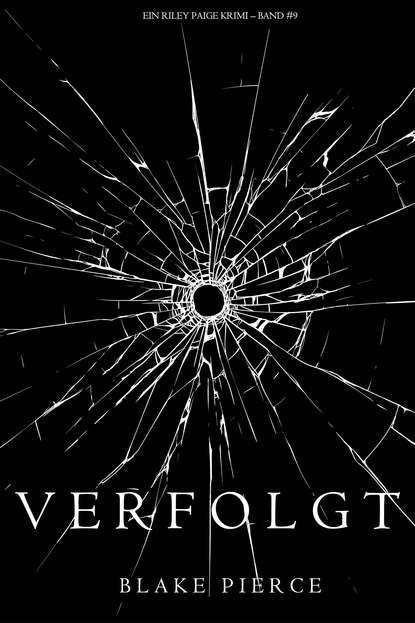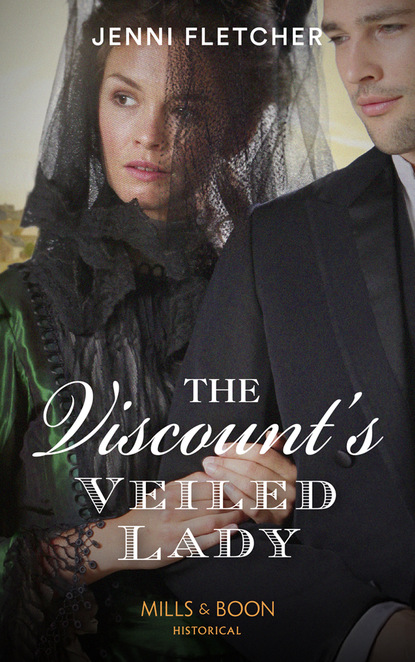Geködert

- -
- 100%
- +
In dem Moment vibrierte ihr eigenes Telefon. Sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie es nicht ausgestellt hatte, bevor sie das Haus verlassen hatte. Sie sah auf das Telefon, das eine Nachricht von ihrem FBI Partner, Bill, zeigte. Sie dachte darüber nach, sie ungelesen zu lassen, aber konnte sich letztendlich nicht dazu bringen.
Als sie die Nachricht aufrief, sah sie aus den Augenwinkeln, wie April sie angrinste. Ihre Tochter genoss ganz offensichtlich die Ironie der Situation. Insgeheim kochend, las Riley Bills Textnachricht.
Meredith hat einen neuen Fall. Er will ihn mit uns besprechen. ASAP.
Der leitende Spezialagent Brent Meredith war Rileys und Bills Boss. Sie fühlte ihm gegenüber enorme Loyalität. Er war nicht nur ein guter und fairer Chef, er hatte sich auch mehr als einmal für Riley eingesetzt, nachdem sie im Büro in Schwierigkeiten geraten war. Dennoch war Riley entschlossen, sich nicht wieder in die Sache hineinziehen zu lassen, zumindest vorerst nicht.
Ich kann jetzt nicht verreisen, schrieb sie zurück.
Bill antwortete, Es ist direkt hier in der Gegend.
Riley schüttelte entmutigt den Kopf. Es würde nicht einfach werden standhaft zu bleiben.
Sie schrieb ihm zurück, Ich melde mich wieder bei dir.
Da sie darauf keine Antwort erhielt, legte sie das Telefon zurück in ihre Tasche.
"Ich dachte du hast gesagt, das sei unhöflich, Mom", sagte April in einer leisen, schmollenden Stimme.
April schrieb noch immer Nachrichten.
"Ich bin fertig mit meinen", sagte sie und versuchte nicht so genervt zu klingen, wie sie sich fühlte.
April ignorierte sie. Dann vibrierte Rileys Handy noch einmal. Im Stillen fluchte sie. Sie sah, dass es eine Nachricht von Meredith selbst war.
Seien Sie morgen früh um 9 Uhr im BAU.
Riley suchte fieberhaft nach einem Weg abzusagen, als eine weitere Nachricht folgte.
Das ist ein Befehl.
KAPITEL ZWEI
Rileys Stimmung sank, als sie die beiden Fotos auf dem Bildschirm über dem Konferenztisch des BAUs betrachtete. Das eine zeigte ein sorgenfreies Mädchen mit hellen Augen und einem gewinnenden Lächeln. Auf dem anderen sah man ihre Leiche, schrecklich ausgemergelt und mit ihren Armen in seltsamer Position. Da ihr befohlen worden war, an diesem Meeting teilzunehmen, wusste Riley, dass es ein weiteres Opfer wie dieses geben musste.
Sam Flores, ein kluger Labortechniker mit einer schwarz umrandeten Brille, führte die anderen Agenten, die mit ihm am Tisch saßen, durch die Fotos.
"Diese Bilder zeigen Metta Lunoe, siebzehn Jahre alt", sagte Flores. "Ihre Familie lebt in Collierville, New Jersey. Ihre Eltern haben sie im März als vermisst gemeldet – eine Ausreißerin."
Er fügte dem Bildschirm eine Karte von Delaware hinzu und zeigte mit dem Laserpointer auf eine bestimmte Stelle.
Er sagte, "Ihre Leiche wurde am sechzehnten Mai in einem Feld vor Mowbray, Delaware, gefunden. Ihr Genick wurde gebrochen."
Flores zeigte ein weiteres Fotopaar – auf dem einen ein anderes, lebhaftes junges Mädchen, auf dem anderen das gleiche Mädchen, fast bis zur Unkenntlichkeit dahingeschwunden, ihre Arme in ähnlicher Weise ausgestreckt.
"Das ist Valerie Bruner, ebenfalls siebzehn, eine als vermisst gemeldete Ausreißerin aus Norbury, Virginia. Sie ist im April verschwunden."
Flores zeigte einen weiteren Punkt auf der Karte.
"Ihre Leiche wurde am zwölften Juni auf einer Landstraße in der Nähe von Redditch, Delaware, gefunden. Scheinbar die gleiche MO wie bei dem anderen Mord. Agent Jeffreys wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen."
Riley horchte überrascht auf. Wie hatte Bill an einem Fall arbeiten können, von dem sie nichts wusste? Dann erinnerte sie sich. Im Juni hatte sie im Krankenhaus gelegen und sich von den schrecklichen Qualen erholt, die sie in Petersons Käfig hatte aushalten müssen. Aber Bill hatte sie häufig im Krankenhaus besucht. Er hatte nie erwähnt, dass er an einem Fall arbeitete.
Sie drehte sich zu Bill.
"Warum hast du mir nicht davon erzählt?" fragte sie.
Bills Gesicht wirkte grimmig.
"Es war kein guter Zeitpunkt", sagte er. "Du hattest deine eigenen Probleme."
"Wer war dein Partner?" fragte Riley.
"Agent Remsen."
Riley kannte den Namen. Bruce Remsen war aus Quantico versetzt worden, bevor sie wieder zur Arbeit gekommen war.
Dann, nach einer Pause, fügte Bill hinzu, "Ich konnte den Fall nicht lösen."
Riley wusste, was sein Gesichtsausdruck und seine Stimme bedeuteten. Nach Jahren der Freundschaft und Partnerschaft, verstand sie Bill so gut wie kaum jemand. Und sie wusste, dass er von sich selbst enttäuscht war.
Flores rief die Fotos der nackten Rücken der Mädchen auf, die der Gerichtsmediziner gemacht hatte. Die Leichen waren so ausgemergelt, dass sie fast surreal erschienen. Beide Rücken zeigten alte Narben und frische Striemen.
Riley wurde von einem nagenden Unbehagen gepackt. Das Gefühl überraschte sie. Seit wann wurde ihr anders, bei dem Anblick von Leichenfotos.
Flores sagte, "Sie waren beide so gut wie verhungert, bevor ihnen das Genick gebrochen wurde. Sie wurden außerdem brutal geschlagen, vermutlich über einen langen Zeitraum. Die Leichen wurden an den beiden gezeigten Stellen abgelegt. Wir haben keine Ahnung, wo sie tatsächlich getötet worden sind."
Riley versuchte, sich nicht von der wachsenden Unruhe überwältigen zu lassen und dachte über Ähnlichkeiten mit Fällen nach, die Bill und sie in den letzten Monaten aufgeklärt hatten. Der sogenannte "Puppenmörder" hatte seine Opfer an einfach zu findenden Stellen abgelegt und sie dort wie Puppen drapiert. Der "Kettenmörder" hatte seine Opfer in Ketten gewickelt und aufgehängt.
Jetzt zeigte Flores das Foto einer anderen jungen Frau – eine fröhlich aussehende Rothaarige. Daneben war das Foto eines verbeulten, leeren Toyotas.
"Das Auto gehört einer vierundzwanzig Jahre alten, irischen Einwanderin namens Meara Keagan", sagte Flores. "Sie wurde gestern Morgen vermisst gemeldet. Ihr Auto wurde verlassen in der Nähe ihres Wohngebäudes in Westree, Delaware, gefunden. Sie hat dort für eine Familie als Zimmer- und Kindermädchen gearbeitet.
Jetzt sprach Spezialagent Brent Meredith. Er war ein respekteinflößender, großer Afroamerikaner mit kantigen Gesichtszügen und geradlinigem Auftreten.
"Sie hat vorgestern um elf Uhr Abends ihre Schicht beendet", sagte Meredith. "Das Auto wurde früh am nächsten Morgen entdeckt."
Der leitende Spezialagent Carl Walder lehnte sich in seinem Stuhl vor. Er war wiederum der Boss von Brent Meredith – ein Mann mit einem sommersprossigen, runden Gesicht und gelockten, kupferfarbenen Haaren. Riley mochte ihn nicht. Sie hielt ihn nicht für sonderlich kompetent. Es half auch nicht, dass er sie schon einmal gefeuert hatte.
"Warum denken wir, dass dieses Verschwinden in Zusammenhang mit den anderen Morden steht?" fragte Walder. "Meara Keagan ist älter als die anderen Opfer."
Jetzt meldete sich Lucy Vargas zu Wort. Sie war eine schlaue, junge Anfängerin mit dunklen Haaren, dunklen Augen und einem ebenso dunklen Teint.
"Sie können es auf der Karte sehen. Keagan ist in dem gleichen Gebiet verschwunden, in dem die beiden Leichen gefunden worden sind. Es könnte Zufall sein, aber das ist eher unwahrscheinlich. Nicht über einen Zeitraum von fünf Monaten und alle so nahe beieinander."
Trotz ihrem zunehmenden Unbehagen, verspürte Riley eine gewisse Befriedigung, als Walder zusammenzuckte. Unabsichtlich hatte Lucy ihn zurechtgewiesen. Riley hoffte, dass er keinen Weg finden würde, um sich später an ihr dafür zu rächen. Walder traute sie solche kleinlichen Schikanierungen zu.
"Das ist korrekt, Agentin Vargas", nickte Meredith. "Wir nehmen an, dass die jüngeren Mädchen entführt wurden, als sie versucht, haben per Anhalter zu fahren. Vermutlich entlang der Bundesstraße, die durch dieses Gebiet läuft." Er zeigte auf eine bestimmte Linie auf der Karte.
Lucy fragte, "Ist per Anhalter zu fahren nicht verboten in Delaware?" Dann fügte sie sofort hinzu, "Auch wenn das natürlich schwierig durchzusetzen ist."
"Da haben Sie Recht", sagte Meredith. "Und es ist nicht einmal eine Autobahn, oder die Hauptverkehrsstraße, also würden Anhalter wahrscheinlich diese nutzen. Der Killer offensichtlich auch. Eine Leiche wurde entlang dieser Straße gefunden und die anderen in weniger als zehn Meilen Entfernung. Keagan wurde etwas sechzig Meilen weiter nördlich auf der gleichen Strecke entführt. Bei ihr hat er einen anderen Köder genutzt. Wenn er seinem üblichen Muster folgt, dann wird er sie festhalten, bis sie kurz vor dem Hungertod ist. Dann wird er ihr das Genick brechen und die Leiche auf gleiche Weise ablegen."
"Das werden wir nicht zulassen", sagte Bill mit gepresster Stimme.
Meredith sagte, "Agenten Paige und Jeffreys, ich will, dass Sie sich sofort des Falles annehmen." Er schob einen Ordner mit Fotos und Berichten über den Tisch in Richtung Riley. "Agentin Paige, hier sind alle Informationen, die Sie benötigen, um auf dem neuesten Stand zu sein."
Riley griff nach dem Ordner. Aber ihre Hand zuckte in einem Anflug von Panik zurück.
Was ist denn los mit mir?
Ihr Kopf schwamm und undeutliche Bilder fingen an vor ihren Augen Form anzunehmen. War das der posttraumatische Stress von dem Peterson Fall? Nein, das war etwas anderes. Etwas vollkommen anderes.
Riley sprang auf und floh aus dem Konferenzraum. Während sie über den Flur zu ihrem Büro eilte, wurden die Bilder schärfer.
Es waren Gesichter – Gesichter von Frauen und Mädchen.
Sie sah Mitzi, Koreen, und Tantra – junge Callgirls, deren seriöse Aufmachung die Erniedrigungen versteckte, sogar vor ihnen selbst.
Sie sah Justine, eine alternde Nutte, an einer Bar über einen Drink gebeugt, müde und verbittert und bereit einen hässlichen Tod zu sterben.
Sie sah Chrissy, durch ihren gewalttätigen Zuhälter-Freund gefangen in einem Bordell.
Und vor allem sah sie Trinda, ein fünfzehn Jahre altes Mädchen, die bereits den Albtraum sexueller Ausbeutung gelebt hatte und sich nicht mehr vorstellen konnte, ein anderes Leben zu haben.
Riley erreichte ihr Büro und klappte auf ihrem Bürostuhl zusammen. Jetzt verstand sie die plötzliche Abscheu. Die Bilder, die sie gesehen hatte, waren ein Auslöser gewesen. Sie hatten die düsteren Zweifel an die Oberfläche gebracht, die sie wegen des Phönix Falles verspürte. Sie hatten einen brutalen Mörder gestoppt, aber sie hatten den Mädchen und Frauen, die sie getroffen hatten, keine Gerechtigkeit gebracht. Die ganze Welt der Ausbeutung blieb unberührt. Sie hatten nicht einmal die Oberfläche angekratzt.
Und jetzt wurde sie auf eine Weise verfolgt und gequält, die sie noch nie erlebt hatte. Das schien ihr schlimmer als die Folgen ihrer Gefangenschaft zu sein. Schließlich konnte sie ihre private Angst und Wut im Boxring lassen. Sie hatte keine Möglichkeit diese neuen Gefühle loszuwerden.
Würde sie in der Lage sein, an einem ähnlichen Fall wie in Phönix zu arbeiten?
Sie hörte Bills Stimme an der Tür.
"Riley."
Sie sah zu ihrem Partner, der ihr einen traurigen Blick zuwarf. Er hielt den Ordner, den Meredith versucht hatte ihr zu geben.
"Ich brauch dich an diesem Fall", sagte Bill. "Es ist persönlich für mich. Es macht mich verrückt, dass ich ihn nicht lösen konnte. Und ich frage mich immer, ob ich nicht richtig bei der Sache war, weil meine Ehe in die Brüche gegangen ist. Ich habe Valerie Bruners Familie kennengelernt. Das sind gute Leute. Aber ich bin nicht in Kontakt geblieben, weil ... na ja, ich habe sie enttäuscht. Ich muss die Sache mit ihnen in Ordnung bringen."
Er legte den Ordner auf Rileys Schreibtisch.
"Schau es dir an. Bitte."
Er verließ Rileys Büro Sie starrte unentschlossen auf den geschlossenen Ordner.
Das sah ihr gar nicht ähnlich. Sie wusste, dass sie sich zusammenreißen musste.
Während sie darüber nachdachte, erinnerte sie sich an etwas von ihrer Zeit in Phoenix. Sie war in der Lage gewesen, ein Mädchen namens Jilly zu retten. Oder zumindest hatte sie es versucht.
Sie nahm ihr Telefon und wählte die Nummer für eine Unterkunft für Teenager in Phoenix, Arizona. Eine vertraute Stimme antwortete.
"Hier ist Brenda Fitch."
Riley war froh, dass Brenda abgenommen hatte. Sie hatte die Sozialarbeiterin bei ihrem letzten Fall kennengelernt.
"Hi, Brenda", sagte sie. "Hier ist Riley. Ich dachte, ich horche mal nach, wie es Jilly geht."
Jilly war ein Mädchen, das Riley vor dem Sexhandel bewahrt hatte – ein schlaksiges, dunkelhaariges, dreizehn Jahre altes Mädchen. Jilly hatte keine Familie, außer ihrem gewalttätigen Vater. Riley rief öfter an, um herauszufinden, wie es Jilly ging.
Riley hörte ein Seufzen von Brenda.
"Es ist gut, dass Sie anrufen", sagte Brenda. "Ich wünschte mehr Leute würden sich kümmern. Jilly ist noch bei uns."
Rileys Stimmung sank. Sie hoffte, dass sie eines Tages anrufen würde und gesagt bekam, dass Jilly von einer liebevollen Pflegefamilie aufgenommen worden war. Heute war nicht dieser Tag. Jetzt machte Riley sich Sorgen.
Sie sagte, "Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, stand die Sorge im Raum, dass Sie sie zurück zu ihrem Vater schicken müssen."
"Oh, nein, das haben wir gerichtlich geklärt. Wir haben sogar eine einstweilige Verfügung erwirkt, damit er sich von ihr fernhält."
Riley seufzte erleichtert auf.
"Jilly redet immerzu über Sie", sagte Brenda. "Würden Sie gerne mit ihr reden?"
"Ja. Bitte."
Brenda setzte Riley in die Warteschleife. Riley fragte sich plötzlich, ob das wirklich eine so gute Idee war. Jedes Mal, wenn sie mit Jilly sprach, fühlte sie sich danach schuldig. Sie konnte nicht genau sagen, woher das Gefühl kam. Schließlich hatte sie Jilly vor einem Leben der Ausbeutung und Misshandlung bewahrt.
Aber für was habe ich sie gerettet? Welche Art von Leben stand Jilly jetzt bevor?
Sie hörte Jillys Stimme.
"Hey, Agentin Paige."
"Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du mich nicht so nennen sollst?"
"Sorry. Hey, Riley."
Riley lachte leise.
"Selber hey. Wie geht es dir?"
"Okay, denke ich."
Ein Schweigen folgte.
Typisch Teenager, dachte Riley. Es war immer schwer, Jilly zum Sprechen zu bringen.
"Was machst du so?" fragte Riley.
"Wache gerade erst auf", antwortete Jilly und klang müde. "Gleich geht's zum Frühstück."
Riley erinnerte sich erst jetzt daran, dass es in Phönix drei Stunden früher war.
"Es tut mir leid, dass ich so früh anrufe", sagte Riley. "Ich vergesse immer wieder den Zeitunterschied."
"Ist okay. Nett, dass du anrufst."
Riley hörte ein Gähnen.
"Gehst du heute zur Schule?" fragte Riley.
"Ja. Sie lassen uns dafür jeden Tag aus dem Knast."
Das war Jillys Running Gag, die Unterkunft "Knast" nennen, als wäre es ein Gefängnis. Riley fand es nicht sonderlich lustig.
Sie erwiderte, "Na, dann lasse ich dich mal zum Frühstück gehen und dich fertig machen."
"Hey, warte noch einen Moment", sagte Jilly.
Wieder folgte ein Schweigen. Riley dachte, dass sie ein unterdrücktes Schluchzen von Jilly hörte.
"Niemand will mich Riley", stieß Jilly dann hervor. Sie weinte leise. "Die Pflegefamilien sehen immer über mich weg. Sie mögen meine Vergangenheit nicht."
Riley war erstaunt.
Ihre "Vergangenheit"? dachte sie. Meine Güte, wie kann denn eine Dreizehnjährige eine "Vergangenheit" haben? Was ist nur los mit den Leuten?
"Das tut mir leid", sagte sie laut.
Jilly sprach verhalten durch ihre Tränen.
"Es ist irgendwie ... na ja, du weißt, es ist ... ich meine, Riley, es scheint so, als wärst du die einzige, die sich etwas aus mir macht."
Rileys Kehle wurde eng und ihre Augen stachen. Sie konnte nicht antworten.
Jilly sagte, "Kann ich nicht bei dir wohnen? Ich mache auch nicht viele Umstände. Du hast eine Tochter, oder? Sie könnte wie meine Schwester sein. Wir könnten aufeinander aufpassen. Ich vermisse dich."
Riley fiel es schwer zu sprechen.
"Ich ... Ich glaube nicht, dass das möglich ist, Jilly."
"Warum nicht?"
Riley war fassungslos. Die Frage traf sie wie eine Kugel mitten ins Herz.
"Es ist einfach ... nicht möglich", sagte Riley.
Sie konnte Jilly leise weinen hören.
"Okay", sagte Jilly niedergeschlagen. "Ich muss jetzt zum Frühstück gehen. Tschüss."
"Tschüss" sagte Riley. "Ich rufe bald wieder an."
Sie hörte ein Klicken, als Jilly den Anruf beendete. Riley beugte sich über ihren Schreibtisch, die Tränen an ihrem Gesicht herunterlaufend. Jillys Frage hallte ihr immer wieder durch den Kopf.
"Warum nicht?"
Es gab tausend verschiedene Gründe. Sie hatte schon mit April alle Hände voll zu tun. Ihre Arbeit war aufreibend, sowohl was die Zeit, als auch ihre Energie anging. Und war sie überhaupt dafür qualifiziert oder darauf vorbereitet, sich mit den psychologischen Schäden auseinanderzusetzen, die Jilly erlitten hatte? Natürlich war sie das nicht.
Riley wischte sich über die Augen und setzte sich auf. In Selbstmitleid zu versinken würde niemandem helfen. Es war Zeit wieder an die Arbeit zu gehen. Dort draußen starben Mädchen und die brauchten sie.
Sie nahm den Ordner und öffnete ihn. Sie fragte sich, ob es an der Zeit war, an den Ort des Geschehens zurückzukehren.
KAPITEL DREI
Scratch saß auf der Hollywoodschaukel seiner Veranda und beobachtete die Kinder, die in ihren Halloweenkostümen unterwegs waren. Normalerweise genoss er die "Süßes oder Saures"-Tradition. Aber dieses Jahr schien es eine bittersüße Angelegenheit zu sein.
Wie viele dieser Kinder werden in ein paar Wochen noch leben? fragte er sich.
Er seufzte. Wahrscheinliches keines von ihnen. Der Tag rückte immer näher und niemand achtete auf seine Nachrichten.
Die Hollywoodschaukel knarzte. Ein leichter, warmer Regen fiel und Scratch hoffte, dass die Kinder sich nicht erkälten würden. Er hatte einen Korb mit Süßigkeiten auf dem Schoß und er war sehr großzügig. Es wurde spät und bald würden keine Kinder mehr unterwegs sein.
In seinem Kopf beschwerte sein Großvater sich noch immer, auch wenn der griesgrämige, alte Mann schon vor Jahren gestorben war. Und es machte auch keinen Unterschied, dass er jetzt erwachsen war. Er würde nie von den Kommentaren des alten Mannes frei sein.
"Sieh dir den da an, in dem Umhang und der schwarzen Plastikmaske", sagte Großvater. "Nennt der das etwa ein Kostüm?"
Scratch hoffte, dass er und sein Großvater sich nicht wieder streiten würden.
"Er ist als Darth Vader verkleidet, Großvater", sagte er.
"Mir ist egal, was zur Hölle er darstellen soll. Das ist ein billiges, gekauftes Kostüm. Wenn ich dich zum "Süßes oder Saures" begleitet habe, dann habe ich auch immer ein Kostüm für dich gemacht."
Scratch erinnerte sich an diese Kostüme. Um ihn in eine Mumie zu verwandeln, hatte Großvater ihn in zerrissene Bettlaken gewickelt. Um aus ihm einen Ritter in glänzender Rüstung zu machen, hatte Großvater ihn in einen sperrigen Pappkarton gesteckt, der mit Aluminiumfolie beklebt war und er hatte eine Lanze getragen, die aus einem Besenstiel bestand. Die Kostüme von Großvater waren immer einfallsreich gewesen.
Trotzdem erinnerte Scratch sich nicht gerne an diese Halloweens. Großvater würde immer fluchen und sich beschweren, während er ihn in diese Kostüme verfrachtete. Und wenn Scratch wieder nach Hause kam ... dann fühlte er sich für einen Moment wieder wie ein kleiner Junge. Er wusste, dass Großvater immer Recht hatte. Scratch verstand nicht immer warum, aber das war egal. Großvater hatte Recht und er hatte Unrecht. So war es nun einmal. So war es schon immer gewesen.
Scratch war erleichtert gewesen, als er zu alt dafür wurde, von Haus zu Haus zu ziehen. Seitdem konnte er auf der Veranda sitzen und Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Er freute sich für sie. Er war froh, dass sie ihre Kindheit genießen konnte, auch wenn es bei ihm anders gewesen war.
Drei Kinder kamen die Veranda herauf. Ein Junge war als Spiderman verkleidet, ein Mädchen als Catwoman. Sie sahen aus, als wären sie etwa neun Jahre alt. Das Kostüm des dritten Kindes brachte Scratch zum Lächeln. Ein kleines Mädchen, etwa sieben Jahre alt, trug ein Bienenkostüm.
"Süßes oder Saures!" riefen sie zusammen und stellten sich erwartungsvoll vor Scratch auf.
Er lachte leise und suchte durch den Korb nach Süßigkeiten. Er gab ihnen welche, sie bedankten sich und gingen wieder.
"Hör auf denen Süßes zu geben!" knurrte Großvater. "Wann hörst du endlich auf die kleinen Bastarde zu ermutigen?
Scratch hatte sich Großvater nun seit einigen Stunden schweigend widersetzt. Er würde später dafür bezahlen.
Großvater grummelte noch immer. "Vergiss nicht, wir haben morgen Abend Arbeit vor uns."
Scratch antwortete nicht, sondern hörte einfach dem Knarzen der Hollywoodschaukel zu. Nein, er hatte nicht vergessen, was in der nächsten Nacht anstand. Es war eine dreckige Arbeit, aber sie musste getan werden.
*
Libby Clark folgte ihrem großen Bruder und ihrer Cousine in die dunklen Wälder, die hinter den Gärten der Nachbarschaft lagen. Sie wollte nicht hier sein. Sie wollte sich zu Hause in ihr Bett kuscheln.
Ihr Bruder, Gary, führte sie an und leuchtete mit der Taschenlampe. Er sah seltsam aus in seinem Spiderman-Kostüm. Ihre Cousine Denise folgte Gary in ihrem Catwoman-Kostüm. Libby trottete hinter den beiden her.
"Kommt schon ihr beiden", sagte Gary und schob sich weiter.
Er schlüpfte mit Leichtigkeit zwischen zwei Büschen hindurch, genauso wie Denise, aber Libbys Kostüm war groß und rund und blieb an einigen Zweigen hängen. Jetzt hatte sie etwas Neues, um das sie sich Sorgen machten konnte. Wenn das Bienenkostüm ruiniert wurde, dann würde ihre Mutter einen Anfall bekommen. Libby schaffte es, sich zu befreien und hinter den anderen her zu stolpern.
"Ich will nach Hause", sagte Libby.
"Geh doch", erwiderte Gary ungerührt und ging weiter.
Aber natürlich hatte Libby zu große Angst, um zurückzugehen. Sie waren schon viel zu weit. Sie traute sich nicht alleine zurück.
"Vielleicht sollten wir alle zurückgehen", warf Denise ein. "Libby hat Angst."
Gary hielt an und drehte sich um. Libby wünschte sich, sie könnte sein Gesicht hinter der Maske sehen.
"Was ist los, Denise?" fragte er. "Hast du auch Angst?"
Denise lachte nervös.
"Nein", sagte sie. Aber Libby wusste, dass sie log.
"Dann kommt schon, alle beide", sagte Gary.
Die kleine Gruppe bewegte sich weiter. Der Boden war glitschig und matschig und Libby war bis zu den Knien in nassem Gestrüpp. Wenigstens hatte es aufgehört zu regnen. Der Mond zeigte sich langsam durch die dunklen Wolken. Aber es wurde auch kälter und Libby war nicht nur durchnässt, sie zitterte auch und sie hatte wirklich, wirklich Angst.
Schließlich öffneten sich die Bäume und Sträucher in eine große Lichtung. Dampf stieg von dem nassen Boden auf. Gary hielt am Rand der Lichtung an und Denise und Libby taten es ihm gleich.
"Hier ist es", flüsterte Gary und zeigte vor sich. "Schaut – es ist rechteckig, als hätte hier ein Haus oder sowas stehen sollen. Aber hier ist kein Haus. Hier ist gar nichts. Hier wachsen nicht mal Bäume und Büsche. Nur Unkraut. Weil das ein verfluchter Boden ist. Hier leben Geister."
Libby rief sich in Erinnerung, was ihr Daddy gesagt hatte.
"So etwas wie Geister gibt es nicht."
Trotzdem zitterten ihr die Knie. Sie hatte Angst, dass sie sich in die Hose machen würde. Mommy würde das gar nicht gefallen.
"Was ist das?" fragte Denise.
Sie zeigte auf zwei Formen, die aus dem Boden kamen. Für Libby sah es aus, wie zwei große Röhren die oben gebogen waren und sie waren fast komplett mit Efeu überwachsen.
"Ich weiß nicht", sagte Gary. "Sie erinnern mich an U-boot Periskope. Vielleicht beobachten die Geister uns. Geh und sieh nach, Denise."