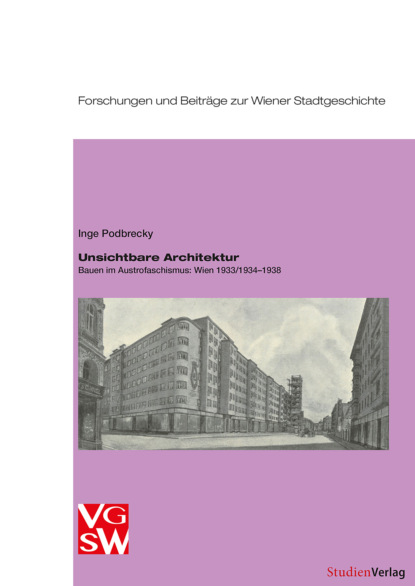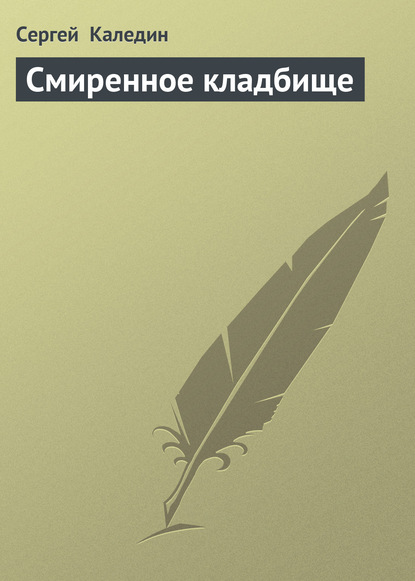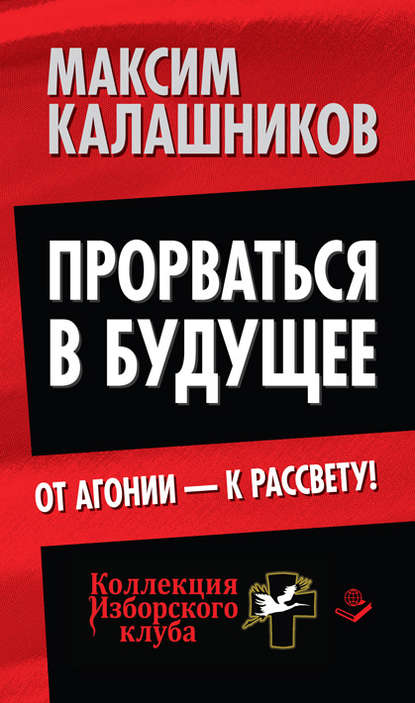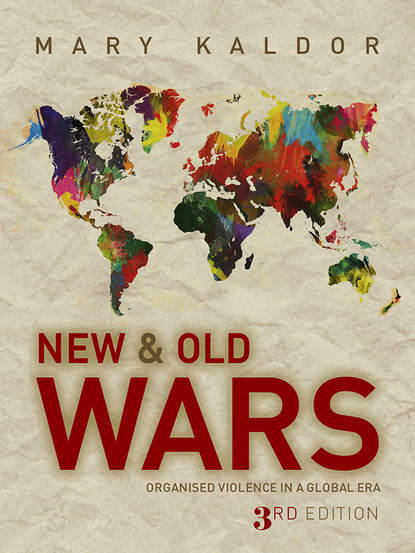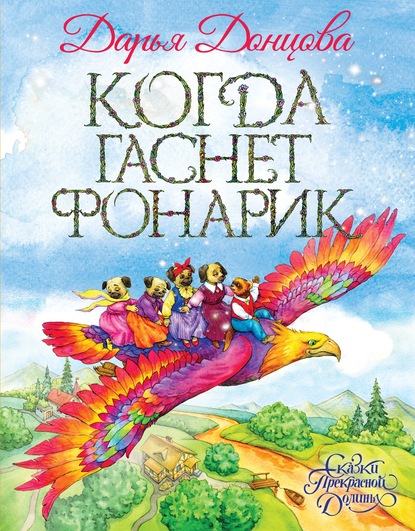- -
- 100%
- +
Von den Verbänden, die rund um den Katholikentag 1933 präsent waren, muss noch die neue Einheitspartei, die Vaterländische Front, erwähnt werden. Ihre damals noch spärlichen Mitglieder bildeten zusammen mit den paramilitärischen Heimwehren und anderen Wehrverbänden die Folie für Dollfuß’ Trabrennplatzrede. Im Frühjahr 1933 von Dollfuß selbst gegründet, sollte die Partei ein Sammelbecken des Regierungslagers sein, getragen von „Vaterlandsliebe, Vaterlandsbewusstsein und Heimatstolz“ für die „Erfüllung seiner [Österreichs, d. A.] Stellung im mitteleuropäischen Raum zum Wohle des gesamten Deutschtums.“ Am 21. Mai 1933 erfolgte der offizielle Aufruf zum Beitritt; als Symbol der Vaterländischen Front wurde das Kruckenkreuz gewählt, als Symbol christlichen Deutschtums und als Gegenpol zum heidnischen Hakenkreuz.116 In der Folge diente die Vaterländische Front als Hintergrundmasse bei den ästhetisierten Spektakeln von Politik und Kirche, aber auch als Promotorin des Dollfußkults. Ihr eigentliches Denkmal, das Haus der Vaterländischen Front, von Clemens Holzmeister im Herzen der Macht am Wiener Ballhausplatz projektiert, sollte nicht mehr zur Ausführung kommen. Eine wichtige Rolle in der Organisation spielte Ernst Rüdiger Starhemberg, der gleichnamige Nachfolger eines Türkenverteidigers von 1683, Heimwehr-Führer und von 1934 bis 1936 Bundesführer der Vaterländischen Front sowie Vizekanzler.117 Auch seine Mutter, Fanny Starhemberg, trat in mehreren politischen Funktionen auf.
Personen, Institutionen, Daten und Orte des Katholikentags 1933 und die mit ihm assoziierten politischen und militärischen Veranstaltungen bilden den „roten Faden“, entlang dessen sich Erinnerungs- und Symbolkultur des Austrofaschismus und damit seine baulichen Interventionen organisieren sollten. Einige dieser Interventionen stehen in Traditionen, die lange in die Zeit vor 1933/1934 zurückreichen, so dass sich zahlreiche Spannungsfelder zwischen Kontinuitäten und Brüchen eröffnen.
DAMNATIO MEMORIAE UND „GEWOLLTE“ DENKMALE
Rasch durchführbare Maßnahmen zur Sichtbarmachung einer Ideologie im Stadtraum sind einerseits die Tilgung und Ersetzung von mit dem politischen Gegner assoziierten Namen und Bezeichnungen im öffentlichen Raum, andererseits dessen Inbesitznahme durch öffentliche Manifestationen, die das alte politische Ritual durch ein neues überschreiben, das neue Feiern, Feste, Gedenktage und Rituale etabliert. Beides geschah in rascher Folge nach dem Februar 1934 und nach der „Legitimierung“ des Regimes durch die oktroyierte Verfassung vom 1. Mai 1934.
Nach der Machtübernahme der Austrofaschisten im Februar 1934 galt es, Erinnerungsorte und Denkmäler mit sozialdemokratischer Prägung rasch umzugestalten oder abzubauen. Oberste Priorität hatte das den Konservativen verhasste Republikgründungsdenkmal an der Ringstraße (Abbildung 13). Die Porträtbüste des sozialdemokratischen Bürgermeisters Jakob Reumann auf einer Stele in der Mittelachse des Reumannhofs in Wien-Margareten wurde 1934 abgenommen, die Inschrift durch eine Fahne mit dem Christusmonogramm XP (Chi Rho), dem Emblem der Ostmärkischen Sturmscharen, ersetzt. 1934 wurde auch das Ferdinand-Hanusch-Denkmal im 3. Bezirk entfernt.118 Unberührt blieb das Stadiondenkmal, ein Monument, das zum zehnjährigen Bestehen des Wiener Stadions und der Ersten Republik aufgestellt worden war, ebenso das Denkmal Anton Hanaks für die Opfer des Justizpalastbrands und das pazifistische Kriegerdenkmal am Zentralfriedhof.

Abbildung 13: Republikgründungsdenkmal
Außerdem erfolgten Straßen- und Gebäudeumbenennungen, allerdings nicht sehr konsequent. Zahlreiche Wohnbauten des Roten Wien, kurz zuvor als Schauplätze des Widerstands im Februar 1934 von der Exekutive beschossen, waren nach marxistischen Theoretikern, Führern und Funktionären benannt. Dementsprechend wurde der Karl-Marx-Hof zunächst nach einem an seiner Eroberung im Februar 1934 beteiligten Heimwehrmitglied inoffiziell in „Biedermannhof“ umbenannt, bevor er zum unverfänglicheren „Heiligenstädter Hof“ wurde. Der Matteottihof, benannt nach dem von Faschisten ermordeten italienische Sozialisten Giacomo Matteotti, wurde zum „Giordanihof“, benannt nach einem von den Kommunisten ermordeten Faschisten.119 Aus dem an sich neutralen Azaleenhof, im Volksmund „Indianerhof“, wurde – nach dem gleichnamigen Heimwehrführer – der „Emil-Fey-Hof“. Neutrale Benennungen wie „Goethehof“ wurden teilweise beibehalten,120 bei Höfen, die nach lokalen sozialdemokratischen Funktionären benannt waren, wurden die Tafeln abmontiert. Jedenfalls scheint es, als hätte man alle Persönlichkeiten, die mit dem gesellschaftlichen Fortschritt zu tun gehabt hatten, aus dem Stadtbild getilgt.121 Unverständlich ist jedoch, wie der nach dem ersten sozialdemokratischen Bürgermeister Jakob Reumann benannte Hof die ganze austrofaschistische Periode hindurch seinen Namen behalten konnte, ebenso der Schuhmeierhof in Ottakring, benannt nach einem 1913 ermordeten Gegenspieler Luegers, Volksredners und SP-Politikers, dessen Denkmal allerdings 1934 entfernt wurde.122 Außerdem erfolgte die Tilgung der Namen von George-Washington-Hof, Herwegh- und Heinehof, Kronawetter- unf Jodlhof sowie Robert-Blum-Hof.123 Die wenigen kommunalen Wohnbauten, die die Austrofaschisten selbst in den folgenden Jahren in Wien errichten sollten, erhielten die Namen von Heiligen: St. Engelbert nach dem Kanzler, St. Richard nach Bürgermeister Richard Schmitz, St. Elisabeth, St. Josef und St. Anna nach den Schutzpatronen der Familie usw.124 Die historische Benennung der Familienasyle, die im Eigentum der Gemeinde Wien blieben, wurden zu einem unbekannten Zeitpunkt – wohl schon zwischen 1938 und 1945 – bis auf eine einzige Tafel in der Hauseinfahrt von St. Elisabeth entfernt.
Die Straßenumbenennungen hielten sich in Grenzen: Der republikanisch benannte „Freiheitsplatz“ mit Bezug auf die Republikgründung, mit der Votivkirche auch ein wichtiger habsburgischer Erinnerungsort, wurde zum „Dollfußplatz“, bis er 1938 in „Hermann-Göring-Platz“ umbenannt wurde. 1945 hieß er wieder „Freiheitsplatz“, um 1956 in „Rooseveltplatz“ umbenannt zu werden.125 Ein Teilstück der Wollzeile wurde zur Weiskirchnerstraße, benannt nach dem christlichsozialen Bürgermeister von 1912 bis 1919,126 und Teilstücke des Rings wurden nach Bürgermeister Lueger und nach dem christlichsozialen Bundeskanzler und Priester Ignaz Seipel umbenannt.127
Einer der wichtigen sozialdemokratischen Erinnerungsorte war der Wiener Prater. Die Maiaufmärsche der SDAP hatten zwischen 1890 und 1918 auf der Prater Hauptallee stattgefunden.128 Das Stadion, ein sozialdemokratisches Monument, wurde auch nach dem Katholikentag 1933 immer wieder vom Regime mit Massenveranstaltungen bespielt, unter anderem zum Ersten Mai. Dieser traditionelle Festtag der Sozialdemokratie wurde mit der Verkündung der austrofaschistischen Verfassung am 1. Mai 1934 erstmals als Gründungstag des neuen Staats „überschrieben“ und mit Weihe und Festspielen im Stadion gefeiert. Dabei fanden „Huldigungszüge“ der mittelalterlich kostümierten Stände statt, deren Zeichen Clemens Holzmeister entworfen hatte (Abbildung 14).129

Abbildung 14: Clemens Holzmeister, Zeichen der Berufsstände (Profil 1935, 418)
Für den Festzug am 1. Mai 1934 beschäftigte Holzmeister unter anderem Gudrun Baudisch, Lotte Hahn, Oswald Haerdtl, Otto Hurm, Eduard Wimmer, Franz Zülow und Josef Wenzel, Künstler aus dem Umfeld des Neuen Werkbunds, mit denen er häufig zusammenarbeitete.130 Solche Inszenierungen mögen Holzmeister besonders gelegen gewesen sein; in seiner Autobiografie beschreibt er seine Theaterleidenschaft,131 die sich unter anderem in seiner Tätigkeit für das Festspielhaus und die Fauststadt in Salzburg niederschlug.
Auf Anordnung des Stadtschulrats wurden immer wieder zahlreiche Kinder zu „Kinderhuldigungen“ abkommandiert. Auch diese hatten ein Vorbild in der Propaganda- und Festkultur der Ära von Bürgermeister Lueger: Am 24. Juni 1898 hatte zum 50. Regierungsjubiläum des Kaisers auf der Ringstraße ein Kinderfestzug mit 70.000 mittelalterlich kostümierten Kindern stattgefunden, der bildlichen Niederschlag in einem Wandgemälde im Rathauskeller fand.132 Diese Rückwärtsorientierung der austrofaschistischen Festkultur hatte eine Parallele in der sich erst konstituierenden Festpraxis des frühen Nationalsozialismus: Auch der Münchner Festzug zur Grundsteinlegung des Hauses der Deutschen Kunst 1933, der nur kurz nach dem Katholikentag Mitte Oktober 1933 stattfand, orientierte sich an den Festzügen des 19. Jahrhunderts und thematisierte unter dem Motto „Glanzzeiten deutscher Geschichte“ zahlreiche historische Bezüge zum Mittelalter.133
Bei den jährlich wiederholten Festen im Stadion wurden eigens verfasste „Weihespiele“ aufgeführt, die unter anderem vom linientreuen Rudolf Henz, dem Chef des österreichischen Rundfunks und Clemens Holzmeisters Vorgesetzter im Kulturreferat der Vaterländischen Front, verfasst wurden. Bei diesen Spielen wurden im Sinn des von den Austrofaschisten stark geförderten Laienspiels Sprechchöre unter Beteiligung des Publikums einbezogen, die im Sinn des zeitgenössischen Theaters das Dargestellte, den imaginierten austrofaschistischen Idealstaat, unter der Regie der Machthaber durch aktive Beteiligung der Betroffenen zu deren aktueller Lebenswelt machten und durch historische Bezüge zu legitimieren versuchten.134 Hier manifestierte sich der Einfluss der katholischen Reformliturgie, die die Gläubigen durch gemeinsames Sprechen, Singen und Bewegen (Stehen, Knien, Sitzen) aktiv an der an der Messe beteiligte. Zugleich waren die in diesen Weihespielen durch einen Regisseur vorgeschriebenen Aktivitäten der Masse eine sinnbildliche Darstellung des autoritären Prinzips.
Auch sonst mangelte es nicht an Gelegenheiten für Inszenierungen. Der 27. Mai wurde zum „Tag der Jugend“ proklamiert und 1934 unter der Regie von Holzmeister und unter Mitarbeit von Ceno Kosak, Eduard Wimmer, Albert Paris Gütersloh, Oswald Haerdtl und weiteren Mitgliedern des Neuen Werkbund Österreich gestaltet.135 Überhaupt entstand vor allem nach Ermordung von Kanzler Dollfuß ein dichtes Geflecht an bezugsreichen Jubiläums-, Erinnerungs-, Weihe- und Namenstagsterminen: Geburtstag und Sterbetag Dollfuß’, Befreiung Wiens von den Türken und von der Sozialdemokratie, Vollendung des Stephansdoms, Tag der Verfassung, Namenstage von Kanzler, Bürgermeister etc.
Das Wiener Rathaus, erbaut als Monument der bürgerlich-liberalen Ära, Sitz der sozialdemokratischen Stadtverwaltung und bereits 1934 durch die Aufbahrung des ermordeten Bundeskanzlers Dollfuß symbolisch „umgedreht“,136 wurde nun durch den „Ball der Stadt Wien“ besetzt, dessen Ausstattung 1935 Holzmeister besorgte: „Rot-weiße Fahnen in gedämpften Tönen, 68 goldene Schabraken [sic!] mit den Ständezeichen und ein riesiger Wandbehang hinter der Ehrentribüne, der den goldenen Adler der Stadt Wien auf grauem Grunde zeigt, schmücken den Saal.“137 Das Ambiente war festlich, aber wie die meisten Inszenierungen des Ständestaats von würdig-getragener Grundstimmung.
Ein weites Feld boten die zahlreichen kirchlichen Feiertage. Fronleichnam, schon von den Habsburgern als gemeinsame Demonstration von Kirche und Staat im öffentlichen Raum inszeniert,138 wurde von den neuen Machthabern wieder aufgewertet. Schon 1934 witterte die Zeitschrift „Profil“ hier ein weites Betätigungsfeld für die Künstler, denn es hätte bis dahin ein „künstlerischer Gesamtplan (Spitze des Zuges, vorbereitender Teil mit konsequenter Steigerung der Bedeutung und kräftigen formalen Cäsuren zwischen den einzelnen Abteilungen, etwa Fahnen- oder Figurengruppen, Höhepunkt und formvollendeter Schluss)“ gefehlt, und „nur vollendete künstlerische Gestaltung“ sei einer „Feier der heiligen Eucharistie gemäß“.139 Keine Gelegenheit zum Zelebrieren kirchlicher Feste wurde ausgelassen. Religion wurde keineswegs heiter und positiv betrieben; Feiern und Ambiente waren würdig, ernsthaft und sorgfältig inszeniert. „Ein katholischer Kulturmief, gespreizt und gravitätisch, moralisierend und pathetisch, machte sich überall breit“, schrieb Ernst Hanisch zum Klima, das in den 1930er Jahren in Österreich vorherrschte.140 Dadurch unterschied sich die austrofaschistische Festkultur deutlich von der zukunftsoptimistischen der vorhergegangenen sozialdemokratischen Manifestationen, aber auch von jener des Nationalsozialismus, die, wie S. Behrenbeck schrieb, eine „Erzeugung […] zuversichtlich gestimmter Gefühle oder zielgerichteter Aggressionen“ und die Vermeidung „introvertierter Besinnlichkeit oder trauriger Niedergeschlagenheit“ anstrebte.141

Abbildung 15: Lichtensteg 2/Rotgasse, Mosaik
Eine weitere rasch und günstig durchführbare Maßnahme zur Überformung des Stadtraums war das Anbringen von zeichenhafter Kunst-am-Bau. Hier fand die austrofaschistische Geschichts- und Vergangenheitsfixierung, die aktuelle Identität durch ideologisch günstige Geschichtsbezüge vermitteln wollte, ein weites Betätigungsfeld in einer langen Reihe von Kleindenkmälern, Haus- und Straßenzeichen, Figuren und Brunnen. „Künstlerische Denkzeichen zur Erklärung der Namen von Straßen und Plätzen“ sollten auf die lokale Geschichte verweisen.142 Diese Projekte setzten mit der Kunst-am-Bau und den oft weithin sichtbaren Inschriften an den sozialdemokratischen Gemeindebauten einen anderen, wenn auch viel weniger politisch deutlichen Subtext im öffentlichen Raum entgegen.
Eine Reihe dieser Zeichen bezog sich auf das historische Stadtbild, wie das bis vor einigen Jahren am Haus Lichtensteg 2 („Zum Römertor“) sichtbare Mosaik, das den Standort der Porta principalis dextra von Vindobona markierte (Abbildung 15).
Unweit davon wurde nahe dem Standort des Rotenturmtors an einem Haus in der Rotenturmstraße ein Mosaik mit einer stilisierten Darstellung des mittelalterlichen Torbaus von Reinhold Klaus angebracht. Ein Bild am Haus Ungargasse 7, eine Arbeit von Oskar Thiede, erinnerte an eine Herberge an der alten Hauptverbindung nach Ungarn, und in der Verbauung der Operngasse zeigt eine Darstellung des alten Freihauses die Vorgängerbebauung des Viertels (Abbildung 16).

Abbildung 16: Operngasse 36, Plan des alten Freihauses
Diese Darstellungen sind vorwiegend symbolisch-schematisch gehalten. Ein Wandbildentwurf von Ferdinand Kitt für einen Durchgang an der Bäckerstraße zeigte neben einer entsprechenden Inschrift recht konventionelle gegenständliche Bäckerdarstellungen,143 die an Buchillustrationen erinnern (Abbildung 17), und eine Inschrift an der Karmeliterkirche in der Taborstraße sollte lehrbuchhaft auf deren Vergangenheit verweisen. Die beschäftigten Künstler waren unter anderem Ferdinand Kitt, Josef Riedl, A. Kautzky, O. Schottenberger, J. Rezac, E. Grienauer, Stefan Simony. A. Janesch, Otto Hofner, R. Holzinger, O. Roux, F. Zeymer, Rudolf Schmidt, Arthur Brusenbauch und andere.144 Die Zeitschrift „Profil“, obwohl Organ der weitgehend regimetreuen Architektenvereinigung, reagierte gereizt auf die Gedenktafelinflation: „Wenn schon einem fast manischen Triebe, zahllose Gedenktafeln zu enthüllen, Folge geleistet werden soll, dann müssen dieselben […] künstlerischen Wert besitzen […]. Unähnliche, geradezu lächerliche Portraits und elende Schriftformen scheinen leider fast schon zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein.“145

Abbildung 17: Ferdinand Kitt, Entwurf für Kunst-am-Bau in der Bäckerstraße (Profil 1934, 447)
Wiener Sagen und Legenden hatten sich bereits unter Bürgermeister Lueger einer Renaissance erfreut146 und damit einer neuen Mittelalterrezeption Vorschub geleistet, an die der Ständestaat nun anschloss. Ein Neubau am Wienfluss, „Zum Wassermännlein“, erinnert an eine Altwiener Sage und erhielt eine entsprechende Skulptur von Otto Hofner, der immerhin den prominenten „Sämann“ vor dem Karl-Marx-Hof geschaffen hatte.
Neubauten, wie die Siedlungshäuser am Wienerberg, wurden mit Hauszeichen in Form von Heiligenbildern versehen, ebenso die „Familienasyle“, die die Namen von Ständestaat-Lieblingsheiligen, vorwiegend Namenspatronen des politischen Personals, erhielten.
Das „Heldendenkmal“ im Burgtor
Das früheste gewollte und realisierte Denkmal der austrofaschistischen Ära reicht noch in die Erste Republik zurück: Mit der Einrichtung des Österreichischen Heldendenkmals im Wiener Burgtor erfolgte die austrofaschistische Neukodierung eines bereits bestehenden Denkmalbaus (Abbildung 18).

Abbildung 18: Burgtor, Fassade zur Ringstraße
Die Initiative für das Heldendenkmal im Burgtor nahe der kaiserlichen Hofburg am Burgring ging auf das Militär zurück, das im Februar 1934 wichtigster Verbündeter des Regimes bei der Unterwerfung der Sozialdemokratie werden sollte.
Unter dem Titel „Der große Undank“ beklagte der Präsident der Vereinigung zur Errichtung eines österreichischen Heldendenkmals den Empfang, der den heimkehrenden Soldaten des Ersten Weltkriegs in Österreich bereitet worden war: „Bei der Heimkehr empfing die Braven kein Dank. Der Wehr beraubt, verspottet und verunglimpft […] ging das Millionenheer still auseinander.“ Der Verlust von Einkommen und Beschäftigung, aber vor allem von sozialem Status hatte den Soldaten der k. k. Armee nach dem Ersten Weltkrieg und der folgenden Republikgründung besonders hart zugesetzt. Die ehemaligen Soldaten fühlten sich nach Auflösung der Armee – auch mangels friedenstauglicher Berufsausbildung – als Verlierer der Republikgründung. Ein wenig Anerkennung boten die in vielen Orten der Provinz entstandenen Kriegerdenkmäler,147 ein solches Denkmal fehlte jedoch in Wien. Seit 1925 bemühte sich die Frontkämpfervereinigung um ein Wiener Kriegerdenkmal. Der Vorschlag zur Umgestaltung des Äußeren Burgtors zu einem Heldendenkmal stammte von Generalmajor Karl Jaschke. Auch von ziviler Seite wurden ähnliche Projekte betrieben; so bemühte sich ein Kommerzialrat Wallace um die Errichtung eines Grabmals des Unbekannten Soldaten in der Mitteldurchfahrt des Burgtors.148 Beide Intentionen – Kriegerdenkmal und Grab des Unbekannten Soldaten – wurden von Jaschke zusammengeführt. Man wünschte sich ein Denkmal für die toten und lebenden Soldaten des „Großen Krieges“, aber auch ein Denkmal der „Jahrhunderte alten ruhmreichen Armee, ein Denkmal der tausend Schlachten, in denen die Söhne Österreichs gefochten hatten“,149 Identifikationsort für die kaisertreue Armee als Statusgarant und Identifikationsobjekt einer rückwärtsgewandten gesellschaftlichen Gruppe, die mit der Republik wenig anfangen konnte und wollte. Bald kam es zur Gründung einer Vereinigung zur Errichtung des Denkmals, die sich unter den Ehrenschutz von Regierung, Erzbischof Kardinal Innitzer und den Landeshauptleuten stellte. Ehrenpräsident war Staatssekretär Generaloberst Alois Schönburg-Hartenstein, der wenig später in den Februarkämpfen 1934 „persönlich die großen militärischen Unternehmungen zur Unterdrückung der Schutzbund-Rebellion“ leiten sollte“.150
Einen geeigneten Denkmalbau gab es bereits: Das Burgtor auf dem Heldenplatz. Das alte Tor, Teil der Stadtbefestigung vor der kaiserlichen Burg, war beim Abzug der napoelonischen Truppen 1809 gesprengt worden. Der existierende Bau wurde von Luigi Cagnola und – nach Planänderungen – Peter von Nobile im Auftrag Kaiser Franz’ I. (II.) als Symbol der Überwindung Napoleons durch die kaiserliche Armee errichtet und 1824 am Jahrestag der Völkerschlacht von Leipzig als deren Denkmal eröffnet.151 Das verteidigungstechnisch längst nutzlose Tor war also bereits als Denkmalbau konzipiert worden, so dass hier auf historischem Identifikationsmaterial aufgebaut werden konnte. Dieser Denkmalcharakter des Burgtors war in der Ersten Republik allgemein verständlich: Auch die Sozialdemokratie hatte 1928 zum zehnten Jahrestag der Republikgründung über eine Überformung des Burgtors nachgedacht.152
Das Tor markiert den Zugang zum Platz vor der kaiserlichen Burg, der durch die beiden Standbilder Erzherzog Karls, des Siegers von Aspern gegen Napoleon, und des Türkensiegers Prinz Eugen von Savoyen bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dynastisch-militärisch konnotiert war, worauf auch die Gestaltung des Heldenplatzes durch Gottfried Semper ab 1869 reagierte. Durch den Abbruch der Stadtmauern und die daraus folgende Freistellung erhielt das Tor zusätzlichen Denkmalcharakter als Solitärbau.153 Im Ersten Weltkrieg wurde das Burgtor als Kriegerdenkmal überformt: Am Fries wurden auf Initiative entsprechender Organisationen Wappen mit Lorbeerkränzen angebracht. Die Lorbeerzweige an der Vorderseite hatten Kaiser Franz Joseph I. und die im Ersten Weltkrieg verbündeten Souveräne gestiftet. Dazu kam die Inschrift „Laurum militibus lauro dignis“ mit der Jahreszahl 1916. Diese bereits bestehende Symbolfunktion des Burgtors als Stätte des Gedenkens an die kaiserliche Armee und an einen Krieg, der 1933 noch nicht lange zurücklag, mag den Ausschlag für die Wahl des Objekts gegeben haben, denn „die Stadt und der urbane Kontext bilden sich nicht als bloße Akkumulation isolierter Gebäude und Plätze, vielmehr als ein palimpsestartiges Gebilde ineinandergreifender Schichten und Partikel.“154
Das Burgtor wurde der Denkmalinitiative von Handels- und Verkehrsminister Guido Jakoncig zur Verfügung gestellt, vorbehaltlich der Genehmigung des Umbaus durch Burghauptmannschaft und Bundesdenkmalamt.155 Es wurden Spenden gesammelt, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeworben,156 der „Wehrmann in Eisen“ wurde reaktiviert.157
Architekt Silvio Mohr formulierte die Bedingungen für den Architektenwettbewerb zur Umgestaltung des Burgtors, der Ende Juli 1933 ausgeschrieben wurde. Im Mittelpunkt standen „1. Dank den Gefallenen, 2. Gedächtnis der Lebenden, 3. Ehrenmal der Armee, der Marine und der Luftfahrt vom 17. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.“158 Die Jury setzte sich aus zahlreichen hohen Militärs, Künstlern und Architekten des konservativen Lagers zusammen (Silvio Mohr, Othmar Schimkowitz, Justus Schmidt, Ernst Hegenbarth, Karl Sterrer, Ferdinand Andri, Michael Powolny, Anselm Weißenhofer, Fritz Zerritsch, Karl Holey, Clemens Holzmeister, Karl Krauß). Ende Oktober 1933 waren 173 Entwürfe eingelangt. Von neun prämierten Projekten kam drei in die Endauswahl, und zwar jene von Leo von Bolldorf, Rudolf Wondracek und Fellerer & Wörle. Fellerer war ein enger Mitarbeiter des Jurymitglieds Holzmeister, dessen Einfluss bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal kritisch kommentiert wurde: In einem anonymen Brief hieß es: „niemand wagt es auch nur im geringsten sich dem mächtigen Prof. Holzmeister offen entgegenzustellen, da er an der Spitze der wichtigsten Künstlervereinigungen steht.“159
Die Siegerprojekte wurden am 18. Februar, nur wenige Tage nach der gewaltsamen Niederschlagung der Februarkämpfe durch das Bundesheer, im Messepalast der Öffentlichkeit präsentiert. Das Projekt von Rudolf Wondracek aus St. Pölten wurde zur Ausführung bestimmt. Wondracek (1886–1942) hatte in Wien bei Karl König und Otto Wagner studiert, bevor er 1913 zu Peter Behrens nach Berlin ging. Seit 1927 war er Architekt und Hochbaureferent im Stadtbauamt St. Pölten, eine Tätigkeit, die er 1934 zugunsten einer Laufbahn als freier Architekt aufgab.
Das Heldendenkmal war als „Alter des Vaterlands“ gedacht, auf dem „Toten Krieger“, einem symbolhaften „Grab des Unbekannten Soldaten“ erbaut. Das Äußere des Burgtors sollte den Wettbewerbsbedingungen entsprechend nicht verändert werden. Es ist unklar, auf wessen Veranlassung diese (im Übrigen dann nicht eingehaltene) Auflage erfolgte; der entsprechende Akt des Bundesdenkmalamts ist unauffindbar.160 Der Respekt vor dem bestehenden Burgtor als Denkmal der Armee ging hier Hand in Hand mit der Absicht, die Ausgaben gering zu halten: Das Denkmal solle, so hieß es, dem „Schönheitssinn des Österreichers“ und zugleich den „wirtschaftlichen Verhältnissen“ angepasst werden.161 Mit Wondraceks Einführung einer großen Halle über der Durchfahrt und mit den beiden seitlichen Treppen, die zur Halle führen, waren jedoch Konsequenzen für den Außenbau unumgänglich (Abbildung 23).