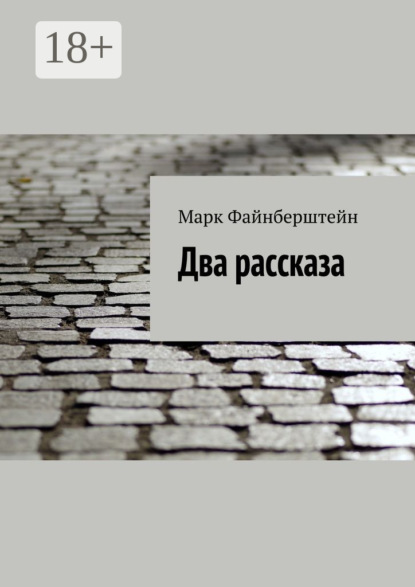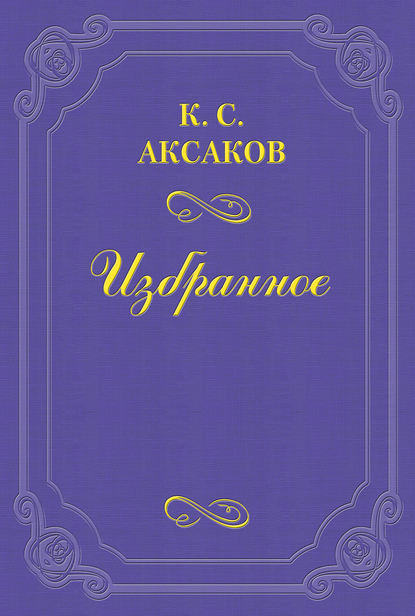- -
- 100%
- +
„Stolpere mir doch nicht immer vor der Nase herum!“, rief Paula Klette wütend. „ ... siebenundneunzig, achtundneunzig, neunundneunzig! Hundert! Einhunderteins! ...“
„Hat es dir gefallen – ich meine, wie ich gesungen habe? Wenn du willst, kann ich dir noch viele andere Lieder vorsingen.“
Paula stöhnte auf, denn René Kiekhahns hundertneunter Kopfball war der letzte gewesen, dann hatte der Ball den Erdboden berührt. Sie sagte bissig: „Auf Italienisch, was?“
„Wenn du willst, auch auf Italienisch. Da klingt es besonders schön.“
„Komm wieder, wenn du auf Deutsch rückwärts singen kannst“, sagte Carola Sanddorn, und sie und Paula gaben sich lachend einen Hüftstoß.
„Bitte“, sagte Niccolò, als Paula sich beruhigt hatte, „bitte, nimm doch mal deine Brille ab.“
„Warum denn das?“ Paulas Misstrauen war hellwach.
Niccolò wollte gerade erklären, wie einwandfrei Paula geradeaus sehen konnte, da sagte Ole: „Er will ja nur sehen, ob du immer noch so seehundsmäßig schielen kannst!“
„Du blöd blöder und noch blöderer Blödmann!“
Paula Klette holte weit aus. Doch sie traf nicht Ole, denn der war unschlagbar im Ausweichen und Weglaufen. Die Ohrfeige traf wieder Niccolò, der dazwischen gehen wollte. Er sank – wie in Zeitlupe – vor Paula auf die Knie.
Der Gong kündigte das Ende der Pause an. Ole war wie von Geisterhand verschwunden. Während die Pampers in den Hort stürmten, schlenderten die Älteren gemächlich ins Schulhaus zurück.
Paula Klette streckte Niccolò ihre Hand hin und zog ihn hoch. Er stand noch etwas wackelig; aber es war wunderbar, von Paulas Hand gehalten zu werden. Das also war eine Mädchenhand, sie fühlte sich gut an: klein, warm und zappelig.
„Du bist selbst schuld.“ Paula Klette versuchte ihre Hand zurückzuziehen, aber Niccolò drückte unwillkürlich fester zu. „Warum stehst du mir in der letzten Zeit auch immer fünfmal vor der Nase herum.“
Jetzt waren sie allein auf dem Schulhof. Die Sonnenstrahlen fielen wie bunte Bänder aus den Kastanien. Von der Straße her roch es nach Benzin. Die nur selten abreißende Autokette erzeugte ein dumpfes Rollen, das manchmal von ungeduldigem Hupen unterbrochen wurde.
„Entschuldigung“, sagte Paula Klette. „Diesmal wollte ich deinen neunmal bekloppten Freund Grabow treffen.“
Niccolò nickte nur. In diesem Augenblick hätte er Paula alles verziehen, selbst wenn sie eine gesuchte Serienmörderin gewesen wäre. Ihre Stimme war noch piepsiger als sonst, einmalig ulkig, fand er. Paula hätte ewig mit ihm reden können, er hätte ihr zugehört.
„Könntest du mir meine Hand wiedergeben“, sagte Paula und zog sie mit einem kräftigen Ruck zurück. „Weißt du, ich brauche sie nämlich noch.“
„Klar“, sagte Niccolò. „Du hast eine wunderbare Hand, Paula.“
Paula sah erstaunt auf ihre Hand, die rote und blaue Tintenflecke und unter manchem Fingernagel einen dunklen Rand hatte. „Meinst du?“ Sie ließ beide Hände in den Hosentaschen verschwinden.
„Soll ich dir was sagen, Paula?“
„Sag’s oder sag’s nicht. Ich bin nicht neugierig. Also, sag’s schon.“
Plötzlich verließ ihn der Mut. Es war gar nicht so einfach, einem Mädchen etwas wirklich Wichtiges zu sagen. Er zeigte zu den Sperlingen hinauf, die im Geäst der Kastanie saßen und drauflos zwitscherten. „Hör doch mal. Hör nur, was die Vögel singen.“
Paula drehte erst ihr linkes und dann ihr rechtes Ohr den Spatzen zu, lauschte und sagte dann: „Ich höre nur: Piep, piep, piep.“
„Ja“, sagte Niccolò eifrig. „Das ist genau das, was ich dir sagen will.“
„Piep, piep?“
„Ja, und weißt du, was das heißt?“
„Was weiß denn ich.“ Paula zupfte ärgerlich an ihren Haarbüscheln. „Bin ich vielleicht ein dreimal blöder Vogel?“
„Bist du nicht“, beruhigte Niccolò. Seine Stimme sollte fest klingen, war aber doch ziemlich bröcklig. „Also, ich sage es dir jetzt auf Italienisch. Ich sage dir: Io ti amo.“
„Verstehe nicht die Erbse. Sag’s mir doch lieber auf Deutsch rückwärts.“
„Na schön. Ich werde es versuchen, Paula: Chi – ebeil – hcid.“ „Was höre ich da?“
„Chi ebeil hcid!“
„Na, du kannst vielleicht Witze machen, Niccolò Rosenbusch.“
Sie standen sich gegenüber mit glühenden Köpfen. Niccolò hörte aus dem Grün die Vögel singen. Und irgendwo mussten auch die Glocken läuten. Er drückte fest die Daumen und wünschte, dass jetzt die Zeit stehen bleiben sollte. Alles sollte so bleiben, wie es war. Denn es war genau richtig so.
Aber Paula atmete hörbar aus, rückte energisch ihre Herzbrille zurecht, ihre Stimme klang fraulich tief, als sie sagte: „Nur keine Aufregung. Es hat längst zum Unterricht geklingelt. Wir müssen zurück in das siebenmal verdammte Klassenzimmer.“
Paula Klette lief mit kleinen festen Schritten zur Schultür. Niccolò folgte ihr taumelnd. Bismarck hielt die Tür auf und ließ sie passieren, als hätte er nur auf ihr Kommen gewartet. Das Männlein stand stramm, die Enden seines überdimensionalen Schnauzbartes stießen spitz nach oben. Als Paula vorbei war, flüsterte er Niccolò ins Ohr: „Haltung, Junge.“ Das klang, als wüsste er über alles Bescheid.
Niccolò nickte verwirrt, ihm war, als sei er ein Kreisel, der von Paula Klette in Bewegung gesetzt, sich nun endlos drehen musste.
9.
Niccolò hatte sich viel vorgenommen. Er wollte Paula in die neu eröffnete Eisdiele „Italienische Küsse“ zum Spaghettieisessen einladen. Das Ballköpfen und Elfmeterschießen würde er ihr beibringen, damit sie René Kiekhahn nicht mehr anstaunen musste. Am Sonntag dann wollte er mit ihr ins Kino gehen.
Aber am nächsten Tag fehlte Paula in der Schule. Donnerhall sagte, sie sei krank. Der Schulalltag ging weiter, als sei nichts geschehen, dabei war doch für Niccolò die halbe Welt zusammengebrochen. Er war doch Paula schon so nahe gewesen, und nun war sie wieder unerreichbar weit weg.
Nach dem Unterricht schlenderte Niccolò am Siedlungshaus der Klettes vorbei. Er hypnotisierte die Fenster, von denen die meisten durch Tannen verdeckt wurden, dass sich eines öffnen und Paula herausschauen sollte. Aber wieder versagte die Hypnose, und er nahm sich vor, das Buch „Die Kraft der Gedanken“ noch einmal gründlich zu lesen und sich im Internet über das Thema zu informieren.
Niccolò hatte versucht, Ole zu überreden, ihn zu Paulas Haus zu begleiten; aber der hatte abgewinkt und gerufen: „Keine Zeit heute.“ Die Spitznase des Freundes glühte, er war mit schlenkernden Armen davongerannt.
In den Pausen stand Ole unruhig bei den Halben Pfunden, wohl um auf einen Wink Godzillas sofort reagieren zu können. Im Unterricht schien er mit seinen Gedanken weit weg zu sein.
Auch Niccolò sinnierte vor sich hin. Seit Paula Klette sich nicht mehr sehen ließ, bereitete ihm alles keine rechte Freude mehr. Er dachte, dass es ihm vielleicht besser gehen würde, wenn er inzwischen mit Imke Liebstöckel ein paar Worte wechselte. Mal sehen, ob die Schöne für ihn zu sprechen war.
In der Mittagspause ging er zu ihr und sagte betont fröhlich und als würden sie sich schon lange kennen: „Grüß dich, Imke.“
Die Schöne hatte wie immer die Kopfhörer auf den Ohren und war gerade dabei, sich ihre langen Fingernägel schwarz zu lackieren. Sie pustete auf den frischen Lack, hielt ihre gespreizte Hand von sich weg und blickte kritisch auf ihr Werk.
„Was hörst du denn da so?“, fragte Niccolò, als die Schöne ihm endlich einen Blick schenkte.
„Hä?“ Sie rückte die Hörmuscheln etwas von ihren Ohren, dass Geräusche zu hören waren, als schepperten Eisenstücke gegeneinander.
„Was ist das denn für – Musik?“
„Nichts für Pampers, Halbe Pfunde und Hauspflaumen.“
„Aber sie hat doch einen Namen. Oder?“
„Heavy Metall ist wieder angesagt“, sagte Imke nun gönnerhaft. „Motörhead. AC/DC, et cetera pp.”
„Ah, so.“
Mit rauer Stimme sagte sie ohne Niccolò anzusehen: „Und?“
„Nichts“, sagte Niccolò und betrachtete bewundernd die in ein langes schwarzes Kleid gehüllte Schöne. Zu ihren dreizehn schwarzen Ringen war noch ein vierzehnter dazugekommen, der durch die Unterlippe gepierct war. Er hätte sich gern aus ihren dunkelblauen Haaren ein glitzerndes Sternchen herausgezupft. Imke erschien ihm wie aus einem Märchenbuch herausgetreten, eine Zauberin aus alter Zeit.
„Was nichts?“
Imke Liebstöckel streckte noch immer beide Hände von sich, sie lehnte sich zurück an die Hauswand und schloss die Augen. Die Schöne wandte ihr Gesicht der Sonne zu, die gerade zwischen zwei weißen Wolken auftauchte.
„Einfach nichts“, sagte Niccolò. „Ich wollte nur mal sehen, wie es dir so geht.“
Imke gähnte. Niccolò sah es kurz in ihrem Mund aufblitzen. Er fragte sich, ob das eine Zahnspange oder vielleicht gar eine Perle war.
„Geht so“, sagte Imke nach einer Weile.
„Mit geht’s auch so“, sagte Niccolò. Am liebsten hätte er ihr sein Herz ausgeschüttet: wie sehr ihm Paula Klette fehlte.
„Ich meine“, sagte Imke, die bei ihrem gemächlichen Sprechen manchmal lispelte, so dass Niccolò doch auf eine Zahnspange tippte, „beschissen geht’s.“
„Das meine ich doch auch. Beschissen. È uno schifo. Total beschissen. Proprio uno schifo.“
„Das klingt ja galaktisch. Einwandfrei galaktisch.“ Imke kippte ihren Kopf nach vorn, öffnete die Augen, schenkte Niccolò einen Blick, als wäre er eine Katze, die plötzlich gebellt hat, und kehrte in ihre Ausgangsposition zurück.
„Spanisch oder so?“
„Italienisch.“
„Tatsächlich galaktisch“, meinte Imke Liebstöckel. „Lass doch mal hören!“
„Was denn?“
„Na was man so lallt eben.“
„Und was lallt man so?“
Imke konnte über so viel Unwissen nur den Kopf schütteln. Sie sagte: „Na eben Scheiße.“
„Das heißt Cacca.“
„Tatsächlich Kacka?“
„Ja, cacca.“
„Und wie heißt: Fettauge?“
„Warte mal. Ja. Vielleicht: Occhio di grasso.“
„Bohrend. Genial bohrend sogar. Occhio di grasso. Und: Am Arsch?“
„Sul culo, natürlich.“
Imke hatte wieder die Augen geschlossen, doch ihr Kopf pendelte, als wollte sie etwas aus ihm heraus schütteln. Aber es gelang ihr wohl nicht, sie sagte: „Ich hasse das ganze total beschissene Leben. Kannst du mir das übersetzen?“
„Nein.“
„Willst du oder kannst du nicht?“
„Ich will nicht.“
„Und wenn ich dich bitte. Ich bitte dich, dass du mir diesen verdammten Satz übersetzt.“
Nur widerwillig gab Niccolò nach. Er sagte stockend: „Io odio questa schifosissima vita.“
Imke Liebstöckel stieß sich von der Hauswand ab, riss die Arme hoch und rief, dass Schüler und Lehrer erschrocken zu ihr sahen: „Io odio questa schifosissima vita!“
Ein Lehrer kam und wollte wissen, ob was nicht in Ordnung sei? Imke Liebstöckel drehte sich mit dem Gesicht zur Hausmauer, stützte sich mit den Händen ab und spreizte die Beine, als wäre sie von der Polizei gestellt worden und sollte nun nach Waffen abgetastet werden.
Der Lehrer schüttelte den Kopf und ging zur Tür zurück, von wo aus er den besten Überblick auf das Geschehen hatte.
Niccolò fragte vorsichtig: „Warum findest du alles schifoso?“
„Weil es schifoso ist“, sagte Imke, die sich zu ihm herumdrehte und nun wieder lässig an die Wand lehnte. „Es ist und bleibt: beschissen. Aber das verstehst du nicht.“
„Warum denn nicht?“
„Bist noch ein Küken.“
„Ich bin doch kein Küken mehr.“
„Ein halber Hahn eben“, sagte Imke Liebstöckel und lachte, dass Niccolò mitlachen musste.
Als Niccolò dann wieder im Klassenzimmer saß, fühlte er sich etwas besser. Zum Unterrichtende freute er sich auf den Nachhauseweg mit Ole, doch der rannte mit dem Klingelzeichen gleich davon. Imke Liebstöckel stieg in ein Auto, das mit quietschenden Reifen losfuhr.
Da entdeckte Niccolò an der Haltestelle Frau Mandelstern. Sie wartete mit anderen Fahrgästen auf die Straßenbahn in Richtung zur Großstadt.
10.
Niccolò lief auf die Lehrerin zu, als seien sie verabredet. Er rief ihr entgegen: „Guten Tag, Frau Mandelstern!“
„Guten Tag auch.“ Frau Mandelsterns Augen, die im Sonnenlicht wie dunkler Bernstein glänzten, blickten ihn überrascht an. „Wie war doch gleich dein Name?“
„Niccolò Rosenbusch.“
„Bist du nicht der Junge, der ...“
„Der bin ich“, rief Niccolò erfreut, dass die Lehrerin sich noch an ihn erinnern konnte.
Frau Mandelstern lachte und sagte: „Unqualifizierte Vorstellung von mir, was? Da lass ich doch all die schlauen Bücher dumm hinfallen. Ja, ich bin noch neu in der Schule. Da ist man noch etwas unsicher.“
Sie ließ das qualmende Zigarillo fallen, das sie eben erst angeraucht hatte und stellte ihre Schuhspitze darauf.
Niccolò nickte, obwohl er keinen Grund erkennen konnte, warum die Schöne unsicher sein müsste. Er fand, Señorita Popocatepetl war bestimmt noch beeindruckender als der feuerspeiende Vulkan, nach dem die Eierköppe sie benannt hatten. Er selbst fand den Spitznamen überhaupt nicht passend. Frau Mandelstern war zwar ein Naturereignis, aber doch eher mittelgroß und zierlich. Er sagte: „Von mir aus können Sie ruhig rauchen. Es stört mich kein bisschen. Obwohl ich Nichtraucher bin.“
„Eigentlich bin ich auch Nichtraucherin“, sagte Frau Mandelstern. „Wenn ich manchmal aus Versehen den Qualm einatme, muss ich husten.“
„Warum rauchen Sie dann?“
„Gute Frage“, meinte die junge Lehrerin. „Ich werde mir es auch bald wieder abgewöhnen.“
Die Straßenbahn fuhr fast lautlos vom Rathausplatz kommend in die Haltestelle ein. Niccolò und Frau Mandelstern stiegen erst dann zu, als die johlenden Jungen und Mädchen sich schon hineingedrängt und alle Sitzplätze belegt hatten. Die Lehrerin löste einen Fahrschein. Nach kurzem Zögern bat Niccolò sie, für ihn mitzubezahlen. Er hatte kein Geld bei sich und versprach, ihr gleich morgen die Schulden zurückzuzahlen. Sie standen eng aneinander gedrückt und mussten sich in dem Lärm fast schreiend verständigen.
„Fährst du jeden Tag mit der Straßenbahn?“
„Nein. Wir wohnen doch in der Siedlung.“
„Warum fährst du heute mit der Straßenbahn?“
„Nur mal so!“
„Wenn ich Zeit habe, fahre ich auch gern nur mal so mit dem Zug! Irgendwo steige ich dann aus!“
„Und was passiert dann?“
„Dann sehe ich mir an, was ich bisher noch nicht gesehen habe! Andere Menschen! Alte und neue Häuser! Vielleicht ein Schloss! Oder eine Katze, die in der Sonne sitzt und sich die Pfoten leckt!“
„Das ist gut“, sagte Niccolò. „Da müssen wir einmal zusammen losfahren.“
Die Schüler waren bald wieder ausgestiegen und der Wagen fast leer. Niccolò und Frau Mandelstern setzten sich einander gegenüber und sahen aus dem Fenster. Zwischen Scheunitz und der Großstadt zündelte auf den Feldern das junge Grün. Am Rand der kleinen Ortschaften, wo sich vor Jahren noch Wiesen und Kleingärten ausgebreitet hatten, standen nun Baumärkte und Autohäuser. Auf der Fernverkehrsstraße bewegten sich die Autoschlangen im Schritttempo. Vom Himmel glitt in flachem Winkel ein Flugzeug zum Hafen herab, als sei es aus weißem Glanzpapier.
Niccolò fand es traumhaft, der dritten Schönen gegenüber zu sitzen und mit ihr zu schweigen. Er sah auf einen bunten Fesselballon, der am Himmel zu stehen schien und doch unaufhaltsam seine Bahn zog. Ihm folgte als schillernde Luftschlange ein Band, das für eine Versicherung warb. Eine Fliege klickte in unrhythmischen Abständen gegen eine Fensterscheibe. Niccolò dachte, dass das Leben etwas ganz Wunderbares und im Augenblick alles genau richtig war.
Vor dem wuchtigen Gebäude des Hauptbahnhofs im Zentrum von L. wachte er auf. Frau Mandelstern war nicht mehr im Wagen, ein Zettel klebte neben ihm an der Scheibe: Schalom, Niccolò.
Niccolò stieg eilig aus, um ihn herum tobte die Stadt. Wie auch, wenn die Mutter ihn alle paar Wochen zum Einkaufsbummel mitnahm, kam er sich in dem Gedränge der Menschen überflüssig vor. Überall wurde gebaut, das Gesicht der Stadt veränderte sich ständig. Die Reklametafeln wechselten schnell ihre Bilder, die Schaufenster waren voller Dinge, und in den Kaufhäusern fühlte er sich eingesperrt. Er bekam Kopfschmerzen und wünschte sich zurück nach Scheunitz, wo er sich auskannte.
Aber da er nun schon einmal hier war, konnte er auch Balanca besuchen. Niccolò lief durch die Innenstadt und sah sich nach einer roten Kehrwalze um. Mit ihr hielt sein Großvater die Gassen und Straßen um den berühmten „Auerbachs Keller“ sauber.
Unter den Arkaden des „Alten Rathauses“ entdeckte Niccolò den Großvater in orangefarbenen Latzhosen, die geliebte schwarze Strickmütze auf dem Kopf. Balanca saß er auf einer Kehrwalze und steuerte sie durch eine sich öffnende Gasse von Fußgängern.
„Hallo!“, rief Niccolò. „Balanca!“
Der Großvater sah sich um, hielt das Fahrzeug an, sprang herunter, kam auf Niccolò zugerannt und fasste ihn derb an den Schultern.
„Niccolò“, sagte er, seine Stimme klang brüchig vor Schreck. „Nun rede doch, Junge.“
„Es ist nichts passiert“, sagte Niccolò schnell. Die beiden umarmten sich kurz und fest. Balanca legte Niccolò einen Arm um die Schultern, sie gingen zurück zur Kehrwalze. Der Großvater stellte den Motor ab, sie setzten sich auf das Fahrzeug und Balanca packte aus einem Beutel Thermoskanne und Brotbüchse aus. Er schenkte Kaffee in den Becher, teilte ein Wurstbrot, gab Niccolò eine Hälfte und biss selbst herzhaft in die andere.
Sie aßen und tranken, die vorüberhastenden Menschen streiften sie mit einem Blick, über manches Gesicht huschte ein Lächeln.
Von der Thomaskirche her hallten Glockentöne, als schritte da ein Riese in klingenden Stiefeln gemächlich durch die Stadt.
Niccolò kaute und sagte: „Ich wollte nur mal nach dir sehen.“
„Aha“, sagte Balanca. „Verstehe.“
Ein Polizeiautor fuhr mit Blaulicht und Sirene quer über den Marktplatz, dass die Tauben aufstoben. Die Glockenmänner auf dem „Krochhochhaus“ schlugen ihre Hämmer zur vollen Stunde gegen das Eisen. Unter den Arkaden, ein paar Meter von der Kehrwalze entfernt, spielte ein langbärtiger Alter in einem abgetragenen Uniformmantel auf dem Akkordeon und sang mit brüchigem Bass: „Ka-lin-ka, Ka-lin-ka ma-ja, fsa-du ja-go-da ma-lin-ka, ma-linka, ma-ja ...!“
„Eigentlich bin ich nicht nur so gekommen“, gestand Niccolò ein. „Eigentlich will ich dich was fragen.“
Balanca drängt Niccolò nicht. Er ließ sich selbst und allen anderen Zeit. Wenn ihm jemand was sagen wollte, dann würde er schon reden. Zuhören konnte er fast immer.
Niccolò schluckte den letzten Bissen hinunter, trank einen Schluck Kaffee nach, schüttelte sich gegen den bitteren Geschmack und sagte schließlich: „Was ist eigentlich Liebe, Balanca?“
Immerhin war sein Großvater dreimal verheiratet gewesen und sprach nur gut von „seinen Frauen“. Seit einem Jahr lebte er wieder in einer „stabilen Beziehung“. Die Frau war zwanzig Jahre jünger als er, sie war eine „Westliche“, die in Frankfurt am Main als Ingenieurin arbeitete. Sie hieß Dr. Wanda Mose-Kaatz, aber Balanca nannte sie „Lady Summertime“, und sie ihn „Mr. Weekend“. Wanda besuchte Balanca nur an den Wochenenden und in den Ferien, die beiden lachten viel zusammen und hatten sich immer etwas zu erzählen. Niccolò fand Wanda etwas zu rundlich, „handlich“ wie Balanca meinte, ihre Augen standen über der kleinen Nase weit auseinander, sie schniefte ein wenig beim Atmen und trank gern Bier. Je besser Niccolò sie kennen lernte, um so mehr mochte er sie. Sie war klug, ohne besserwisserisch zu sein. Vor allem aber strahlte sie mütterliche Geborgenheit aus, die Niccolò manchmal bei Manuela vermisste. Da musste er aufpassen, dass er nicht in den ständig schwelenden Konflikt zwischen seiner Mutter und Balancas Freundin geriet. Manuela meinte unverblümt, dass bei zwei Frauen in einem Haus in jedem Fall eine zu viel sei. In ihren eigenen vier Wänden bestimme immer noch sie, woher der Wind weht. Dazu brauche es keine „Frau Doktor“ und eine „Westliche“ schon gar nicht.
Balanca zeigte sich von Niccolòs Frage nicht überrascht. Und doch schob er seine Pudelmütze in die Stirn und wieder zurück, was anzeigte, dass die Antwort ihm nicht leicht fiel. Schließlich sagte er: „Das ist die Frage aller Fragen, Niccolò. Fragst du einen Menschen, kriegst du eine Antwort. Fragst du zehn, bekommst du zehn Antworten. Und wenn du tausend fragst, erfährst du tausend verschiedene Antworten.“
„Ich frage aber dich, Großvater.“
„Also, wenn du mich fragst“, begann Balanca umständlich und endete knapp: „Liebe ist das Schönste, was uns Menschen passieren kann.“
„Bist du dir da sicher?“
„Da bin ich mir ganz sicher.“
„Aber was ist sie denn – die Liebe? Ist sie wirklich eine – Krankheit?“
Balanca lachte, wieder schob er seine Mütze hin und her, bevor er sich zu einer Antwort entschließen konnte: „Als Zirkusmensch würde ich sagen: Liebe ist ein gewaltiger Hokuspokus, ein Zauber der Götter. Verstehst du, was ich meine?“ Er deutete zum Himmel und sagte: „Da hat doch der alte Herr da oben ein Verwirrspiel erfunden. Und wir Menschlein dürfen es aufführen, damit der liebe Gott auch was zu lachen hat.“
„So ist das also“, sagte Niccolò unzufrieden mit der Antwort. „Und das soll ich glauben?“
„Nun“, sagte Balanca und wiegte bedenklich den Kopf, „es ist wohl nicht ganz so. Aber wie es auch immer ist mit der Liebe, Kollege, glaub mir, ohne sie wäre das Leben wohl eine verdammt schlechte Erfindung.“
„Ich weiß ja nicht“, sagte Niccolò enttäuscht. Er hatte von seinem Großvater, der auf fast alle Fragen eine Antwort wusste, mehr erwartet.
Balanca nickte, und wie immer, wenn er eine seiner Zirkusgeschichten zum Besten gab, verfiel er in den Tonfall eines Märchenerzählers: „Ich will dir die Geschichte von dem Ballettmädchen Lisa Kowalke und dem Dompteur Fritz Müller erzählen.“
Niccolò zog die Knie zur Brust und legte seinen Kopf seitlich darauf. Um ihn herum schwatzte die Stadt, aus dem gleichmäßig tuckernden Motor der Kehrwalze kroch Wärme in ihn, und es roch gut nach Maschinenöl.
„Das Ballettmädchen Lisa Kowalke tanzte beim Zirkus Ballo. Mit zwölf anderen Mädchen führte es in den Umbaupausen den berühmten Cancan und andere Tänze auf. Die Tänzerinnen waren für das Sommerprogramm engagiert wurden, weil der niederländische Clown Ätsch wegen Krankheit die Tournee abgesagt hatte.
Als Höhepunkt des Programms war nach der großen Pause die Dressur eines Indischen Elefanten zu sehen. Der Dompteur, Fritz Müller, ein ehemaliger Bäckerlehrling, der vor seinem jähzornigen Vater zum Zirkus geflüchtet war, hatte sich diese Darbietung in jahrelanger harter Arbeit aufgebaut. Er nannte sich nach dem elefantenköpfigen indischen Gott Ganescha und sah in seinem Kostüm wie ein echter Maharadscha aus.
Aber Lisa Kowalke, die davon träumte, einmal im Operettenpalast zu singen und zu tanzen, war auch nicht ohne. Wenn sie geschminkt war, das Scheinwerferlicht über sie glitt und sie sich im Schwanenkostüm anmutig bewegte, sah sie aus wie eine Elfe.
Immer wieder zog es Lisa in die Nähe von Ganeschas Elefant Assan. Der Koloss ließ es sich gern gefallen, dass die kleine Frau ihn streichelte und mit Leckereien verwöhnte. Bald tönten morgens und abends seine Trompetenrufe durch das Wagenlager. Und Assan gab erst Ruhe, wenn Lisa kam und seinen Rüssel tätschelte.
Nun, es wunderte keinen, dass Lisa und Ganescha sich ineinander verliebten. Es schien einfach alles zu passen zwischen den beiden. Zwischen den dreien ist wohl richtiger. Alle Artisten wünschten ihnen alles Glück der Welt.“
Balanca sah Niccolò prüfend an, dann lächelte er, umschloss einen Moment lang mit seiner Pranke die Hand Niccolòs und sprach gelassen weiter.
„Ganeschas Attraktion war also Assan, der Sprechende Elefant. Angeblich sollte er das letzte Exemplar der legendären Weißen Elefanten sein. Was aber kaum einer wusste: der tonnenschwere Dickhäuter wurde von Ganescha bei Nacht mit einer speziell dafür angefertigten Farbe weiß angestrichen.
Nun, Ganescha nahm Lisa als Assistentin in seine Nummer auf. Das Publikum fand sie reizend, vor allem aber wohl Assan, der sich ebenso unsterblich in die kleine Lisa verliebt hatte wie sein Herr. Der sonst sprichwörtlich dickköpfige Elefant, wurde in Lisas Nähe zahm und folgsam wie ein Schoßhündchen. Es war einfach wunderbar anzusehen, wie der verliebte Tierriese mit seinem mächtigen Rüssel zärtlich das Gesicht des Mädchens abtaste. Wenn sie ihn dann auf das haarige Rüssellende küsste, öffnete Assan sein Maul, ließ ihren Kopf darin verschwinden und trug sie, sozusagen auf Zehenspitzen, durch die Manege. Unter dem rauschenden Beifall des Publikums setzte er sie dann wieder ab. Und Lisa verwöhnte ihren verliebten Dickhäuter mit Zuckerstücken und Pralinen.“