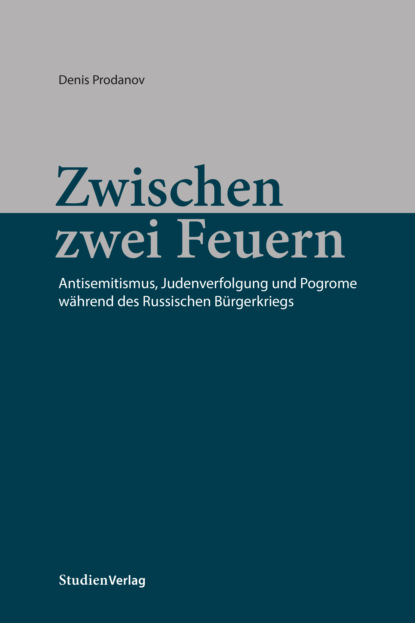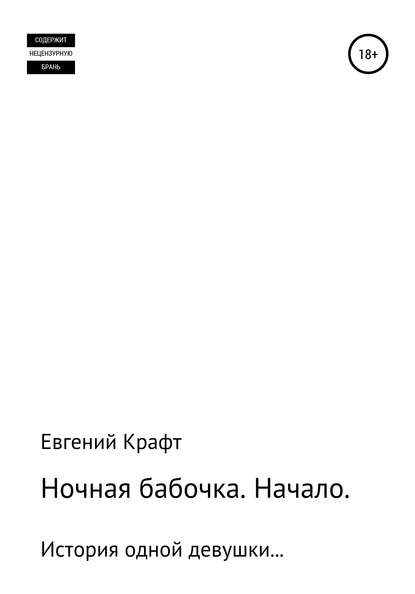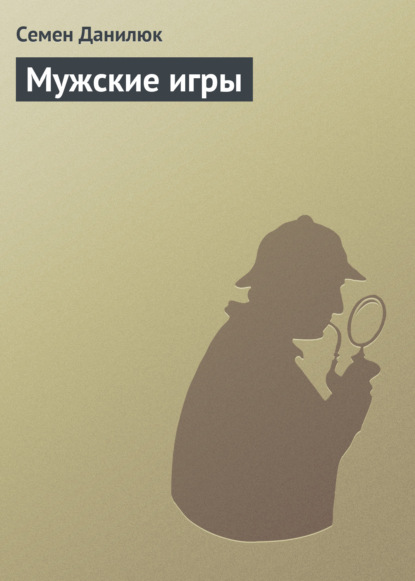- -
- 100%
- +
Trotzdem ist der Hauptgrund für die erfolgreiche Etablierung von Antisemitismus in Russland anderswo zu verorten. Seine Wurzeln reichen weit zurück in die Monarchie und in den rechten Flügel der Russisch-Orthodoxen Kirche, die aktiv dem Judenhass und dessen aktiver Verbreitung verschrieben war. Insofern unterschied sich die Russisch-Orthodoxe Kirche kaum von der Katholischen Kirche und ihrer jahrhundertealten Dichotomisierung von Christen und Juden, der Aufhetzung von Christen/Christinnen gegen Juden/Jüdinnen und daraus resultierenden Kreuzzügen, mittelalterlichen Pogromen, Zwangskonvertierung zum Christentum und Verstoßung.8
Hier sei angemerkt, dass außer orthodoxem Christentum und Katholizismus auch der frühe Protestantismus von Antisemitismus durchsetzt war. Ein berühmtes Beispiel findet sich in Martin Luthers Traktat „Über die Juden und ihre Lügen“ aus dem Jahr 1543. Er hielt es für ebenso aussichtslos, Juden zu bekehren, wie zu versuchen, den Teufel zu bekehren. Dieses Traktat ist durchzogen von blutrünstigen Forderungen nach der Verfolgung von Juden und Jüdinnen sowie dem Niederbrennen von Synagogen und Schulen, dem Abriss von Häusern, der Konfiszierung heiliger Schriften wie der Tora und dem Verbot von Predigten durch Rabbis bei Todesstrafe sowie dem Verbot des Umherziehens von Juden und Jüdinnen auf Landstraßen.9
Der Autor Felix Rachlin schrieb hinsichtlich der den Juden auferlegten Rolle des Krämers und Wucherers über den Unmut und sogar Hass, den diese Rollen in der Bevölkerung hervorriefen. Laut seinen Ansichten stammte diese Zuschreibung, die den traditionellen religiösen Judenhass anheizte, vom evangelikalen Gleichnis der Kreuzigung Christi. Rachlin schrieb:
„Die Tatsache ignorierend, dass Christus selber Jude war und dass das Evangelium von Juden geschrieben worden war, haben Generationen von Christen jahrhundertelang Hass und Verachtung für ‚das Volk Judas‘, ‚Heuchler‘, ‚Selbstsüchtige‘, ‚Verräter Christi‘ genährt. Heutzutage hat sich zu all diesen Bezeichnungen der Gedanke an Juden als ‚feine Pinkel‘, ‚Intellektuelle‘, die nichts dagegen haben, ‚unseren russischen Iwan‘ an der Nase herumzuführen, hinzugesellt.“10
Tief verwurzelt und genährt durch Mythen und Legenden, Zuschreibungen an „das Fremde“, „das Andere“, waren Antisemitismus und Judenhass in Russland also seit dem Mittelalter sowie während der jahrhundertelangen Herrschaft der Zarenfamilien. Und auch das 20. Jahrhundert sollte keine Veränderung der Lage bringen.
Die Schwarzen Hundertschaften
Russische Antisemiten stellten Russen und Russinnen Jahr für Jahr als unschuldige Opfer dar, während Juden und Jüdinnen im Gegensatz dazu als angebliche „Ausbeuter“ diskreditiert wurden. Dies widersprach komplett der Wahrheit. Russen und Russinnen machten die absolute Mehrheit im Land aus, Juden und Jüdinnen aber hatten unter jahrhundertelangen Schikanen durch die zaristische Herrschaft zu leiden gehabt, sei es durch Raub, Gewalt oder dreifache Unterdrückung in Hinblick auf Klasse, politische und ethnische Identität.
Besonders zu leiden hatten sie unter der Entwicklung einer Bewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der Kreuzung von reaktionärem Russisch-Orthodoxem Christentum und seinem extremen Antisemitismus, von ultrarechtem Nationalismus und von Monarchismus entstand: die Bewegung der Schwarzen Hundertschaften (tschernosotenzy).11 Die Schwarzen Hundertschaften stellten bereits vor der Entstehung des Faschismus eine russische Version von Protofaschismus dar. Es handelte sich um eine organisierte Plattform extremer rechtsgerichteter Parteien, die sich zu imperialistischem Chauvinismus, Slawophilie, blinder Unterstützung der Monarchie und militantem Antisemitismus bekannten. Besonders mächtig waren sie zwischen 1905 und 1917.
Zuerst nannten sich die Anhänger dieser extrem rechtsgerichteten Ideologie „Patrioten“, „wahre Russen“ und „Monarchisten“. Doch bald gab ihr Wladimir Gringmut, einer der wichtigsten Theoretiker der Bewegung und Gründer der ersten rechten Partei namens Russische Monarchistische Partei, einen neuen Namen. Er taufte die Bewegung Schwarze Hundertschaften, eine Analogie zu Kusma Minins „Schwarzen Hundert“ aus Nischni Nowgorod. Minin war einer der Organisatoren eines Milizheeres in den Jahren 1611–1612 gegen die polnische Invasion gewesen.12
Angesichts des wohlklingenden Namens und der attraktiven historischen Parallele zum Kampf um Freiheit hielt sich die Bezeichnung. Am 3. Juni 1906 publizierte Gringmut den Artikel „Das Handbuch des Monarchisten der Schwarzen Hundertschaften“, dem er eine Liste „innerer Feinde Russlands“ beilegte. Der Ideologe russischer Faschisten teilte diese Feinde in sechs Kategorien: 1) Anhänger der Verfassung; 2) Demokraten; 3) Sozialisten; 4) Revolutionäre; 5) Anarchisten; 6) Juden.13
Gringmut wurde wegen Verhetzung der Prozess gemacht. Dennoch gewann die Bewegung der Schwarzen Hundertschaften nach den revolutionären Unruhen 1905 und der darauffolgenden politischen Reaktion rasch an Schwung. Zu ihren Gunsten wirkte die Unterstützung durch den Zaren und durch die reaktionären Kreise der Orthodoxen Kirche.
Ein bedeutsamer Teil dieser reaktionären kirchlichen Kreise bestand nicht nur aus Mitgliedern, sondern auch aus Anführern der Schwarzen Hundertschaften und ihnen zugehöriger Organisationen wie dem Bund des Russischen Volkes, dem Bund des Erzengels Michael, der Gesellschaft des Aktiven Kampfes gegen die Revolution und dem Bund der Russen.14 Der zukünftige stalinistische Patriarch Alexius I. saß zum Beispiel dem Bund des Russischen Volkes in Tula vor. Der spätere Patriarch Sergius I. segnete die Banner des Bundes des Russischen Volkes.15
Die Propaganda der Schwarzen Hundertschaften wurde in den Zeitungen „Russkoje Snamja“, „Semschtschina“, „Potschaewskij Listok“, „Kolokol“, „Grosa“, „Wetsche“, „Moskowskie wedomosti“ und in vielen weiteren verbreitet. Sogar Massenblätter wie „Kiewljanin“, „Graschdanin“ und „Swet“ verboten den Druck der Propaganda der Schwarzen Hundertschaften nicht.
Die Schwarzen Hundertschaften stellten mit ihrem reaktionären Zarismus, ihren Ochranka-Agenten und Gefängnissen als wahrer Cerberus den Gegenpol zum progressiven und revolutionären politischen Spektrum dar. Sie hassten alles Demokratische wie die Pest und organisierten die Ermordungen etlicher liberaler politischer Schlüsselfiguren.
Die größten Kritiker der Schwarzen Hundertschaften waren ihre politischen Gegner: die Anarchisten und Sozialdemokraten. Zur Unterdrückung der Anhänger und Anhängerinnen der revolutionären Bewegung 1905–1907 schrieb der Anarchist P. A. Kropotkin in einem Brief an M. I. Goldsmith:
„Die Lage ist wirklich verzweifelt. Die Schwarzen Hundertschaften werden zweimal pro Woche im Peterhof-Palast empfangen, ihnen wird volle Freiheit zum Töten auf der Straße gegeben, die sie nutzen. Natürlich greifen die Leute in einer solchen Situation nach allem. – Und da sie kein Kapital haben, fassen sie das Kapital, wo auch immer sie können … Das ist eine Carte blanche für alle Gauner. Und sie nutzen sie! Im Taganskaja-Gefängnis hängen sie jeden Tag Menschen, vor den Insassen … Der Verfall ist absolut.“16
Auch der russische Philosoph N. A. Berdjanew schrieb 1909 in einem „Offenen Brief an Erzbischof Antonij“ über den Bund des Russischen Volkes, eine Massenorganisation monarchistischer Schwarzer Hundertschaften, die nicht nur gegen die Revolution, sondern gegen die grundlegende Idee demokratischen Parlamentarismus vorgehen wollte:
„Der ‚Bund des Russischen Volkes‘ ist ganz Boshaftigkeit, ganz Hass, seine Taten erschreckend und verführerisch, er schürt Bruderzwist in der russischen Bevölkerung und Gesellschaft, er erschwert umso mehr die religiöse Wiederauferstehung unseres Mutterlandes. Und ist es möglich, die verführerische Rechtfertigung der Hierarchen der Kirche dieser bösartigen, brudermörderischen, unchristlichen ‚Politik‘ zu ertragen?“17
Exkurs: Der Beilis-Fall
Politische Reaktion, Schikanen und Diskriminierung, Agitation der Schwarzen Hundertschaften, Verleumdung in der Presse und Pogrome stellten nur einen Teil der Irrungen und Wirrungen dar, denen die jüdische Bevölkerung des Russischen Reichs ausgesetzt war. Dazu gehörten zahllose Neuauflagen der gefälschten „Protokolle der Weisen von Zion“ mit ihrer Theorie der „jüdisch-freimaurerischen Verschwörung“, auf deren Publikation bloß Straflosigkeit folgte. Ein weiterer Rückschlag für die jüdische Gemeinde war der berühmte Beilis-Prozess in Kiew 1913, im Zuge dessen Menachem Mendel Beilis des Ritualmords am zwölf- oder dreizehnjährigen Burschen Andrej Juschtschinksi angeklagt wurde.18
Der Prozess wurde von massiver antisemitischer Hysterie und verunglimpfender Verleumdung begleitet. Der Beilis-Prozess gestaltete sich von Anfang an widerrechtlich und widersprach komplett dem Erlass von Alexander I. vom 6. März 1817. Dieser hatte ein für alle Mal den Behörden verboten, Mordermittlungen mit religiöser Bedeutung aufzuladen. Trotzdem wurde der Beilis-Fall zum wichtigsten Prozess des Reichs. Er wurde zu einer klaren Demonstration dafür, wie tief Antisemitismus die Gesellschaft durchdrungen hatte, darunter auch das Innenministerium, das Justizministerium, das Gerichtswesen, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die Gerichtsmedizin. Antisemitismus korrumpierte diese Ebenen derartig, dass sie trotz offenkundiger Tatsachen und aufgrund des Meineids und Betrugs durch die Staatsanwaltschaft den Schwarzhundertschaften in ihrer Theorie des „Ritualmords“ durch die Zaddiken zustimmten.
Letztendlich fruchtete erst ein langer und hartnäckiger Kampf vor Gericht, um den Freispruch und die Freilassung von Beilis, einem unschuldigen Vater mehrerer Kinder, zu erwirken. Dieser Streit vor Gericht sowie öffentliche Proteste sowohl in Russland als auch auf internationaler Ebene verwandelten den Beilis-Fall von der Beschuldigung eines jüdischen Angestellten in einer Ziegelfabrik in einen globalen Kampf für Gerechtigkeit und gegen Antisemiten.19
Der Erste Weltkrieg und seine Auswirkungen
Die nächste Herausforderung war der Erste Weltkrieg, an dem Hunderttausende Juden teilnahmen, die aber dennoch unerwünschte Bürger zweiter Klasse für das Regime blieben. Hartnäckig wurden ihnen kontinuierlich Heimat und grundlegende Bürgerrechte verwehrt, egal, wie tapfer sie für Russland kämpften. Der Journalist und Historiker N. P. Poletika betonte zu Recht, dass die Lage jüdischer Gemeinden im Königreich Polen, Litauen und anderen Gebieten der baltischen Staaten sowie im Grenzgebiet der Ukraine noch schwieriger war als für die restliche Bevölkerung der westlichen Gebiete des Russischen Reichs.
Neben den Schrecken des Kriegs und den Gräueltaten, die von den deutschen Truppen verübt wurden, kamen hier das Leid, die Verfolgung und die Gräueltaten des Militärs und der Zivilbehörden der russischen Monarchie hinzu. Poletika schrieb in seinen Erinnerungen: „In den ersten zwei Jahren des Kriegs waren die Zustände für die Juden besonders schmerzhaft und quälend. Ich wusste von jüdischen Flüchtlingen aus den Frontgebieten und von den Juden, mit denen ich befreundet war, von der Lage der Juden und ihren Ansichten zum Krieg.“20
Der Maler Marc Chagall, der von Witebsk nach Petrograd gezogen war, erinnerte sich daran, wie sich zu Kriegsausbruch im Zentrum der Stadt eine Bande von Raufbolden an Schießereien und Pogromen auf offener Straße beteiligte. Menschen wurden von den Brücken in den Fluss gestoßen. Chagall bezahlte beinahe selbst mit dem Leben, als er nachts mehreren bis an die Zähne bewaffneten Schlägern über den Weg lief, die wissen wollten, ob er „ein Judenschwein“ war oder nicht. Da sie ihm nach dem Leben trachteten, war Chagall gezwungen, zu lügen.21 Er schrieb weiter:
„Jeder weitere Rückschlag gab den Kommandanten der Armee, dem Großfürsten Nikolaj Nikolajewitsch, einen Grund für weitere Angriffe auf Juden. ‚In 24 Stunden vertreiben! Oder sie erschießen! Oder besser beides!‘ Die Deutschen rückten näher, und die jüdische Bevölkerung verließ das Gebiet, gab Städte und Schtetl auf.“22
Das Spektrum oppressiver Maßnahmen gegen Juden und Jüdinnen durch russische Herrschaft beinhaltete Vertreibungen und Zwangsumsiedelungen mit nur kurzer Ankündigung, verleumderische Bezichtigungen der „Spionage“ von Juden und deutschen Siedlern und Siedlerinnen, ein Verbot für Juden und Jüdinnen, ranghohe Stellungen innezuhaben, und Geiselnahmen von Juden und Jüdinnen unter Androhung von Hinrichtung im Falle von „Verrat“. An der Tagesordnung standen auch erniedrigende Hausdurchsuchungen und Durchsuchungen von Taubenställen und Untergrund-Telegrafen zum angeblichen Informationsaustausch mit dem Feind bzw. Durchsuchungen nach Signalen an ihn. Jüdischen Bürgern und Bürgerinnen war es verboten, als Ärzte/Ärztinnen und Pfleger/Pflegerinnen in Krankenhäusern und in Sanitätszügen oder anderen Berufen zu arbeiten, um ihre angebliche „Propaganda“ zu bekämpfen. Ranghohes medizinisches Personal wurde dafür eingesetzt, die wenigen Juden und Jüdinnen, die noch in solchen Berufen arbeiteten, zu überwachen.
Darüber hinaus wurde die jüdische Bevölkerung – Männer, Frauen, Alte und Kinder – in die Richtung des Feindes vertrieben, in den Westen, trotz der militärischen Gefahr.23 Die Invasion der russischen Armee Galiziens und anderer Gebiete Osteuropas ging einher mit Pogromen und wiederholten Erschießungen von Juden und Jüdinnen.24
Jüdische Wohlhabende und Rabbis wurden häufig als Geiseln in Konvois an die russischen Grenzen geschickt. Die Bevölkerung wurde gewarnt, dass für jeden russischen Soldaten, der von den Deutschen oder Österreichern getötet wurde, zwei jüdische Geiseln hingerichtet würden. Juden und Jüdinnen wurden der „Untreue“ und „Verleumdung“ gegenüber der ortsansässigen Bevölkerung zugunsten des Feindes beschuldigt. Ihnen wurde der Aufenthalt überall südlich von Jaroslawl verboten. Mutmaßliche „Spione“ wurden gehängt.
Diese Maßnahmen gingen Hand in Hand mit Geldstrafen von bis zu 4.000 Rubel und Haftstrafen von bis zu drei Monaten für den Umzug von einem Landkreis in den anderen. Jüdische Flüchtlinge, die versuchten, aus den westlichen Gebieten weiter ins Landesinnere zu gelangen, wurden gefangen und zurückgedrängt. Die willkürlichen Anschuldigungen des „Verrats“, bösartiger Provokation, Denunziationen und des Meineids führten zu Hinrichtungen jüdischer Geiseln, obwohl gerichtliche Ermittlungen die absolute Haltlosigkeit der Anschuldigen erwiesen.25 Die Listen der jüdischen Einheiten des Russischen Ordens des heiligen Georg wurden aus den Annalen entfernt, vernichtet und nie wieder abgedruckt.26 Auf diese Weise erweckte das zaristische Regime in der Öffentlichkeit den Eindruck, dass es keine Helden unter den Juden gäbe.
Februarrevolution und Oktoberputsch
Im Zuge der Februarrevolution 1917 änderte sich dank der Übergangsregierung die Lage für wenige Monate, bevor das Land im Zuge des Oktoberputsches im Chaos versank. Die jüdische Bevölkerung erhielt durch die demokratisch gesinnten Politiker und Politikerinnen, die nun regierten, politische Freiheiten. Der Ansiedlungsrayon, der 1915 nicht aufrechtzuerhalten war, da die Region zur Kriegsfront geworden war, wurde offiziell aufgelöst. Die Schwarzen Hundertschaften wurden verboten und ein Teil von ihnen gezwungen, in den Untergrund zu gehen.
Juden und Jüdinnen traten zum ersten Mal politisch auf und begannen, aktive Rollen sowohl im vormaligen Ansiedlungsrayon als auch außerhalb davon zu übernehmen. Im Frühling 1917 wurden in beiden Dumas der größten Städte Petrograd und Moskau Wahlen abgehalten. In Moskau wurde der Jude Osip Minor mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden der Duma gewählt. Der Politiker W. M. Tschernow schrieb in seinen Erinnerungen: „Die Antisemiten lehnten natürlich ab, dass die Duma, ‚das Herz Russlands‘, von einem – oh Horror! – Juden geführt wird … Aber wen interessierte der machtlose Zorn der Antisemiten?“27
Die Kommunalwahlen im Land ließen die Gesinnung der Antisemiten und Antisemitinnen ebenfalls außer Acht. G. I. Schreider, jüdischer sozialistischer Revolutionär und bekannter Experte in städtisch-ländlichen Angelegenheiten, wurde zum Vorsitzenden der Duma der Hauptstadt gewählt. S. D. Schupak, Jude und Mitglied des Sozialistischen Bundes, wurde Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Petrograd. In Minsk wurde ein Mitglied des Zentralkomitees des Bundes, A. I. Weinstein, zur Vorsitzenden der Duma gewählt. In Jekaterinoslawl wurde Ilja Polonski zum Stadtvorsteher, in Kiew A. M. Ginsburg-Naumov zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. D. K. Tschertkow wurde zum Vorsitzenden der Stadtduma von Saratow, ganz zu schweigen von der Arbeit, die von Juden und Jüdinnen der Menschewiken und sozialistischen Revolutionäre der Räte der Arbeiter- und Soldatenkammern verrichtet wurde.28 Die Übergangsregierung ermöglichte Personen jüdischer Herkunft also aktive politische Teilhabe.
Anders verhielten sich die Dinge auf gesellschaftlicher Ebene. Trotz der Revolution und der erklärten Gleichheit hielt Judenfeindlichkeit an, als ob keine Veränderungen stattgefunden hätten. Olga Adamowa-Sliosberg war eine von vielen, die in jener Zeit häufig mit antisemitischen Bemerkungen konfrontiert wurden, und hielt dies in ihrer Autobiografie „Der Weg“ fest. 1917 war sie fünfzehn Jahre alt und lebte mit ihrer Mutter in Kislowodsk. Eines Tages wurde sie im Park von einer Frau angesprochen. Die Frau wollte ihr zwanzig Tickets für die öffentlichen Bäder verkaufen. Solche Tickets waren immer Mangelware, also kaufte sie Adamowa-Sliosberg freudig. Adamowa-Sliosberg beschrieb den Kauf:
„Heute reise ich ab, erzählte sie mir, schade, dass ich die Tickets nicht verwendet habe. Ich habe keine Zeit, ich laufe seit zwei Stunden durch den Park, auf der Suche nach einem russischen Gesicht – ich treffe nur auf Saujuden, ganz Kislowodsk ist voll mit ihnen! Ich gab ihr das Geld und verabschiedete mich dann mit den Worten: Ich muss Sie enttäuschen. Ich habe die Tickets, und ich bin Jüdin. Die Gesprächspartnerin schnaubte und lief weg.“29
Dieses Beispiel ist absolut typisch für jene Zeit und auch für die folgenden Jahre. Um solche Situationen zu vermeiden, versuchte Olga Adamowa-Sliosberg üblicherweise, auf welche Art auch immer ihre Identität von vornherein klarzustellen, was nur den Mut des fünfzehnjährigen Mädchens betonte.
Das änderte jedoch nicht das zugrunde liegende Problem. Im Juli 1917 schrieb Maxim Gorki: „Die Gleichheit von Juden ist eine der wundervollen Errungenschaften unserer Revolution. Durch die Anerkennung der Gleichheit von Juden zu Russen haben wir einen schamvollen, blutigen und schmutzigen Fleck von unserem Gewissen entfernt.“30 Formell war dem zwar so, aber Antisemiten/Antisemitinnen verhinderten weiterhin die Gleichstellung von Juden und Jüdinnen, die von der Übergangsregierung bestimmt worden war.
Abgesehen davon kehrten viele Deserteure von den Fronten des Ersten Weltkriegs zurück, die nun ohne die Disziplin an der Front und ohne Platz in der Gesellschaft weiterleben mussten. Sie brachten ein hohes Ausmaß an Chaos, Mangel an Disziplin und Gewaltbereitschaft mit. Antisemitismus und Pogrome nahmen wieder zu, und der „blutige und schmutzige Fleck“, von dem Gorki geschrieben hatte, war wieder da. Ende 1917 kam es immer wieder zu kleineren Pogromen, darunter vor allem in Bessarabien. In den folgenden Jahren sollten sie massiv zunehmen.31
Nach dem Oktoberputsch und dem Ausbruch des Bürgerkriegs schlossen sich viele prominente Anführer der Schwarzen Hundertschaften der Weißen Bewegung an, feuerten sie an, gaben ihr Macht. Manche HistorikerInnen behaupten, die Weiße Bewegung war innerlich ausgehöhlt und hatte keine ideologische Botschaft. Dem war nicht so. Sie hatte sehr wohl eine Botschaft, und zwar in vielerlei Hinsicht eine der Schwarzen Hundertschaften. Die Ideale der Schwarzen Hundertschaften in Kombination mit Monarchismus füllten das ideologische Vakuum, das bei den Weißen bestand, nährten den Hass auf die Bolschewiken, der ihnen innewohnte, und gaben ihm eine klare Richtung.
Natürlich waren nicht alle Angehörigen der Freiwilligenarmee Antisemiten, und nicht alle Antisemiten waren Freiwillige. Aber die antisemitischen Tendenzen und die Neigung zu den Schwarzen Hundertschaften innerhalb der Weißen Bewegung sowie allgemein in der russischen Gesellschaft waren sehr stark. Teilweise ist dies damit zu erklären, dass die Weiße Armee und Teile der russischen Öffentlichkeit die Ansichten der Monarchie und imperialistischen Chauvinismus teilten. Die russische Monarchie hatte die Unterdrückung von Juden und Jüdinnen Generationen hindurch unterstützt. All das wurde durch den Judenhass der Russisch-Orthodoxen Kirche verstärkt.
Der Religionsphilosoph Wassili Rosanow glaubte an „die Absorbierung von fast der gesamten Revolution durch Juden“, was seiner Meinung nach „in Pogromen enden“ würde.32 Er beschrieb weiters seine Abscheu vor der Verbindung zwischen Juden und der Revolution. Rosanow und ein weiterer bekannter Religionsphilosoph, Pawel Florenski, waren bei Weitem nicht die Einzigen, die antisemitische Ansichten dieser Art verbreiteten.
Gebildete Juden und Jüdinnen verstanden bald, welchem Pfad der Antisemitismus in der Ära von Terror und Bürgerkrieg folgen würde. Am 7. Jänner 1918 schrieb der Intellektuelle und Wissenschaftler S. M. Dubnow in seinem Tagebuch über die Behörden und ihr Hauptquartier, das Smolny-Institut (damals genutzt als Regierungsgebäude und Regierungssitz):
„Man wird die Beteiligung der jüdischen Revolutionäre am Terror der Bolschewiken gegen uns [Juden, Anm.] nicht vergessen. Die Gefährten Lenins – die Trotzkis, die Sinowjews, die Urizkis und die anderen – werden ihn vernebeln. Smolny wird insgeheim ‚Saujudenzentrum‘ genannt. Später werden sie das laut aussprechen, und Judenhass wird in allen Schichten der russischen Gesellschaft tief verwurzelt sein …“33
Dubnows Worte stellten sich als prophetisch heraus. Man begann, der jüdischen Bevölkerung für alle politischen Entwicklungen des Sowjetregimes die Schuld zu geben, machte sie zu Sündenböcken für Grausamkeiten, die vom bolschewistischen Regime verübt wurden. Niemand interessierte sich für die Tatsache, dass diese Anführer der Bolschewiken Atheisten und Diktatoren waren und keinerlei Verbindungen zur jüdischen Bevölkerung hatten.
Der antisemitische Mythos, dass die bolschewistische Macht angeblich der zionistischen Verschwörung entsprach, entwickelte sich nicht nur in der russischen Sowjetrepublik, in der Ukraine und in Weißrussland, sondern breitete sich in den Kaukasus, nach Zentralasien, bis nach Bessarabien, in die baltischen Staaten, nach Westeuropa und darüber hinaus aus. Während des Polnisch-Sowjetischen Kriegs kreierte das Büro innerstaatlicher Propaganda in Polen aufwiegelnde antibolschewistische Poster. Auf einem Poster aus dem Jahr 1920 ist ein Davidstern auf den Kappen der Soldaten der Roten Armee zu sehen.34 Dadurch gab das Büro innerstaatlicher Propaganda den Polen und Polinnen zu verstehen, dass die Macht der Kommunisten neu sein mochte, doch das Problem der „jüdischen Verschwörung“ alt und allen wohl bekannt.
Generell war Antisemitismus in der polnischen Propaganda weit verbreitet und konnte in seiner karikierenden Hässlichkeit nur mit Postern der Behörde für Propaganda der Weißen (OSVAG) verglichen werden. Vom OSVAG soll weiter unten noch ausführlich die Rede sein. Eines dieser Plakate stellte zum Beispiel ein Monster mit klischeehaften semitischen Zügen dar. Bedrohlich reißt es seine Arme hoch. Dieser regelrechte Beelzebub mit Buckelnase und Ziegenbärtchen droht, das unschuldige Polen zu verschlingen. Neben ihm brennt im Dunklen eine zerstörte orthodoxe Kirche, und hinter ihm steht die bedrohliche Gestalt eines Mannes der Roten Armee, der wie ein Golem aussieht und einen Davidstern auf dem Helm hat. Als wäre diese Szene teuflischen Schreckens nicht genug, steht unter dem Bild: „Nochmals jüdische Tatzen? Nein, nie wieder!“35
Kurz vor dem Oktoberputsch fand vor dem Hintergrund von Zerstörung und der Verbreitung von antijüdischer Stimmung im Land eine Konferenz jüdischer Soldatenvereinigungen in Kiew statt. Auf dieser Konferenz wurde der Beschluss gefasst, den Allgemeinen Bund Jüdischer Soldaten in Russland sowie den Allgemeinen Bund Jüdischer Selbstverteidigung zu gründen. Der Vorsitzende der Konferenz, Joseph Trumpeldor, war ein bekannter Aktivist der Zionistischen Bewegung. Angesichts der anhaltenden Pogrome ernannte ihn das Militärrevolutionäre Komitee zum Vorsitzenden der ersten jüdischen Organisation zur Selbstverteidigung in Petrograd. Im Dezember 1917 frohlockte Trumpeldor in einem Brief: „Ich habe Erlaubnis, die erste jüdische zusammengelegte Einheit zusammenzustellen. Sie hat die Größe eines Bataillons von etwa tausend Mann … Ihre wichtigste, aber nicht einzige Aufgabe ist, gegen die Massaker anzukämpfen, die gegen Juden verübt werden.“36 Nur ein paar Wochen später wurde die Jüdische Einheit im Jänner 1918 von den Bolschewiken aufgelöst.