Weischedels Minimaltheologie im Spiegel der Sprachkunst
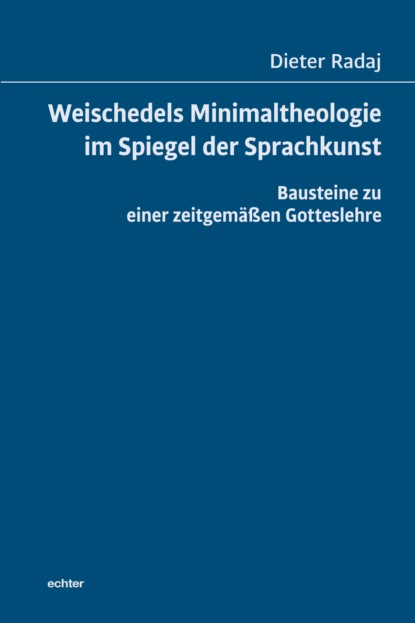
- -
- 100%
- +
Nach Karl Jaspers kann dem Menschen an den Grenzen der Erkenntnis bzw. im Scheitern von Lebensentwürfen der Sprung in die »Gewissheit des Selbstseins« auf Grund seiner Freiheit und im Glauben an die Transzendenz gelingen. Nach Martin Heidegger muss in der Angst vor dem Nichts der Sprung des Denkens in das Sein vollzogen werden. Das Entfliehen des Gottes im Ausbleiben des Seins kann nur durch dessen erneutes Erscheinen aufgehoben werden.
Etwa zur selben Zeit wird die philosophische Theologie vom existentialen Protestantismus zurückgewiesen, während die neuscholastisch geprägte katholische Theologie der »natürlichen Theologie« Raum gibt. Nach Karl Barth ist es ausschließlich Sache des Glaubens, Gott in der Wirklichkeit und als Wirklichkeit zu erkennen: »Die menschliche Vernunft ist blind für Gottes Wahrheit«. Unter Glauben versteht Barth die Begegnung mit Gott, in der aber dem Menschen alle Eigeninitiative genommen ist. Gott ist der Handelnde und nicht der Mensch. Allein im Wort offenbart sich Gott. Auch Rudolf Bultmann, der Theologe einer umstrittenen »Entmythologisierung« des Neuen Testaments, sieht allein im Glauben die Möglichkeit der Gotteserkenntnis. Gerhard Ebeling wiederum bestreitet die Möglichkeit einer philosophischen Theologie, weil über Gott keine neutralen Aussagen gemacht werden können. Wer eine Aussage über Gott macht, muss mit seiner eigenen Existenz für die Existenz des ausgesagten Gottes einstehen. Das Reden von Gott ist somit Sache des Glaubens im Sinne von Vertrauen auf den wahren Grund der Existenz.
Philosophie und Glauben stehen nach Auffassung des existentialen Protestantismus in einem grundlegenden Widerspruch.1 Der Gläubige lässt sich den Glaubensinhalt vom Evangelium vorgeben, während der Philosophierende auf Einsicht setzt. Der Gläubige stellt sich unter die Autorität des Mensch gewordenen Gottes, während der Philosophierende die Freiheit des Denkens für sich beansprucht. Das hat zur Folge, dass sich der Gläubige seines Gottes gewiss ist, während der Philosophierende auf die Fraglichkeit Gottes stößt. Offenbarungstheologie und philosophische Theologie sind in dieser Hinsicht unvereinbar.
5. Weischedels Überwindung des Verfalls der philosophischen Theologie
Im Atheismus, Nihilismus und Existentialismus hatte die philosophische Theologie einen kaum noch zu unterbietenden Tiefpunkt erreicht. Wollte man sie wiederbeleben, musste am Tiefpunkt mit dem philosophischen Fragen nach Gott neu begonnen werden. Dieser Aufgabe hat sich der Philosoph Wilhelm Weischedel (1905–1975) in seinem epochalen Werk »Der Gott der Philosophen – Grundlegung einer Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus« unterzogen.1 Weischedel ist der Fachwelt als Herausgeber der Werke Kants bekannt, aber auch breiteren Kreisen vertraut durch seine unkonventionelle Darstellung der großen Philosophen über »Die philosophische Hintertreppe«.3
Nach den vorangehenden Ausführungen hat das radikale Fragen der Philosophen in der Neuzeit zum Nihilismus und zur umfassenden Skepsis geführt. Weischedel folgert, dass jedes nachhaltige Philosophieren und noch mehr jeder Versuch einer philosophischen Theologie einen positiven Ansatz benötigt, um überhaupt in Gang zu kommen. Nur wenn ein solcher Ansatz vorliegt, kann eine Antwort gefunden werden, die über eine unergiebige Verneinung hinausgeht. Das zeigt sich an allen Entwürfen der philosophischen Theologie bis einschließlich Hegel.
Dennoch will Weischedel nicht auf die unausgewiesenen Voraussetzungen zurückgreifen, die die unterschiedlichen Entwürfe erst ermöglicht haben, etwa das Durchwaltetsein der Welt vom Göttlichen oder die Geschöpflichkeit des Menschen oder die Zugehörigkeit des Selbst zu einer übersinnlichen Welt oder die Möglichkeit, sich vom Endlichen unmittelbar zum Unendlichen zu erheben. Offenbarungstheologie wird als unvereinbar mit philosophischer Theologie angesehen.
An den Beginn seiner Grundlegung der philosophischen Theologie stellt Weischedel den freien Grundentschluss zum Philosophieren, Letzteres verstanden als Fragen, Infragestellen und Weiterfragen, weiter verschärft zum radikalen Fragen nach Sein und Sinn. Der Grundentschluss geht von der philosophischen Grunderfahrung der Fraglichkeit von Weltwirklichkeit und Menschenexistenz aus: Fraglichkeit als ein Schweben zwischen Sein und Nichtsein bzw. zwischen Sinn und Sinnlosigkeit. Diese Grunderfahrung wird als »unmittelbar präsent« bezeichnet. Dem Tiefpunkt der philosophischen Theologie entsprechend erfolgt das radikale Fragen in Form des »offenen Skeptizismus« (offen für die Möglichkeit von Wahrheit), des »offenen Atheismus« (offen für die Möglichkeit eines Gottes) und des »offenen Nihilismus« (offen für die Möglichkeit von Sein und Sinn). Die Ergebnisse von Weischedels philosophischer Bemühung sind in Kapitel II dargestellt.
Wenn Weischedel im Titel seines Werkes den Nihilismus als »Merkmal des Zeitalters« anspricht, so meint er damit die philosophische Position von Nietzsche und Heidegger, hinter die ein zeitgenössischer kontinental-europäischer Philosoph nicht unbegründet zurückgreifen kann. Nietzsches Vision, den Nihilismus durch den »Willen zur Macht« »jenseits aller Werte« zu überwinden, ist misslungen, hat ihm selbst die psychische Gesundheit genommen und hat später eine ganze Nation ins Verderben gestürzt. Heidegger wiederum hat versucht, die »Existentialien«, Angst und Geworfenheit des Menschen, über eine »Kehre des Denkens von der Vergessenheit zur Wahrheit des Seins« zu überwinden. Diese Kehre ist aber nicht einem Entschluss des Menschen unterstellt, sondern bedarf des Geschicks des Seins selbst. Auch Heidegger hat somit den Nihilismus keineswegs überwunden.
Die der Überwindung des Nihilismus dienende Grundlegung der philosophischen Theologie, die sich Weischedel vorgenommen hat, ist daher eine Aufgabe, ohne deren Lösung eine gedeihliche Fortentwicklung der philosophischen Theorie zumindest im kontinental-europäischen Bereich als unredlich erscheint. Wer sich im Dickicht falscher Denkweisen verlaufen hat, muss erst auf den rechten Weg zurückkehren. Es geht ja auch nicht nur darum, im Sinne Weischedels den Verfall der philosophischen Theologie denkerisch zu überwinden. Das darüber hinausgehende Ziel sollte es sein, in Verbindung von philosophischer Theologie und Offenbarungstheologie eine höhere Erkenntnisebene zu erreichen.
Die Überwindung des Nihilismus in Theorie und Praxis ist aber auch eine fortdauernde Aufgabe in den westlichen Gesellschaften. Besonders junge Menschen empfinden die Sinnlosigkeit des auf Konsum und Wellness ausgerichteten Lebensvollzugs. Massenmörderische Attentate und Selbstmorde sowie die Faszination des Dschihad sind Ausdruck einer nihilistischen, in gewalttätige Selbstübersteigerung einmündenden Weltsicht.
6. Albert Schweitzers philosophisch-theologische Antwort
In ganz anderer Weise hat Albert Schweitzer (1875–1965) auf die skeptizistischen, atheistischen und nihilistischen Tendenzen seiner Zeit geantwortet. Während Weischedel das Problem rein denkerisch zu lösen versucht, geht Schweitzer davon aus, dass der Mensch mehr noch als durch Erkennen durch Erleben der Welt nahe kommt: »Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will«. Die »Ehrfurcht vor dem Leben« muss demnach Grundlage aller Philosophie und Ethik sein. Dies ist der schon von Kant her bekannte Schritt aus der unbefriedigenden Erkenntnissituation in die überzeugender begründbare Welt des Willens und des Handelns. Schweitzer selbst hat diesen Schritt überzeugend vollzogen, als Urwaldarzt in Afrika und zugleich als bedeutender Organist und Bach-Interpret.
Es ist notwendig, genauer darzulegen, was Schweitzer unter »Ehrfurcht vor dem Leben« versteht, zumal der Begriff »Leben« in der Philosophie ein breites Bedeutungsspektrum abdeckt. Die wesentlichen Punkte lassen sich dem Epilog zu seinem Lebensbericht entnehmen.4 Schweitzer sieht die Welt voll von Leid und im geistigen Niedergang begriffen, glaubt aber, dem Menschen helfen und ihn bessern zu können. Ausgangsbasis ist ihm das dem (ethischen) Skeptizismus entgegengerichtete Denken und Handeln, das lebendige Wahrheit entstehen lässt.
Die Forderung »Ehrfurcht vor dem Leben« ergibt sich als denkerische Antwort auf die Frage nach dem angemessenen Verhältnis von Mensch und Welt. Dem Dasein wird ein Sinn gegeben, wenn das natürliche Verhältnis zur Welt zu einem geistigen Verhältnis erhoben wird. Da der Mensch ein die Welt erleidendes Wesen ist, ist die geistige Antwort darauf die Resignation. Schweitzer meint damit aber kein passives Verhalten, sondern eher den Fatalismus der Stoa. Der Mensch müsse vom äußeren, der Welt unterworfen Sein zur inneren Freiheit finden, die ihm die Welt- und Lebensbejahung ermöglicht. Weltbejahung äußert sich in der Förderung des Lebens in seiner Umgebung. Diese Förderung verhilft zum eigentlichen Glück. Die Grundelemente dieser Lebenseinstellung sind daher Resignation, Welt- und Lebensbejahung sowie Ethik. Unter Ethik wird die ins Universelle erweiterte christliche Liebe verstanden. Die verbreitete Meinung ist falsch, Schweitzer habe sich mit seiner Betonung des Lebens gegen das Denken gewandt. Im Gegenteil, er hebt immer wieder hervor, dass die »Ehrfurcht vor dem Leben« gemäß vorstehendem Gedankengang ein Ergebnis des Denkens ist.
Das ethische Postulat der »Ehrfurcht vor dem Leben« lässt sich zweiteilen. Als Erstes geht es um die Ehrfurcht vor der von Gott geschaffenen Natur, die, einem mittelalterlichen Gedankengang folgend, nicht Objekt der Ausbeutung, sondern Partnerin bei der Verherrlichung Gottes ist. Als Zweites ist der von Gott beseelte Mensch gemeint, der über die Natur erhöht ist, was aber keinen Herrschaftsanspruch gegenüber der Natur begründet.
Abschließend sei die Lebensphilosophie von Albert Schweitzer mit der Theologie des Vonwoher der Fraglichkeit verglichen. Der Skeptizismus von Weischedel hinsichtlich der Erkennbarkeit von Sein und Sinn wird von Schweitzer nicht geteilt. Während Weischedel voraussetzungslos zu denken versucht, vollzieht Schweitzer mutig den Schritt in die Lebenswirklichkeit. Dabei wird kein Gott eingeführt, auch kein »Vonwoher der Fraglichkeit «, sondern der überall und jederzeit wahrnehmbare Lebensdrang bildet die Ausgangsbasis des Denkens. Der Mensch kann aufgrund seiner inneren Freiheit die lebensbejahende Nächstenliebe entwickeln, deren Ausübung zum eigentlichen Glück verhilft. Was für ein Unterschied zum kargen Ergebnis von Weischedels philosophischer Theologie.
7. Weitere neuere Ansätze zur philosophischen Theologie
Es gibt eine ganze Reihe von Versuchen, eine zeitgemäße philosophische Theologie zu bieten, ohne auf die nihilistischen und existentialistischen Philosophien explizit einzugehen. Diese Versuche werden nachfolgend kurz vorgestellt.
Der philosophische Ansatz von Gerhard Krüger führt die zunehmende Fraglichkeit von Wirklichkeit, Dasein und Wahrheit auf das Überhandnehmen des geschichtlichen Denkens in der Neuzeit zurück. Er versucht, stattdessen Elemente der griechisch-antiken Weltsicht wiederzubeleben.
Die katholisch geprägten Ansätze führen im Allgemeinen die neuscholastische Denktradition fort, gemäß der eine zweischichtige Erkenntnisordnung besteht: Vernunftebene und Glaubensebene, natürliche Wahrheit und Offenbarungswahrheit, Philosophie und Theologie. So schlägt Edith Stein die Brücke zwischen scholastischem Denken (Thomas von Aquin) und modernem phänomenologischen Denken (Edmund Husserl). Karl Rahners »metaphysische Anthropologie« wiederum bestimmt den Raum der Offenbarungstheologie ausgehend von der Verborgenheit des reinen Seins, das sich der positiven Erkenntnis entzieht. Teilhard de Chardin verbindet Evolutionstheorie und katholischen Glauben in mystischer Schau.
Zwei protestantisch geprägte Ansätze sind zu nennen. Paul Tillich bestimmt den Einheitspunkt von Philosophie und Religion als »das Unbedingte«, das mit Gott gleichgesetzt oder sogar ihm übergeordnet ist. Angesichts von Zweifel und Sinnlosigkeit wird ein »absoluter Glaube« gefordert, der sich auf eine überpersonal aufgefasste Gottheit als Quelle von Sinnbejahung und Gewissheit richtet. Georg Picht betont die Wirklichkeit Gottes als Wahrheit des Seins gegenüber dem geglaubten Gott der christlichen Offenbarung.
Der jüdisch geprägte Ansatz von Hans Jonas weist den Weg zu einer Theologie des machtlosen mitleidenden Gottes. Nach dem Holocaust kann Gott nicht mehr zugleich als allgütig, allmächtig und verständlich aufgefasst werden. Gott hat sich aller weltlichen Machtmöglichkeiten begeben, um die Freiheit und Verantwortungsfähigkeit des Menschen zu begründen. Wohl aber begleitet er den Menschen in erfühlbarer Weise, nunmehr hoffend, dass der Mensch ihm zurückgibt. Gott ist dabei unendlich mitleidend. Der Ansatz von Jonas ist zwar spekulativ, jedoch hinsichtlich der erreichten Widerspruchsfreiheit von Vernunft und Glauben bemerkenswert. Er begründet das »Prinzip Verantwortung«.
In den englischsprachigen Ländern konnte der radikale Nihilismus und Existentialismus nie Fuß fassen. Auch der radikale Atheismus ist hier durch Agnostizismus ersetzt. Der missionarisch vertretene Atheismus des Evolutionsbiologen Richard Dawkins ist eine Ausnahme neuesten Datums. Die Tradition der »natürlichen Theologie« ist in diesen Ländern ungebrochen. Der Empirismus David Humes ist eine feste Bezugsgröße. Pragmatische Argumentationen überwiegen.
Zwei der bedeutendsten Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts im englischsprachigen Raum haben die philosophische Theologie in ihren Systemen integriert. Alfred N. Whitehead versteht Gott als Gott im Prozess, als werdenden Gott.5 Gottes Natur wird bipolar gesehen, auf dem Wege von einer begrifflich-idealen »ursprünglichen Natur« zu einer physikalischrealen »nachfolgenden Natur«, einmündend in den Gott der unendlichen Liebe. John L. Mackie behandelt das mit dem Theismus sich stellende Problem der Existenz Gottes auf der Grundlage der neuzeitlichen analytischen Philosophie.6 Er unternimmt es, die Tatsache der Offenbarung auf Basis der Vernunft abzusichern.
II. Weischedels Grundlegung einer zeitgemäßen philosophischen Theologie
Weischedels philosophische Theologie geht aus von der Grunderfahrung der Fraglichkeit von Weltwirklichkeit und Menschenexistenz, dem Schweben zwischen Sein und Nichtsein sowie zwischen Sinn und Sinnlosigkeit. Das Letzte, wohin das philosophische Fragen führt, ist das »Vonwoher« und dessen mächtiges Vorgehen. Es grenzt sich gegenüber dem herkömmlichen Gottesbegriff ab. Es begründet Freiheit, Offenheit und Loslassen.
1. Zeitgemäßes Philosophieren und Sinnproblematik
Die Ausführungen des Kapitels geben Weischedels Grundlegung einer zeitgemäßen philosophischen Theologie in Kurzform wieder.1 Es wird die Überwindung des Nihilismus verständlich gemacht, ohne an Glaubensinhalte anzuknüpfen.
Philosophieren vollzieht sich nach Weischedel als Fragen und Infragestellen. Es wird gefragt, wie es mit dem als selbstverständlich Erscheinenden in Wahrheit steht. Philosophieren ist unbegrenzt fortgesetztes Fragen. Nichts darf in »unbefragter Fraglosigkeit« stehen bleiben. Philosophieren ist demnach radikales Fragen.
Das radikale Fragen ist die Wurzel der Metaphysik ebenso wie der Kritik an derselben. In der Metaphysik wird nach dem Sein des Seienden ebenso wie nach dessen Ursprung gefragt. Aber auch der Ursprung muss hinterfragt werden. Es gibt kein Ende des Fragens. Dogmatische Behauptungen, die ein Ende herbeiführen, sind unzulässig. So gerät die Frage nach dem Sein des Seienden sowie nach dessen Ursprung vor den Abgrund des möglichen Nichts: »Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?«
Das radikale Fragen als Grundbestimmung des Philosophierens darf aber nicht dahingehend missverstanden werden, als ginge es in letzter Intention ums Fragen und Infragestellen. Intendiert wird eine Antwort, auch wenn diese erneut hinterfragt wird. Damit besteht allerdings die Gefahr, einem leeren Skeptizismus zu verfallen, und somit die Versuchung, sich letztendlich doch wieder in unbefragter Gewissheit zu bergen. Letzteres wäre aber das Ende des Philosophierens.
Das radikale Fragen darf aber auch nicht vor sich selbst Halt machen. Es muss sich selbst radikal in Frage stellen. Es muss radikaler gezweifelt werden, als es Descartes getan hat, dem noch das zweifelnde Ich gewiss erschien. Diese Radikalität des Fragens und Zweifelns ist nach zweieinhalb Jahrtausenden Philosophiegeschichte unumgänglich, trotz der aufgezeigten Gefahren.
Das radikale Fragen hat zunächst die Form des »offenen Skeptizismus«. Der Skeptizismus in der Philosophiegeschichte (von den Sophisten bis zu Hume und Nietzsche) bezweifelt die Möglichkeit wahrer Erkenntnis. Nicht so der offene Skeptizismus, der die Möglichkeit von Wahrheit zulässt, jedoch jeder Wahrheitsaussage skeptisch gegenübertritt.
Das radikale Fragen hat des Weiteren die Form des »offenen Atheismus«. Dabei geht es nicht um den eingeschränkten Atheismus, der es vermeidet, den personalen Gott als Ausgangspunkt des Philosophierens zu setzen, sondern um den extremen Atheismus, der ein jegliches göttliches Seiendes leugnet. Der extreme Atheismus behauptet, es gibt keinen Gott, dies jedoch in einseitig dogmatischer Form, denn der Standpunkt lässt sich ebenso wenig erweisen wie die gegenteilige Position, es gibt einen Gott. Das Philosophieren muss deshalb dafür frei bleiben, dass sich im Fortgang des radikalen Fragens die Notwendigkeit ergibt, einen Gott anzunehmen. Dies ist der offene Atheismus.
Das radikale Fragen hat schließlich die Form des »offenen Nihilismus«. Nihilismus ist dabei nicht in abwertender Bedeutung gemeint und auch nicht in seinen recht zahlreichen philosophiegeschichtlichen Varianten, darunter der dogmatische Nihilismus von Nietzsche. Nihilismus wird dagegen als offen bleibende Antwort auf die Seinsfrage einerseits und die Sinnfrage andererseits gesehen. Beide Fragen zusammen gehören zum Kern der philosophischen Theologie.
Zeitgemäßes Philosophieren erfolgt somit zwischen Seinsund Sinngewissheit und Nihilismus. Die Seinsfrage im Verhältnis zum Nihilismus ist in der neueren Philosophie, besonders bei Heidegger, eingehend behandelt. Die Sinnfrage hat demgegenüber kaum Beachtung gefunden, obwohl sie erst den Entschluss zum Philosophieren begründet.
Folgende Wesensmomente zum Begriff des Sinns werden von Weischedel hervorgehoben. Sinn heißt so viel wie Verstehbarkeit. Sinnhaft ist das Verstehbare. Im Verstehen vollzieht sich Sinngebung. Sinn ist aber nichts subjektiv Erfundenes, sondern kommt der Sache selbst objektiv zu. Beispielsweise ruht in der Buchstabenfolge eines Wortes ein zunächst verborgener Sinn. Das Sinnhafte verweist auf ein Sinngebendes. Dieses andere ist der eigentliche Sinn des Sinnhaften. So gibt die Wortbedeutung der Buchstabenfolge ihren Sinn. Das, was sinnhaft erscheint, ist der Fraglichkeit enthoben. Jedes einzelne Sinnhafte erhält seine Sinnhaftigkeit von einem je höheren Sinnhaften. Es bildet sich eine unumkehrbare Sinnkette bzw. Sinnhierarchie. Es gibt keinen Einzelsinn ohne einen umfassenderen Sinn. Der bedingte Einzelsinn verweist letztendlich auf einen unbedingten höchsten Sinn.
Obwohl sich der Mensch unreflektiert in sinnhaften Zusammenhängen glaubt, tritt doch auch das sinnlos Erscheinende an ihn heran, etwa im Angesicht des Todes oder in der Leere des Alltags. Aber weder unbedingter Sinn noch absolute Sinnlosigkeit sind erweisbar. Umgekehrt gilt, dass weder die Sinngewissheit noch die nihilistische Sinnleugnung eindeutig widerlegbar sind. Hinsichtlich der Sinnfrage muss deshalb vorerst alles in der Schwebe bleiben. Am Ende des Gedankengangs von Weischedel steht daher der freie Entschluss zum Philosophieren als radikales Fragen unter Zulassung eines offenen Nihilismus. Die zu bedenkende Alternative des Selbstmords wird verworfen, denn er würde die Entscheidung zur absoluten Sinnlosigkeit voraussetzen, die nicht gerechtfertigt werden kann.
2. Die philosophische Grunderfahrung
Am Anfang des Bemühens Weischedels um eine zeitgemäße philosophische Theologie steht also der Grundentschluss zum Philosophieren, aufgefasst als radikales Fragen. Das radikale Fragen setzt eine entsprechende Fraglichkeit des Seins und des Sinns der Wirklichkeit voraus. Diese Fraglichkeit tritt (nach Weischedel) als Grunderfahrung des Menschen auf, etwa bei der Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit, Krankheit und schwerer Behinderung, Unrecht und Mord, Betrug und Verrat, aber auch bei identisch wiederkehrenden Vorgängen oder im Zustand der Langeweile.
Kennzeichnend für die genannte menschliche Grunderfahrung ist deren Unmittelbarkeit und Präsenz, was sie von den Wirkungen eines Schlusses unterscheidet. Sie ist für das menschliche Dasein vom Grunde her bestimmend und nicht auf andere Erfahrungen rückführbar. Aus ihr kann Philosophieren und damit philosophische Theologie entstehen. Die Grunderfahrung der Fraglichkeit tritt somit bei Weischedel an die Stelle der in bisherige Entwürfe eingegangenen metaphysischen Erfahrungen oder positiven Setzungen.
Die Grunderfahrung tritt als schwebende Erfahrung der Fraglichkeit von Sein und Sinn auf. Sie hält die Mitte zwischen Sein und Nichtsein bzw. zwischen Sinn und Sinnlosigkeit. Sein und Sinn sind dabei eng verwoben. Nur der jeweils vorherrschende Grundzug markiert den Unterschied.
Wahrheit und Wirklichkeit der vorstehend beschriebenen philosophischen Grunderfahrung bestimmen sich aus dem Merkmal der unmittelbaren Präsenz. Wiederum ist die Verbindung eng, denn eine Erfahrung ist wahr, wenn das in ihr Erfahrene wirklich ist. Die Grunderfahrung des Schwebens ist wahr und das in ihr Erfahrene wirklich. Andererseits stürzt die Grunderfahrung alles vermeintlich Wirkliche ins Fraglichsein. Folglich ist das Wesen des Wirklichen Fraglichkeit.
3. Gott als das Vonwoher der Fraglichkeit
Ausgehend von der philosophischen Grunderfahrung der Fraglichkeit von Sein und Sinn vollzieht Weischedel den Schritt zu seiner philosophischen Theologie. Zunächst ist die Bedingung der Möglichkeit von Fraglichkeit zu klären. Die radikale Fraglichkeit kann von drei Ausgangspunkten her begriffen werden, die sich überschneiden. Es kann nach der Bedingung der Möglichkeit von Fraglichkeit gefragt werden: Von woher kommt das Schweben in Gang? Es kann gefragt werden, wieso Sein und Sinn ohne Halt erscheinen und doch nicht dem Nichtsein und der Sinnlosigkeit verfallen: Wie ist das Sich-Halten in der Haltlosigkeit zu erklären? Schließlich kann nach der Hinfälligkeit von Sein und Sinn gefragt werden: Woher rührt die ständige Bedrohung bei gleichzeitiger Vermeidung des Absturzes? Weischedel umgeht die naheliegenden Begriffe »Grund«, »Ursprung« oder »Herkunft«, weil sie Substanzhaftigkeit bzw. Statik ausdrücken. Er bevorzugt die Neubildung »Vonwoher«, die den Geschehenscharakter hervorhebt.
Das Vonwoher ist das Letzte, wohin das philosophische Fragen in seinem Rückgang hinter die Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit gelangen kann. Das ist insofern spekulativ, als es nicht mehr unmittelbarer Gegenstand der Erfahrung ist, auch wenn es an die Erfahrung anknüpft. »Spekulativ« ist somit im ursprünglichen Wortsinn als »schauend« zu interpretieren.
Das Vonwoher der Fraglichkeit ist der einzige noch verwendbare Begriff, wenn im Rahmen eines offenen Nihilismus von Gott gesprochen werden soll. Die traditionellen Bestimmungen von Gott sind gemäß dem Grundsatz der radikalen Fraglichkeit nicht durchhaltbar, etwa »höchstes Seiendes«, »absoluter Geist« oder »absolute Person«. Weischedels philosophische Theologie wird daher zu einer Theologie des Vonwoher.
4. Das Wesen des Vonwoher
Die von Weischedel umsichtig ausgearbeitete philosophische Theologie wird am Wesen des Vonwoher erläutert. Dieses erschließt sich über die nachfolgend zusammengefassten unterschiedlichen Bestimmungen.
Die Aufgabe, das Vonwoher seinem Wesen nach auszulegen, soll über die Sprache gelöst werden. Sprache ist aber (nach Weischedel) von der Erfahrung her gebildet. Wie ist dann ausdrückbar, was nicht der unmittelbaren Erfahrungsebene angehört? Andererseits würde Schweigen dem auch nicht gerecht, denn was als Problem entgegentritt, will durchdacht sein, und Denken erfolgt mittels Sprache. Sprache knüpft an das Bekannte an, um auch das Unbekannte verständlich zu machen. Da die gemeinte Sache, das Wesen des Vonwoher, den Zustand des Schwebens beinhaltet, muss die Sprache diesem Aspekt gerecht werden. Um den Geschehens- und Beziehungscharakter in den Vordergrund zu stellen, will Weischedel den Verben den Vorzug vor den Substantiven geben.

