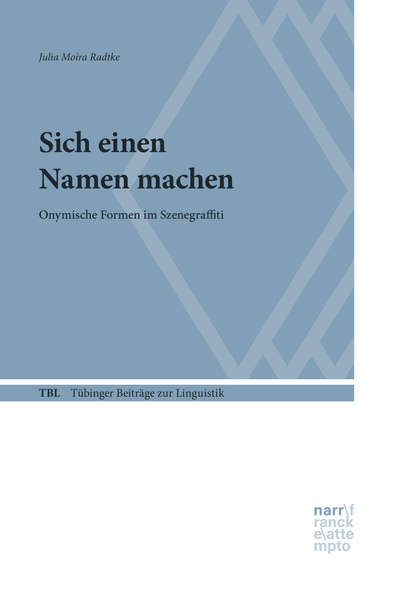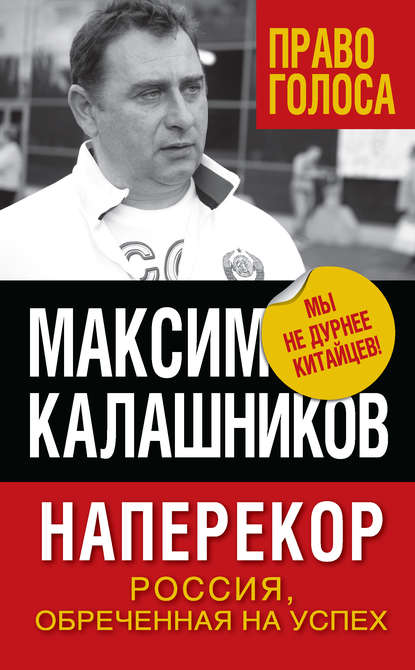- -
- 100%
- +
Eine andere Perspektive auf Graffitis eröffnet sich mit der Entwicklung der Linguistic-Landscape-Forschung. In dieser Forschungsrichtung, die in Kapitel 2 noch genauer beschrieben wird, geht es um die Betextung des öffentlichen Raums und darum, welche Formen von Schriftlichkeit sich in einem bestimmten geographischen Raum finden, welche Sprachen vertreten sind, wo die Schrift platziert ist etc. Da es sich bei Graffitis um Schriftformen im öffentlichen Raum handelt, rücken sie in den Fokus der LL-Forschung. Im Rahmen dieser Forschungsrichtung nimmt sich zunächst PENNYCOOK (2009, 2010) des Themas an. Er betont, dass Graffitis nicht nur im urbanen Raum angebracht werden, sondern diesen wesentlich mit konstruieren: „Landscapes are not mere backdrops on which texts and images are drawn but are spaces that are imagined and invented.“ (PENNYCOOK 2009: 309f.) In dieser Perspektive wird auch der räumlich-situative Kontext bei der Betrachtung der Graffitis relevant (PENNYCOOK 2010: 143).6 Weitere Publikationen, die das Thema Graffiti betreffen und der LL-Forschung zugeordnet werden können, stammen von KAPPES (2014), SCHMITZ UND ZIEGLER (2016) und WACHENDORFF ET AL. (2017).
Zum Gegenstand sprachwissenschaftlicher Betrachtung werden Graffitis auch als Formen des „Andersschreibens“ (SCHUSTER UND TOPHINKE (Hg.) 2012b). SEBBA (2003, 2007, 2009) geht beispielsweise in verschiedenen Publikationen auf Graffitis ein, um aufzuzeigen, dass orthographische Abweichungen als Mittel genutzt werden, mit dem sich soziale Gruppen konstituieren und von anderen Gruppen abgrenzen (2007: 168). Er versteht Graffiti dabei als „one of the few types of very public writing where no spelling is imposed; writers are free to flout all norms or to develop their own new ones“ (SEBBA 2003: 161). Auch JØRGENSEN (2007, 2008) perspektiviert Graffitis als besondere Schreibungen. Er hebt insbesondere den kreativen Umgang der Writer mit verschiedenen Sprachen hervor. Graffitis sind in diesem Sinne Andersschreibungen, weil verschiedene Sprachen in einem Satz oder auch in einem Wort kombiniert werden. JØRGENSEN bezeichnet dieses Phänomen als „languaging“ (2007: 165).
Graffitis sind in den letzten Jahren auch vermehrt in ihrer besonderen Bildlichkeit, also ihrer Verbindung aus schriftlichen und bildlichen Elementen, wahrgenommen worden, z.B. bei MEIER (2007), METTEN (2011), PAPENBROCK UND TOPHINKE (2012, 2014, 2016) und TOPHINKE (2016, 2017). Sie werden dabei als „Formen des Andersschreibens im Schnittbereich von Schrift und Kunst“ (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2012: 179) betrachtet und die besondere Wirkung, die sich aus dem Zusammenspiel schriftlicher und bildlicher Eigenschaften ergibt, beschrieben. Diese Perspektive auf Graffitis bildet sich im Rahmen eines zunehmenden Interesses der Linguistik an den bildlichen Eigenschaften der Schrift heraus. Mit der Beobachtung, dass die Gestaltung bzw. die Bildlichkeit eines Textes dessen Interpretation beeinflussen kann, Schriftgestaltung also durchaus über ein Bedeutungspotenzial verfügt, rückten auch Graffitis in das Blickfeld der Forschung.
TOPHINKE (2016) nimmt Graffitis außerdem in einer praxistheoretischen Perspektive in den Blick. Sie zeigt auf, dass das Herstellen von Graffitis eine sozial fundierte Praktik ist und die Graffitis selbst als Artefakte dieser Praktik betrachtet werden können. Durch diese Perspektive zeigt sich, dass sich viele Merkmale der Graffitis aus den sozialen und körperlich-handwerklichen Bedingungen ihrer Herstellung ergeben. Als Schriftlichkeit, die an eine soziale Gruppe und an eine Praktik gebunden ist, werden Graffitis auch in den Aufsätzen von PAPENBROCK, RADTKE und WACHENDORFF ET AL. betrachtet, die im Sammelband „Graffiti: Deutschsprachige Auf- und Inschriften in sprach- und literaturwissenschaftlicher Perspektive“ (2017) erschienen sind.
Zuletzt sind Graffitis auch in ihrer besonderen, minimalen Grammatik in den Blick geraten (vgl. dazu TOPHINKE 2017 und TOPHINKE im Erscheinen). Dies knüpft an Überlegungen von HENNIG an, die in ihrem Aufsatz „Grammatik multicodal“ Schriftlichkeit auf Schildern in den Blick nimmt und feststellt, dass bei der Beschreibung dieser Schriftlichkeit „ein Grammatikbegriff benötigt wird, der sich nicht auf die verbale Codierung beschränkt“ und stattdessen die Interaktion der Schriftsprachlichkeit mit weiteren Zeichensystemen berücksichtigt (2010: 74). TOPHINKE stellt in ihrem Aufsatz „Minimalismus als Konzept“ (2017) heraus, dass bei Formen minimaler Schriftlichkeit, zu denen auch Graffitis gehören, ebenfalls verschiedene Ressourcen (wie die lexikalische Bedeutungen, die schriftbildlichen Eigenschaften und die Platzierung) zusammenwirken (164f.). Im Aufsatz „Graffiti-Writings als Kommunikate des Urbanen“ (2019) thematisiert TOPHINKE gezielt die Wirkungen, die sich aus den schriftbildlichen Eigenschaften der Graffitis ergeben.
1.3.3 Pseudonyme als Forschungsgegenstand der Onomastik
Pseudonyme sind „eine Untergruppe der Personennamen (Anthroponyme) und […] damit in erster Linie Untersuchungsgegenstand der Onomastik“ (GLÄSER 2009: 503, Hervorh. i.O.). Die Onomastik nimmt Pseudonyme jedoch erst vergleichsweise spät, etwa seit den 70er-Jahren, in den Blick. Andere Disziplinen wie zum Beispiel die Theologie, Philosophie, Philologie, Literaturwissenschaft und die Rechtswissenschaft entwickeln bereits weitaus früher ein wissenschaftliches Interesse an den „falschen Namen“, was sich mit der zunehmenden Bedeutung von Autorenschaft und Bibliographien erklären lässt (ALEKSIEJUK 2016: 444f.). Bei ALEKSIEJUK ist in einem kurzen Überblick zur Pseudonymenforschung zu lesen, dass der Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Anonymen und Pseudonymen oft auf das Erscheinen der Monographie „De nominum mutatione et anonymis scriptoribus“ im Jahr 1669 datiert wird (ALEKSIEJUK 2016: 445). In dieser Publikation diskutiert der deutsche Rechtswissenschaftler GEISSLER rechtliche und historische Aspekte des Namenwechsels.1
Das Interesse der Onomastik lag seit ihrer Entstehung als wissenschaftlich fundierte Namenkunde zu Beginn des 19. Jahrhunderts lange Zeit primär auf Personennamen und Ortsnamen.2 Das Forschungsinteresse bezog sich dabei insbesondere auf die etymologische Bedeutung von Namen. Erst in den 70er-Jahren wendet sich die Namenforschung zunehmend neuen Themen zu, z.B. den Prinzipien, nach denen die Rufnamenvergabe erfolgt (SEUTTER 1996: 9). Damit stehen allerdings nach wie vor Ruf- und Familiennamen im Zentrum der Forschung, während inoffizielle Personennamen wie Spitznamen und Pseudonyme kaum beachtet werden. In der onomastischen Literatur der 70er-Jahre finden sich lediglich einzelne Beiträge, in denen das Thema am Rande erwähnt wird.3 In den 80er- und 90er-Jahren entstehen außerdem umfangreiche Pseudonymenlexika (BARTHEL 1986, MOSSMANN 1987, WEIGAND 1994, EYMER 1997). Dies zeugt zwar von einem großen Interesse an den Namen und der Zuordnung zu ihren Trägern, eine umfassende theoretische Beschreibung und eine systematische Untersuchung dieser Namenart findet allerdings nicht statt. SEUTTER konstatierte noch 1996 dass „[z]ahlreiche Gruppen des deutschen Namensystems wie beispielsweise die Pseudonyme […] noch nicht erforscht“ sind (1996: 9).
Dass das Thema Pseudonymie in der linguistischen Namenforschung bislang eine marginale Position einnimmt, zeigt sich auch daran, dass es in wichtigen Referenzwerken der Onomastik kaum Erwähnung findet.4 Im 1995/1996 erschienenen „Handbuch zur Onomastik“ (EICHLER ET AL. (Hg.)) gibt es beispielsweise nur einen ausgewiesenen Beitrag zu Pseudonymen, in dem die rechtlichen Grundlagen beschrieben werden (SCHWENZER UND MENNE 1996), sowie ein Aufsatz zu Tarnnamen (KÜHN 1995). In anderen Aufsätzen des Handbuches wird diese Namenart nur am Rande aufgegriffen. BAUER, der mit „Deutsche Namenkunde“ 1998 ein umfassendes Werk mit vielen Literaturhinweisen veröffentlicht, erwähnt Pseudonyme nur in einem Satz (54). Auch in den onomastischen Einführungswerken sind nur wenige Informationen zu finden. KOSS (2002: 167–176) weist in seiner Einführung zwar ein Kapitel mit dem Titel „Dramenhelden, Kosenamen, Pseudonyme: erfundene Namen“ aus, er geht in diesem Kapitel jedoch kaum auf Pseudonyme ein und nimmt stattdessen primär literarische Namen und Spitznamen in den Blick. GLÄSER kritisiert daher noch 2009, dass „sowohl strukturelle als auch funktionale Darstellungen der Pseudonyme auf der Grundlage eines repräsentativen Materialkorpus“ fehlen und spricht von einem „offensichtliche[n] Defizit der onomastischen Forschung“ (506). Auch in aktuellen Einführungen in die Onomastik nimmt das Thema wenig Raum ein: NÜBLING ET AL. (2015: 178–180) sowie DEBUS (2012: 133–134) widmen den Pseudonymen jeweils zwei Seiten und verweisen ausdrücklich auf die diesbezüglich bestehende Forschungslücke.
Die wenigen onomastischen Publikationen, die sich dem Thema Pseudonymie widmen, werden im Folgenden chronologisch vorgestellt. Zunächst ist dabei auf die Monographie „Die Personennamen im Deutschen“ ([1982], 2008) von SEIBICKE zu verweisen, die ein Einführungswerk in die Personennamenforschung darstellt. In dieser Publikation von 1982 setzt sich der Autor nicht nur mit Ruf- und Familiennamen, sondern – auf der Basis der Pseudonyme, die er verschiedenen Pseudonymenlexika entnimmt – auch mit Pseudonymen auseinander. Er widmet diesem Thema dabei ein eigenes, mit 14 Seiten im Gegensatz zu späteren Einführungen in die Namenforschung verhältnismäßig umfassendes Kapitel. In diesem Kapitel stellt SEIBICKE namentheoretische Überlegungen an (z.B. zur Abgrenzung von Pseudonym und Namenänderung), geht auf typische Personenkreise, die unter einem Pseudonym agieren, sowie auf deren Motive ein. Darüber hinaus findet sich in diesem Kapitel eine Typologie der Bildungsweisen von Pseudonymen, die von anderen Autoren übernommen wird (z.B. von SEUTTER (1996: 94), die sich auf SEIBICKE bezieht und sagt, dass er „sich als einer der wenigen Onomastiker mit der Bildung von Pseudonymen auseinandergesetzt“ hat).
Als weitere Publikation, die die Pseudonymenforschung zumindest indirekt betrifft, ist die umfassende Monographie „Inoffizielle Personennamen“ (1992) von KANY zu nennen. In dieser linguistischen Untersuchung werden zwar nicht Pseudonyme, sondern Spitznamen zum Forschungsgegenstand gemacht – Pseudonyme werden sogar gezielt exkludiert (KANY 1992: 2) –, KANYS Monographie zeigt jedoch insgesamt eine Hinwendung der Onomastik zu den inoffiziellen Formen des Personennamens an. Es handelt sich dabei außerdem um eine erste Publikation, die inoffizielle Personennamen auf der Basis einer eigenen, größeren Materialgrundlage empirisch untersucht – obwohl KANY dabei NÜBLING zufolge „eine problematische empirische Basis verwendet“ (NÜBLING 2017: 99).
Einen wichtigen Beitrag zur Pseudonymenforschung leistet KÜHN mit ihren empirischen Untersuchungen zu den Decknamen inoffizieller Mitarbeiter in der DDR (1993, 1995, 2004). Möglich werden solche Untersuchungen erst durch die politischen Veränderungen im Jahr 1989, in deren Folge es im Jahr 1992 zur Veröffentlichung der Decknamen von 4500 inoffiziellen Mitarbeitern kommt (KÜHN 1995: 515). Zuvor gab es für die Untersuchung von Tarnnamen keine Datengrundlage, weshalb Decknamen „bisher auch kaum als geschlossene Namengruppe beschrieben werden [konnten]“ (KÜHN 1995: 515). KÜHN bezeichnet den Bereich der Tarnnamen daher auch als „neues Untersuchungsgebiet“ (1995: 515). Meines Wissens hat es zu den Tarnnamen allerdings keine weiteren Veröffentlichungen gegeben.
Eine eher theoretisch orientierte Auseinandersetzung mit Pseudonymen findet sich in der 1996 erschienenen Dissertation „Eigennamen und Recht“ von SEUTTER. In dieser interdisziplinären Arbeit stellt die Autorin eine theoretische Betrachtung der Pseudonyme aus linguistischer und aus juristischer Perspektive an. In ihrer Publikation macht SEUTTER etwa darauf aufmerksam, dass sich das sprachwissenschaftliche und juristische Verständnis von Namen nicht problemlos vereinen lassen. Diese Unstimmigkeit bezieht sich auf die These der Inhaltslosigkeit der Namen:
In manchen Rechtsbereichen wie z.B. dem Wettbewerbsrecht übernehmen Namen nicht nur identifizierende, sondern auch charakterisierende Funktionen. […] In der Namenkunde hingegen versteht man unter Namen sprachliche Zeichen, die in einem initialen Namengebungsakt mit einer bestimmten Entität verbunden werden, ohne daß sie über diese eine inhaltliche Aussage machen. […] Der onomastische Namenbegriff muß ausgehend von Ergebnissen des namenrechtlichen Bereichs differenziert werden: Auf der sprachsystematischen Ebene funktionieren Eigennamen prinzipiell, ohne lexikalischen Inhalt zu transportieren, auf der Gebrauchsebene können Namen aber durchaus charakterisierende Elemente aufweisen. (SEUTTER 1996: 222)
Interessanterweise wird damit bereits ein Aspekt der Namentheorie ausgemacht, der auch in aktuellen onomastischen Publikationen immer wieder aufgegriffen und kritisch betrachtet wird. In der vorliegenden Arbeit wird die These von der Inhaltslosigkeit der Namen – wie noch zu zeigen ist – ebenfalls diskutiert.
Mitte der 90er-Jahre setzt die Erforschung eines weiteren Pseudonymentyps ein: Die Internetpseudonymie. Eine wichtige Rolle kommt BECHAR-ISRAELI zu, die 1995 ein Korpus aus 260 Internetpseudonymen zusammenstellt und eine erste inhaltliche und formale Kategorisierung dieser Namenart vornimmt. Sie stellt dabei beispielsweise – unter Bezugnahme auf das Tierreich – die nahezu paradox anmutende Doppelfunktion von Internetpseudonymen heraus, wonach der Nickname Aufmerksamkeit weckt (wie die Federn eines Pfaus), den Träger aber gleichzeitig auch verdeckt (wie ein Chamäleon) (BECHAR-ISRAELI 1995). Interessanterweise geht BECHAR-ISRAELI in diesem Text auch bereits auf Graffitinamen als Pseudonyme ein.
Eine umfassende Darstellung des Themenkomplexes Chatpseudonymie liefern RUNKEHL ET AL. (1998). Die Autoren erläutern die Funktion der Pseudonyme und nehmen eine Klassifizierung nach semantischen Feldern vor (1998: 72–114). Weitere Aufsätze zur Internetpseudonymie, in denen Formen und Funktionen dieser Namenart herausgearbeitet werden, stammen von ZIEGLER (2004), JOHNOVÁ (2004) und STOMMEL (2007).5 HEISLER UND CRABILL (2006) forschen zur Wahrnehmung von Email-Pseudonymen. Umfassende Publikationen jüngeren Datums stammen von WOCHELE (2012) und JANSEN (2012). WOCHELE untersucht Nicknamen in einem sozialen Netzwerk und analysiert diese auf graphischer, morphologischer, syntaktischer und semantischer Ebene (2012: 36ff.). JANSEN, deren Aufsatz im gleichen Sammelband („Sprache und Öffentlichkeit in realen und virtuellen Räumen“ hg. v. GERSTENBERG ET AL.) erscheint, eruiert anhand der Nicknamen, die auf einer französischsprachigen Kontaktseite verwendet werden, primär die Funktionen von Internetpseudonymen (2012: 5ff.).
Zuletzt seien noch zwei Publikationen neueren Datums genannt, in denen die namentheoretische Einordnung von Pseudonymen im Vordergrund steht. Hier ist zum einen der Aufsatz „Familiennamen und Pseudonyme“ (2009) von GLÄSER und zum anderen der Beitrag „Pseudonyms“ von ALEKSIEJUK im „Handbook of Names and Naming“ (HOUGH (Hg.) 2016b) zu nennen. GLÄSERS Essay ist für die Pseudonymenforschung bedeutsam, weil GLÄSER einige allgemeine terminologische Klärungen vornimmt und dabei auch eine Definition der Bezeichnung Pseudonym entwickelt, die in anderen onomastischen Arbeiten übernommen wird (2009: 509).6 GLÄSER liefert außerdem einen Überblick zu den Funktionen und Strukturen der unterschiedlichen Pseudonymentypen (2009: 510ff.). Die Publikation von ALEKSIEJUK nimmt alle Subtypen des Pseudonyms, d.h. Deck- und Tarnnamen, Künstlernamen sowie Internetpseudonyme7, gesammelt in den Blick und systematisiert diese. Ältere Publikationen haben demgegenüber in der Regel lediglich einen Untertyp der Pseudonyme thematisiert. Neben den hier genannten Arbeiten gibt es meines Wissens keine weiteren aktuellen Veröffentlichungen zu einer allgemeinen Typologie der Pseudonyme.
Wie dieser Forschungsüberblick zeigt, beschränken sich empirische Arbeiten, die auf der Grundlage eines repräsentativen Materialkorpus entstehen, fast ausschließlich auf den Bereich der Internetpseudonymie. Arbeiten zu anderen Pseudonymentypen – wie die Untersuchungen von KÜHN (1993, 1995, 2004) zu den Tarnnamen – können nur entstehen, wenn Pseudonyme als solche erkannt und zudem in großer Zahl erfasst werden. Das Projekt INGRID ermöglicht somit – indem es ein umfassendes Korpus an Graffitinamen bereitstellt – die systematische Beschreibung eines weiteren pseudonymischen Subtyps.
2. Graffiti
Die Bezeichnung Graffiti wird im alltäglichen und auch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch für die Bezugnahme auf ganz verschiedene Erscheinungsformen verwendet. Als Graffitis werden nicht nur die bunten Inschriften im urbanen Raum bezeichnet, sondern beispielsweise auch Äußerungen an den Wänden von Toilettenkabinen (FISCHER 2009) und Gefängnissen (HESSE 1979) sowie informelle Schüleräußerungen (BLUME 1980, 1981) und politische Parolen an Hauswänden (STAHL 1989: 22ff.). Gemeinsam haben alle diese Formen, dass es sich um Schrift handelt und dass diese unautorisiert im (mehr oder weniger) öffentlichen Raum angebracht wird. Darüber hinaus sind die Formen ortsfest (TOPHINKE 2017: 168), d.h., sie verbleiben am Ort ihrer Entstehung und können nicht – wie beispielsweise eine Notiz auf einem Blatt Papier – von diesem Ort entfernt werden.1
Im öffentlichen Raum sind Graffitis von einer Fülle an weiteren schriftlichen Formen umgeben, z.B. von Verkehrsschildern, Werbeplakaten, Ladenschildern etc., die ebenfalls in ihrer Materialität mit dem Untergrund verbunden sind. Nach AUER besteht eine wesentliche Eigenschaft der Kommunikation durch öffentliche, ortsgebundene Schriftlichkeit darin, „Räume les- und damit nutzbar [zu machen], die nicht durch das routinemäßige Zusammenleben Ortskundiger gekennzeichnet sind“ (2010: 274). Straßenschilder und Ladenschilder erleichtern beispielsweise die Orientierung im Raum; Verbotsschilder kommunizieren das Unterlassen bestimmter Handlungen. Die öffentliche Schrift zeigt den Rezipienten also Handlungsoptionen im öffentlichen Raum auf (AUER 2010: 275). Darüber hinaus macht sie es möglich, dass ein Zeichenproduzent etwas an einen größeren Rezipientenkreis kommunizieren kann, ohne dass dabei Produzent und Rezipient von Angesicht zu Angesicht aufeinandertreffen; sie „ersetzt damit Formen der face-to-face-Kommunikation“ (AUER 2010: 275, Hervorh. i.O.).
Graffitis unterscheiden sich von diesen anderen Formen ortsfester, öffentlicher Schriftlichkeit in vielerlei Hinsicht. Sie dienen – anders als Straßenschilder, Häusernamen etc. – nicht dazu, den öffentlichen Raum für Rezipienten besser interpretierbar und nutzbar zu machen, und ersetzen auch nicht Formen der face-to-face-Kommunikation. Für Graffitis ist es im Gegenteil sogar wichtig, dass der Schreiber anonym bleibt, Produzent und Rezipient also nicht aufeinandertreffen.
Das Szenegraffiti, das in dieser Arbeit in den Blick genommen wird, unterscheidet sich von anderen schriftlichen Formen im öffentlichen Raum auch durch die Bindung an eine soziale Gruppe – die Graffitiszene. Es ist sozial fundiert, weil es eine Gruppe gibt, die Graffitiwriting als „Praktik“ (TOPHINKE 2016) erkennt und diese auch selbst ausübt. Praktiken können „als Typiken des körperlichen Tuns […], die Wiederholung, Wiedererkennen und auch Erlernbarkeit ermöglichen“ gefasst werden (TOPHINKE 2016: 406). Sie bilden sich in der Regel dann heraus, wenn „das Wiederholen bzw. Wiederauftreten des betreffenden körperlichen Tuns in dem jeweiligen sozialen Bezugsrahmen Relevanz besitzt“ (TOPHINKE 2016: 407). Graffitiwriting stellt demzufolge eine soziale Praktik dar, weil es für die Szenemitglieder Relevanz besitzt, indem sie die Formen dieser Art erkennen und deuten können.
An diesen Überlegungen zeigt sich bereits, dass zwischen einem engen und einem weiten Graffitibegriff zu unterscheiden ist. Das Szenegraffiti ist dabei als eigener Typ ortsfester, öffentlicher Schriftlichkeit zu perspektivieren, den es von anderen Formen, die gemeinhin als Graffiti bezeichnet werden, abzugrenzen gilt. Bei einem engen Begriffsverständnis werden dementsprechend nur diejenigen Formen erfasst, die sich erkennbar an den stilistischen Traditionen und sozial-kommunikativen Praktiken der Szene orientieren (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2016: 88). Weitere Formen unautorisierter Schriftlichkeit im öffentlichen Raum, z.B. Sprüche an Toilettentüren oder Einritzungen in Bänke, werden dabei ausgeklammert. Um sich von diesen anderen Formen abzugrenzen, spricht die Szene selbst statt von Graffiti eher von Writing (TEMESCHINKO 2015: 10).2 Eine genaue Grenzziehung zwischen dem Szenegraffiti und Formen von Graffiti im weiteren Sinn ist jedoch schwierig und kann immer nur vage bleiben, wie auch PAPENBROCK UND TOPHINKE erklären:
Neben Formen, die sich eindeutig als Szene-Graffitis fassen lassen, finden sich Formen, die etwa in der formal-ästhetischen Ausführung, in ihrer Semantik oder in ihrer Platzierung untypisch sind. Diskussionen und Darstellungen in szenenahen Printmedien oder im Internet zeigen, dass auch die Graffiti-Szene selbst fortlaufend diskursiv klären muss, was als Graffiti gelten kann. (2016: 88f.)
Der Übergang zu weiteren Formen öffentlicher, unautorisierter Schriftlichkeit ist dementsprechend fließend. In diesem Kapitel soll es daher darum gehen, das Szenegraffiti mit seinen besonderen Eigenschaften zu beschreiben und so den Blick für diese Formen zu schärfen, bevor der Fokus der Betrachtung in den nächsten Kapiteln auf die Namen im Szenegraffiti gesetzt wird.
2.1 Eine Bestandsaufnahme
Die folgenden Ausführungen beleuchten das Szenegraffiti aus einer linguistischen Perspektive. Bei dieser „Bestandsaufnahme“ werden daher insbesondere die Ergebnisse der bisherigen linguistischen Graffitiforschung berücksichtigt, die sich auf Forschungsfelder wie die Linguistic-Landscape-Forschung, die Schriftbildlichkeitsforschung und die Geosemiotik verteilen. Ziel dieser Vorgehensweise ist eine erste Annäherung an den facettenreichen Untersuchungsgegenstand Graffiti sowie eine Erarbeitung der zentralen Eigenschaften dieses Phänomenbereichs.
2.1.1 Bild und Schrift
Graffitis stehen in einem interessanten Spannungsfeld aus Bildlichkeit und Schriftlichkeit (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2012: 194). Im Gegensatz zu anderen Formen ortsfester, öffentlicher Schriftlichkeit, die in der Regel maschinell gedruckt und auf Lesbarkeit ausgerichtet sind, zeichnen sich Graffitis dadurch aus, dass schriftliche und bildliche Elemente untrennbar miteinander verbunden sind. Nicht selten geschieht dies auch auf Kosten der Lesbarkeit. Graffitis als „handwerklich gediegene Unikate mit künstlerischem Anspruch“ bilden damit einen starken Kontrast zum „typographischen und normierten Charakter [autorisierter] öffentlicher Schriftlichkeit“ (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2012: 193).
Die Verbindung von Bild und Sprache ist für die Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches: Während öffentliche, visuelle Kommunikation im 19. Jahrhundert – und in einigen Bereichen wie etwa Schule und Hochschule bis fast in die Gegenwart – noch primär über Texte ohne Bilder erfolgte, werden Schrift und Bild heute auf vielfältige Weise miteinander verknüpft (SCHMITZ 2011: 25). Auf Werbeplakaten, in Zeitungen, auf Straßenschildern etc. stehen schriftliche und bildliche Elemente in der Regel nicht unabhängig nebeneinander, sondern stellen eine Bedeutungseinheit dar, bilden also „Sehflächen“ (SCHMITZ 2011: 25).1 Nach SCHMITZ sind diese Sehflächen in der öffentlichen visuellen Kommunikation zum „unauffällige[n] Standard“ geworden (SCHMITZ 2011: 24). Graffitis unterscheiden sich von anderen multimodalen Formen jedoch dadurch, dass Bild und Schrift nicht nur nebeneinanderstehen und semiotisch zusammenwirken, sondern in einer Form vereint sind. Es handelt sich somit um Hybridformen mit sowohl schriftlichen als auch bildlichen Eigenschaften. PAPENBROCK UND TOPHINKE bezeichnen Graffitis daher auch als „Formen des Andersschreibens im Schnittbereich von Schrift und Kunst“ (2012: 179).
Dass es sich bei Szenegraffitis um Schrift handelt, lässt sich daran festmachen, dass es sich bei den gesprühten Werken im weitesten Sinn um Wörter handelt. Die Buchstaben der Wörter werden allerdings gedreht, verformt und verfremdet. Weil dabei die „typographischen Normen“ außer Acht gelassen werden, ist Graffiti in der Literatur sogar als „Befreiung der Schrift“ (LEISS UND LEISS 1997: 21) bezeichnet worden. Die Buchstabenformen werden von den Akteuren aber in der Regel nicht vollständig aufgelöst. Sie sind zumindest für Szenekundige erkennbar. Die Schrift bleibt damit auch bei einem hohen Verfremdungsgrad der Buchstaben als „zugrundeliegendes, strukturgebendes Repräsentationsmodell“ erhalten (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2012: 187). Buchstaben bilden im Szenegraffiti gewissermaßen die Schnittstelle zwischen Schrift und Bild: Als Grapheme korrespondieren sie mit Phonemen und können – wenn sie zu Morphemen kombiniert werden – Bedeutungen übertragen, gleichzeitig stellen sie jedoch auch figürliche Elemente mit jeweils ganz eigenen Formmerkmalen dar (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2012: 186f.).