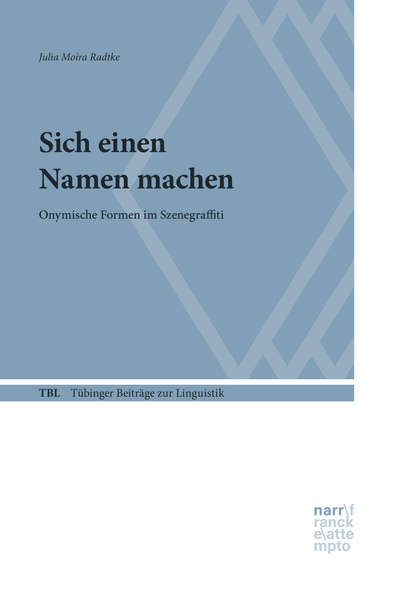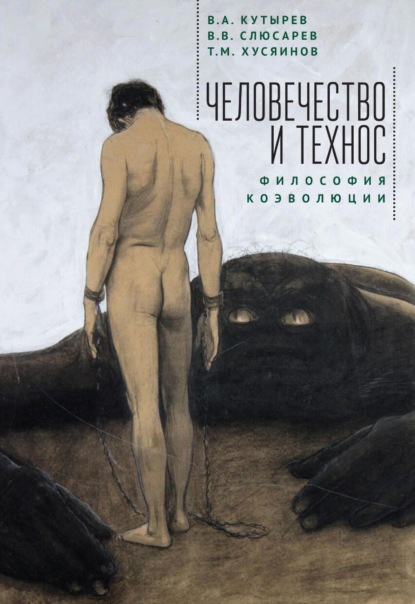- -
- 100%
- +
In der onomastischen Literatur wird noch eine weitere referenzielle Besonderheit von Namen herausgestellt, die NÜBLING ET AL. als „Direktreferenz“ bezeichnen (2015: 18f.). Mit diesem Terminus ist gemeint, dass Namen auf ein Objekt referieren, ohne dass dabei eine Bedeutung aktiviert wird (HARNISCH UND NÜBLING 2004: 1902).

Abb. 12: Die spezifische onymische Referenzweise (aus: NÜBLING ET AL. 2015: 18)
NÜBLING ET AL. zeigen das Prinzip der Direktreferenz anschaulich am Beispiel der Stadt Münster auf (2015: 18). Wie in Abb. 12 zu sehen ist, referiert der Ausdruck Münster auf die Stadt, ohne dabei die Semantik zu aktivieren, mit der Münster als Appellativ verknüpft ist. Denn wenn ein Wort zum Namen wird, gilt, dass „[t]he former lexical meaning (if there ever was one) ceases to exist“ (NYSTRÖM 2016: 40). Die lexikalische13 bzw. konzeptionelle Bedeutung des zugrunde liegenden Appellativs Münster wird deaktiviert und ist daher in der Abbildung gestrichen.14 Zur Semantik der Namen finden sich in der Literatur allerdings unterschiedliche Annahmen, weshalb dieser Aspekt im nächsten Abschnitt (3.3) nochmals gesondert aufgegriffen wird.
3.2.2 Individualisierung
Neben der Identifizierung wird Namen auch die Fähigkeit zugeschrieben, das Referenzobjekt zu individualisieren (vgl. dazu NÜBLING ET AL. 2015: 20ff., SEIBICKE 2008: 3, LEYS 1979: 67). LEYS weist darauf hin, dass sich Individualität hier weniger auf die Einmaligkeit der Namensform bezieht, als auf die Tatsache, „dass sie feste Zeichen oder Marken, oder, wenn man will, Etikette für Individuen bzw. individualisierte Objekte sind“ (1979: 67). Denn Namen werden oft von mehreren Trägern geteilt. Es handelt sich dabei jedoch um zufällige Erscheinungen und nicht, wie es bei den Appellativen der Fall ist, um ein systemhaftes Vorkommen.
Auch wenn ein Name nicht einmalig sein muss, um seinen Träger zu individualisieren, so ist Individualisierung trotzdem an das Vorhandensein einer gewissen Auswahl gebunden, d.h., es muss ein Inventar an Namen zur Verfügung stehen, aus dem der Träger schöpfen kann. Teilen sich viele Menschen einige wenige Namen, sind diese als weniger individuell anzusehen, als wenn eine Gesellschaft aus einem großen Nameninventar schöpft (NÜBLING ET AL. 2015: 22). Die beliebtesten Namen eines Jahrgangs haben die geringste Individualisierungsrate. Individualisierung ist demzufolge als Kontinuum zu perspektivieren, während es bei der Identifizierung nur ein Entweder-oder gibt: Entweder ein Objekt wird identifiziert oder es wird nicht identifiziert (NÜBLING ET AL. 2015: 22). NÜBLING ET AL. stellen daher klar heraus, dass es sich bei Individualisierung und Identifizierung um zwei Funktionen von Namen handelt, die voneinander unterschieden werden müssen:
Bei der Identifizierung wird ein X als nicht identisch mit Y und Z markiert. Man hat X von äußerlich ähnlichem Y, Z und weiteren Klassenmitgliedern unterschieden und kann jetzt auf X referieren. Bei der Individualisierung passiert viel mehr: Hier wird X herausgehoben, als einzigartig mit individuellen Zügen behaftet […]. (NÜBLING ET AL. 2015: 20)
Ein Student kann demzufolge durch seine Matrikelnummer von allen anderen Studenten an der Universität unterschieden werden – Zahlen eignen sich in besonderem Maße zur Identifikation, weil sie unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben –, die Matrikelnummer erzeugt jedoch keine Individualisierung. Individualisiert werden Objekte durch ihren Namen.1 Auch Appellative schaffen keine Individualisierung, sie verhalten sich nach BAUER sogar gegensätzlich:
Während die Verwendung von Appellativen die Einordnung in eine Klasse (Subsumtion) voraussetzt, macht die Benutzung von Eigennamen die klassifikatorische Nivellierung ungültig und gibt dem Individuum seine im Vollzuge der Klassifizierung abgelegten subjektiven Persönlichkeitszüge wieder zurück. (BAUER 1998: 37)
Wegen dieser Funktion empfinden Menschen gegenüber ihrem Namen oftmals eine tiefe Verbundenheit: Er wird als Bestandteil der Persönlichkeit angesehen, sodass eine Veralberung des Namens als Verletzung der Persönlichkeit wahrgenommen wird (WIMMER 1995: 373).2 Dass Name und Identität eng miteinander verbunden sind, belegen auch diverse psychologische Studien.3 JOUBERT (1993) konnte zeigen, dass Menschen, die mit sich selbst zufrieden sind, generell auch eher ihren Namen mögen. WIKSTRØM (2012) stellte fest, dass auch der Nachname eng mit der Identität einer Person verknüpft ist. Allerdings ist dabei noch ungeklärt, ob die Namen „actually influence or merely mirror identity“ (ALDRIN 2016: 386).
3.2.3 Charakterisierung
Wenn im folgenden Abschnitt das Charakterisieren als eine Funktion von Namen vorgestellt wird, so mag dies zunächst irritieren, denn der Fachterminus Direktreferenz besagt gerade – wie in Abschnitt 3.2.1 erläutert wurde –, dass Namen einen sprachlichen Zugriff auf ein Objekt leisten, ohne dieses zu charakterisieren. An dieser Stelle muss daher zwischen verschiedenen Namenklassen differenziert werden: Wie bereits herausgestellt, sagen prototypische Namen wie Ruf-, Familien- und auch Ortsnamen nichts über das Referenzobjekt aus. Andere Namenklassen – etwa im kommerziellen Bereich – funktionieren hingegen anders: Sie machen ein Referenzobjekt nicht nur identifizierbar, sondern haben gleichzeitig eine werbende Funktion. KOSS weist darauf hin, dass Namen für Produkte1 regelrecht „gemacht“ werden (KOSS 2008: 43), oftmals werden sie sogar von Agenturen entwickelt. Die Namen werden dabei gezielt ausgewählt, um bestimmte gedankliche Verknüpfungen aufzurufen. Diese sog. Konnotationen werden definiert als
[i]ndividuelle (emotionale) stilistische, regionale u.a. Bedeutungskomponenten eines sprachlichen Ausdrucks, die seine Grundbedeutung überlagern und die – im Unterschied zur konstanten begrifflichen Bedeutung – sich meist genereller, kontextunabhängiger Beschreibung entziehen […]. (BUSSMANN 2008: 362)
Konnotationen sind damit abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem individuellen emotionalen und stilistischen Empfinden eines Sprechers oder Hörers. Sie sind kaum überindividuell beschreibbar, sondern an den jeweiligen Erfahrungs- und Wissenshorizont eines Individuums gebunden.
Einen engeren Konnotationsbegriff vertritt MAAS, der davon ausgeht, dass Konnotationen durch vorgängige Verwendungen entstehen: „Jede Ausdrucksweise ist quasi indexikalisch gebunden an einen Praxiszusammenhang, den sie im Erfahrungshorizont des Sprechers/Hörers symbolisch bindet – dessen Form sie konnotiert.“ (1985: 74, Hervorh. i.O.) Sprachliche Ausdrücke rufen demzufolge – neben der konzeptionellen Bedeutung – auch diejenigen Verwendungskontexte auf, in denen sie geäußert oder gehört wurden.
In der onomastischen Literatur wird typischerweise ein weiterer Konnotationsbegriff zugrunde gelegt, wonach es sich um „zusätzliche individuelle oder überindividuelle (soziale, kulturelle) Bedeutungsassoziationen“ handelt (NÜBLING ET AL. 2015: 34). Wie VAN LANGENDONCK UND VAN DE VELDE zeigen, kann bei Namen dabei noch genauer differenziert werden. Sie unterscheiden verschiedene Arten von Konnotationen, von denen insbesondere zwei hier genauer beschrieben werden (2016: 31f.).2 Sie formulieren für den ersten Typ, dass „names with a transparent etymology can give rise to associative meanings related to the name form“ (VAN LANGENDONCK UND VAN DE VELDE 2016: 31). Von diesem Prinzip, dass Namen mit einer transparenten Semantik bestimmte Assoziationen aufrufen können, wird beispielsweise bei Waren- und Firmennamen Gebrauch gemacht, indem diese aus prestigehaltigen Lexemen und Onymen gebildet werden.3 Der Name Olympia für eine Handelsfirma, die technische Geräte vertreibt, erinnert an die Olympischen Spiele und ruft Konnotationen von Sieg und sportlicher Leistungsstärke auf. Die Namen Triumph (Name eines Unterwäschehersteller), Brillant (Lampen) und Diamant (Fahrräder) konnotieren als Appellative ebenfalls positive Eigenschaften, die der Kunde auch für das Produkt annehmen soll (LÖTSCHER 1987: 312).4 Ähnlich wirken auch Warennamen, die aus Bezeichnungen hoher gesellschaftlicher Ämter gebildet werden:
Wenn Autos, Fernsehgeräte oder Füllfederhalter als Diplomat, Konsul, Ambassador oder Kommodore/Commodore bezeichnet werden, dann wird damit nahegelegt, daß diese Produkte auch Ansprüchen so hochgestellter Persönlichkeiten genügen würden. (LÖTSCHER 1987: 312, Hervorh. i.O.)
Die Namen wecken Assoziationen an gehobene gesellschaftliche Stellungen und Macht, was den potenziellen Kunden positiv auf das Produkt einstimmen soll.5 Der Grundgedanke dieser Namenart besteht demzufolge darin, dass die Namen motiviert sind, also auf Eigenschaften des Namenträgers schließen lassen.
Weniger offensichtlich ist diese Wirkung bei semitransparenten Warennamen: Der Warenname Wella erinnert etwa noch an das Lexem Welle, Schauma an Schaum. Weniger transparent erscheinen Namen beispielsweise durch
die Veränderung […] der Buchstabenfolge, die Erweiterung oder Verstümmelung eines Lexems, die Verbindung oder Verschmelzung zweier Lexeme zu einem neuen Wort, sei es mit oder ohne eigene lexikalische Bedeutung, oder die Verwendung fremdsprachiger sprechender Namen. (LAMPING 1983: 42)
Mit abnehmender Transparenz wird auch die Semantik schwächer wahrgenommen: Wenn sich die Schreibung vom zugrunde liegenden Lexem entfernt, tritt damit die lexikalische Bedeutung in den Hintergrund. Dazu findet sich auch eine treffende Aussage bei KALVERKÄMPER, der feststellt, dass „eine graphische Anomalität (wenn man die normierte Graphie des Appellativs als ,normal‘ zugrunde legt) […] einen Verfremdungseffekt hervorruft“, sich der Name durch graphische Veränderung also vom Appellativ entfernt (1978: 324). Eine ähnliche Wirkung kann – darauf weist LAMPING in oben stehendem Zitat hin – auch durch die Verwendung fremdsprachlicher Lexeme erzeugt werden, weil dadurch die Semantik weniger offensichtlich wird.
Durch eine „transparent etymology“ (VAN LANGENDONCK UND VAN DE VELDE 2016: 31) hervorgerufene Konnotationen lassen sich nicht nur für Warennamen annehmen, sondern auch für andere Namenarten wie Spitznamen6 und literarische Namen.7 Für sie gilt weniger der „werbende“ Charakter, der hier für Warennamen als zentral erachtet wurde, sie können jedoch ebenfalls transparent sein und somit einen Aussagegehalt besitzen (LAMPING 1983: 42, ASCHENBERG 1991: 44ff.).8 In der Literatur zu den literarischen Namen wird auf einen weiteren Konnotationstyp verwiesen, den VAN LANGENDONCK UND VAN DE VELDE als „emotive meanings“ bezeichnen (2016: 32). Von diesem Konnotationstyp kann ausgegangen werden, wenn ein Name das Referenzobjekt „über seine Materialität“ (ASCHENBERG 1991: 46) charakterisiert. VAN LANGENDONCK UND VAN DE VELDE nennen als Beispiel diminutive Suffixe in Rufnamen wie Jan-tje oder Marie-ke, die verniedlichend wirken (2016: 32). ASCHENBERG (1991: 52ff.) und ELSEN (2008: 47) beziehen sich insbesondere auf die lautliche Materialität eines Namens:
Sprachbenutzer [können] mit Lauten, Buchstaben bzw. ihren Kombinationen gewisse Assoziationen verbinden […]. Die Ergebnisse sind nicht zufällig zustande gekommen und widersprechen der Vorstellung von reiner Arbitrarität zwischen Zeichen und Bedeutung. Es ist wohl von gewissen Tendenzen zu sprechen, von einer Randerscheinung, die nicht in strikte Regeln zu fassen ist. (ELSEN 2008: 47)
ELSEN verweist bei ihrer Analyse literarischer Namen insbesondere auf die Rolle der Vokale und stellt – auch unter Bezugnahme auf experimentelle Studien von ERTEL (1969) – fest, dass [i] mit Merkmalen wie klein und schwach und [a] mit groß und stark korreliere (2008: 46). Auch Autoren selbst verwiesen bei Befragungen zu Benennungsmotiven für ihre Figuren häufig auf lautsymbolische Aspekte. Sie gaben an, je nach Charakter der Figur eher wohlklingende oder missklingende Namen gewählt zu haben (DEBUS 2012: 209).9 In der Literatur zu den Warennamen sind ebenfalls Überlegungen zur lautlichen Wirkung zu finden. Hohe Sonorität (Maoam, Beba) werde eher mit Sanftheit, niedrige Sonorität und stimmlose Konsonanten im Auslaut (Thomapyrin, Spontex) eher mit Härte verbunden (LÖTSCHER 1987: 317).10 An dieser Stelle muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Wirkung von Lauten nur schwer objektivierbar ist. Sowohl DEBUS (2002: 69f., 2012: 209) als auch ELSEN (2008: 47) weisen darauf hin, dass es in der europäischen Forschung kaum Untersuchungen zur Lautsymbolik gibt.11
Wenn Spitznamen, Warennamen und literarische Namen einen semantischen Gehalt besitzen können, ergibt sich die Frage, ob bei diesen Namen überhaupt von Direktreferenz und Inhaltslosigkeit gesprochen werden kann. Denn für prototypische Namen wurde herausgestellt, dass sie auf ein Objekt „ohne ‚Umweg‘ über die Aktivierung einer potentiellen Bedeutung, einer prototypischen Gegenstandsvorstellung“ referieren (NÜBLING ET AL. 2015: 18). Aus diesem Grund ist die Inhaltsseite von de Saussures Zeichenmodell in der Abbildung oben durchgestrichen. KANY kam aufgrund dieses Paradoxes bereits 1995 zu der Schlussfolgerung, „daß die traditionelle These von der Inhaltslosigkeit der Eigennamen (EN) nicht aufrechtzuerhalten ist“ (1995: 512).
In Einklang bringen lassen sich diese beiden Aspekte, wenn streng zwischen Form und Funktion des Namens unterschieden wird. Denn ein Name mit einer „transparent etymology“ hat zwar die gleiche Form wie ein Wort mit einer konzeptuellen Bedeutung (in der Regel ist es ein Appellativ) – und diese kann bei der Referenz auch durchaus mitwirken, dies ändert jedoch nichts an der spezifischen Referenzweise des Namens. Er referiert trotzdem auf genau ein Objekt, ohne dass dafür semantische Merkmale benötigt werden. Wäre die Semantik bei der Referenzweise aktiviert, würden Wörter wie Ambassador und Diamant als Gattungsbezeichnungen auf Botschafter und Diamanten referieren – und nicht auf ein Uhrenmodell von Hugo Boss und einen Fahrradhersteller. Dieser Zusammenhang von Name und Denotat leitet sich nicht aus den Merkmalen der Objekte ab, sondern muss gelernt werden. KANYS Aussage, ist daher insofern zuzustimmen, als Namen durchaus aus bedeutungshaltigem Material gebildet werden können. Ihre Funktionalität, den eindeutigen Bezug auf ein Denotat herzustellen, ist von einer konzeptuellen Bedeutung jedoch entkoppelt.12 LEYS ist daher ebenfalls zuzustimmen, wenn er die These aufstellt „dass es die alleinige Funktion des Eigennamens ist, zu referieren und dass er dazu kein einziges semantisches Merkmal braucht“ (LEYS 1979: 72).
3.3 Die Semantik der Namen
Ein Thema, das in der Linguistik, aber auch in der Philosophie und der Psychologie viel diskutiert wurde, ist die Frage nach der Semantik der Eigennamen. Aus der Perspektive der verschiedenen Disziplinen gilt es als unumstritten, dass die meisten Namen diachron betrachtet eine Bedeutung aufweisen. Da sie größtenteils aus Appellativen hervorgegangen sind, haben sie eine etymologische Bedeutung. Uneinigkeit besteht in der Forschung jedoch bei einem synchronen Blick auf die Namenbedeutung.
Nach HANSACK lassen sich bei der Frage nach der Namenbedeutung drei grundverschiedene Auffassungen ausmachen (2004: 52): In einer traditionellen Perspektive der Philosophie und der Linguistik werden Namen als bedeutungslos betrachtet, sie gelten als „ohne Semantik“ (zurückgehend auf MILL 1843: 19–58, erwähnt aber auch bei LEYS 1979: 70, NÜBLING ET AL. 2015: 13 und bei VAN LANGENDONCK UND VAN DE VELDE 2016: 27). Des Weiteren existiert die Vorstellung, Namen seien semantisch reduziert, verfügen also gegenüber Appellativen über eine eingeschränkte Semantik. Die dritte Auffassung geht auf den dänischen Sprachforscher JESPERSEN zurück und besagt, dass Namen ein Maximum an Bedeutung haben (1968: 65–71). Die gegensätzlichen Vorstellungen von der Bedeutungsleere der Namen einerseits und der maximalen Bedeutung von Namen andererseits sowie die Kritik an ebendiesen Vorstellungen werden im Folgenden kurz erläutert.
Bereits 1843 formulierte MILL folgende Theorie: „A proper name is but an unmeaning mark which we connect in our minds with the idea of the object“ (MILL 1843: 43). Seinem vielzitiertem Werk „A System of Logic“ ist außerdem die Aussage zu entnehmen, dass Namen „denote the individuals who are called by them; but they do not indicate or imply any attributes as belonging to those individuals“ (MILL 1843: 40). Die Vertreter der Bedeutungsleere-Position argumentieren – wie oben bereits erläutert –, dass Namen nichts über den Gegenstand, den sie benennen, aussagen und deshalb „als bloßes Etikett“ fungieren (NÜBLING ET AL. 2015: 13, Hervorh. i.O., auch bei LEYS 1979: 68).1 Der Name Jonathan sagt über den Träger – abgesehen von der Information des Sexus – nichts Weiteres aus.2 Es ist sogar denkbar, dass Personen mit dem Namen Jonathan außer ihrem Namen und dem Geschlecht keine weiteren gemeinsamen Merkmale aufweisen. Aus diesem Grund werden Namen auch prinzipiell nicht übersetzt; dies würde nämlich den Blick „von der Bezeichnung auf die Bedeutung“ lenken (KUNZE 1998: 11).
Wie bereits erläutert, funktionieren Appellative anders, weil das Referenzobjekt stets charakterisiert wird. Ein Appellativ bezieht sich „auf eine Gruppe ähnlicher Gegenstände, genauer: Diese Gegenstände teilen sich einige wichtige Merkmale (und nicht etwa alle)“ (NÜBLING ET AL. 2015: 48, Hervorh. i.O.). Objekte, auf die das Appellativ Haus referiert, teilen sich beispielsweise Merkmale wie Ortsfestigkeit, räumliche Begrenztheit, menschlicher Wohnraum. Wenn ein Objekt ebendiese Merkmale aufweist, wird es als Haus erkannt; so würde man beispielsweise Fachwerkhäuser, Holzhäuser und Wolkenkratzer trotz ihrer deutlich sichtbaren Unterschiede zur Gattung Haus zählen. Die appellativische Referenzweise hängt demzufolge mit den Merkmalen und Eigenschaften eines Objektes zusammen. Das Referenzpotenzial der Namen besteht hingegen darin, dass der Bezug zum Objekt unabhängig von dessen Merkmalen erfolgt. Die Referenz bleibt sogar konstant, wenn sich das Referenzobjekt optisch verändert oder sogar inexistent wird, beispielsweise indem es zerstört wird oder stirbt (BURKHARDT 2005: 22).3
Die Vertreter der Bedeutungsleere-Theorie nehmen zwar an, dass Namen keine lexikalische Bedeutung haben, sie gehen allerdings davon aus, dass Namen Konnotationen tragen (NÜBLING ET AL. 2015: 14, 34f.). Diese Nebenbedeutungen gehen allerdings „weniger vom Namen selbst als vom Objekt aus, das der Name bezeichnet“ (NÜBLING ET AL. 2015: 14). SEUTTER verweist zur Verdeutlichung auf den Unterschied zwischen sprachsystematischer und sprachpragmatischer Ebene: „Innerhalb der Langue besitzt der Vorname keine lexikalische Bedeutung, in der Parole kann der Vorname konnotative Bedeutung erhalten“ (1996: 104). Namen wie Hartz IV und Kevin sind demnach durch Erfahrungen mit bestimmten Konnotationen behaftet, die individuell jedoch ganz unterschiedlich ausfallen können.4
Die Vertreter der Position, die Namen ein Maximum an Bedeutung zuschreibt, stützen ihre Argumentation auf die Vorstellung von „Ein-Element-Klassen“ (HANSACK 2004: 54). Demnach gehöre jedes Individuum einer Klasse an, die allerdings nur aus ebendiesem Element besteht. HANSACK stellt unter Bezugnahme auf Erkenntnisse der Computational-Brain-Forschung fest, dass sich Benennungsvorgänge adäquat als „das Adressieren einer Informationsmenge“ verstehen lassen (2004: 56). Ein Name steht dieser Ansicht nach nicht für das Referenzobjekt selbst, sondern der Name adressiert die Informationsmenge, die zu dem entsprechenden Referenzobjekt im menschlichen Gehin angelegt wurde (2004: 56). Aus diesen Erkenntnissen schließt HANSACK, dass
zwischen Appellativen und Namen aus sprachtheoretischer Sicht nur ein einziger grundlegender Unterschied [besteht]: Namen bezeichnen Objekte aus Klassen mit nur einem Objekt […], während Appellative Objekte aus offenen Klassen bezeichnen. (HANSACK 2004: 56)
Dieser These nach tragen Namen eine Bedeutung in Form von Merkmalsbündeln, die sich jedoch ausschließlich auf ein einziges Referenzobjekt beziehen.5 JESPERSEN formulierte bereits 1924 in seiner Philosophy of Grammar, „that proper names (as actually used) ,connote‘ the greatest number of attributes“ (1968: 66). Nur aufgrund dieser Fähigkeit sei das Phänomen zu erklären, dass Namen in Appellative übergehen können, wie es etwa bei Caeser zu Kaiser der Fall ist.6 Dabei werde ein Merkmal herausgegriffen, das für den Namenträger charakteristisch ist, und es wird dazu genutzt, andere Personen oder Objekte zu charakterisieren, die das gleiche Merkmal aufweisen (JESPERSEN 1968: 67). Ähnliches lasse sich auch für Appellative annehmen: Wenn ein Politiker als alter Fuchs oder eine Frau als Juwel bezeichnet werde, geschehe diese Übertragung ebenfalls aufgrund der Konnotationen, die den entsprechenden Substantiven anhaften (JESPERSEN 1968: 67). Daraus leitet JESPERSEN ab, dass ein Name – ähnlich wie andere Substantive – „makes the hearer think of a whole complex of distinctive qualities or characteristics“ (1968: 68).
Bei dieser Argumentation geht die Bedeutung jedoch vom Namenträger aus.7 Nach DEBUS wird in diesem Fall ein Name „durch einen Namengebungsakt (Benennung) individuell zugesprochen und durch den neuen Namenträger mit Inhalten gefüllt“ (2012: 43). Ohne die Kenntnis dieser „Inhalte“ kann jedoch keine Verbindung zwischen Name und Referenzobjekt hergestellt werden, denn das Objekt allein gibt seinen Namen nicht zu erkennen. Im Gegensatz dazu kann der Bezug zwischen Appellativ und Objekt – etwa beim Appellativ Hund – über die äußeren, trägerunabhängigen Merkmale erfolgen. Wenn JESPERSEN also davon ausgeht, dass Namen eine Bedeutung haben, dann ist damit weniger eine lexikalische Bedeutung gemeint, als vielmehr eine Bedeutung, die sich aus den Eigenschaften des Namenträgers ergibt.
Ein weiterer viel diskutierter Aspekt in diesem Themenbereich ist die Frage, ob Namen eine kategorische Bedeutung bzw. einen „Kategorial-Semantische[n] Wert“ (DEBUS 2012: 47, Hervorh. i.O.) besitzen. Die Idee einer kategorischen Bedeutung basiert auf der Vorstellung, dass Menschen alle möglichen Objekte in Kategorien einteilen und Wörter entwickeln, mit denen auf die Objekte einer Kategorie referiert werden kann (NYSTRÖM 2016: 47). Diese Kategorienbildung – so die These – erfolgt auch bei der Wahrnehmung und Verarbeitung von Namen: Wenn wir einen Namen hören, so ordnen wir das Referenzobjekt automatisch einer bestimmten Kategorie zu; auch wenn sich diese Einordnung hinterher als falsch erweisen kann (NYSTRÖM 2016: 47). Ein Name wie Lassie verweist beispielsweise auf die Kategorie „Hund“, Linda verweist auf die Kategorie „Mensch“, obwohl prinzipiell auch ein Hund Linda und ein Mensch Lassie heißen kann. Weitere potenzielle Kategorien sind „male human beings, female human beings, cats, rivers, cities, countries, companies, aircraft, or something else“ (NYSTRÖM 2016: 48).
Die Vorstellung eines kategorischen Wertes der Namen findet sich auch bei FLEISCHER, wenn er zu bedenken gibt, dass Namen „nicht völlig ,reine‘ Identifikationsmarken darstellen, sondern zusätzliche charakterisierende Aussagen vermitteln können“, weil ein Name wie Hans über den Träger immerhin preisgebe, dass er männlich ist und aus dem deutschen Sprachgebiet stammt (FLEISCHER 1992: 12). Hans enthalte damit einzelne Bedeutungskomponenten wie männlich (FLEISCHER 1992: 12).8 An diese Argumentation knüpft auch DEBUS an, der feststellt, dass ein Name auch in der Langue „keine Leerform, kein bloßes Lautetikett“ ist, sondern bestimmte grammatische und semantische Informationen enthält (2012: 43). Der „Kategorial-Grammatische […] Wert“ eines Namens bezieht sich auf die grammatischen Eigenschaften des Namens wie etwa die Wortart sowie Kasus, Numerus und Genus (DEBUS 2012: 46f.). Der „Kategorial-Semantische […] Wert“ eines Namens macht es DEBUS zufolge hingegen möglich, sie in Kategorien wie heimisch/fremd, regional/überregional und sympathisch/unsympathisch einzuordnen (2012: 47).9 Diese Zuordnungsmöglichkeiten entsprechen nicht den Semen der Appellative, aber sie