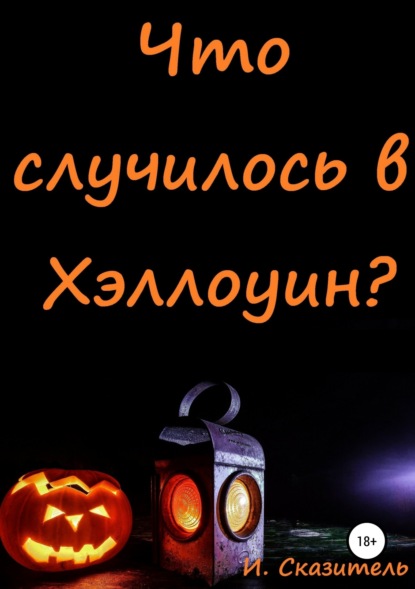Dialektik des geisteswissenschaftlichen Universums
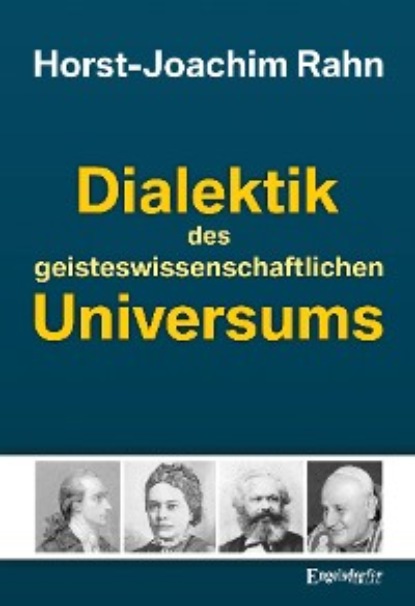
- -
- 100%
- +
► Zu welchem Ergebnis kommen wir hier? Die Antithesen sind teilweise arrogant formuliert. „Fleiß ist nicht die Chance der Unbegabten, sondern der Talentierten, denn Intelligenz allein reicht zum Erfolg nicht aus.“* „Vor allem hat es der Fleiß nicht verdient, gegen die Cleverness ausgespielt zu werden.“* Für die Einstellung der nachwachsenden Generation zur Arbeit ist das in keiner Weise dienlich, sondern schädlich. Wenn es um Fleiß geht, drücken sich manche: „Bei Ausreden ist die Welt voller Erfinder“ (H. Wiener). Und: „Wenn die Pflicht ruft, gibt es viele Schwerhörige“ (G. Knuth). Ein Tipp: „Wir sollten mehr tun und weniger reden“ (Ding Xiaoping). Der frühere Bundeskanzler H. Kohl sagte zu Recht: „Fleiß und Gemeinsinn sind die Grundlagen für den Reichtum unseres Landes.“ Fazit:
„Die Abwertung des Fleißes ist Versündigung an der Leistungsgesellschaft“
(Horst-Joachim Rahn)
„Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“ (E. Balser). Im Berufsleben und in der Wissenschaft spielt der Fleiß sogar eine sehr große Rolle. Nicht zuletzt wegen des enormen Fleißes unseres Volkes haben wir es geschafft, dass aus den vielen Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg eine erfolgreiche Nation wurde.155 Auch gilt: „Das vorliegende Werk zur Dialektik des geisteswissenschaftlichen Universums wäre ohne Fleiß nicht möglich geworden.“* Warum der Fleiß auch in der Schule heute mitunter abgewertet wird, kann ich nicht nachvollziehen. Leider haben sich auch bei manchen Lehrkräften Meinungen breit gemacht, die für die Entwicklung unserer Gesellschaft nicht gut sind. Fleiß ist nicht durch Intelligenz ersetzbar, sondern beide führen nur zusammen zum Ziel.
Auch das Auswendiglernen (z. B. von Vokabeln, Wendungen, Gedichten oder Formeln), hat durchaus seinen Sinn. Es wird von Betroffenen häufig kritisiert, ist aber zum Training der Merkfähigkeit notwendig und lässt sich nicht durch bequemes, reines verstehen Wollen ersetzen. „Wer es sich in der Gesellschaft von Anfang an bequem machen will, wird schon früh scheitern.“* Zum Schluss die wahre Erkenntnis: „Der Fleiß bringt Brot und die Faulheit Not!“ (Sprichwort). „Leider gibt es zum Thema Fleiß wenig gute deutsche Literatur: Auch hier zeigt es sich, dass der Fleiß nicht den Stellenwert besitzt, der ihm eigentlich zukommt.“*
2. 4. 13 Bescheidenheit
Die Bescheidenheit156 ist eine Tugend des Menschen, die sich in einem genügsamen, zurückhaltenden bzw. anspruchslosem Verhalten äußert. „Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft“ (L. Anzengruber). Was ist sie nicht? „Bescheidenheit ist nicht ärmliches Verhalten, sondern Zufriedenheit mit dem Wenigen“ (G.P. Bischoff). Bescheidenheit ist der Verzicht auf etwas zugunsten anderer Menschen. Bescheidene Menschen beanspruchen von etwas Gegebenem nur wenig für sich selbst, selbst dann, wenn die Möglichkeit der Vorteilnahme besteht: „Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt“ (F. von Schiller). Demut ist demgegenüber eine Verhaltensweise gegenüber Gott. „Alle Pietät geht von der Bescheidenheit aus“ (J. Ruskin). Auch gilt: „Tiefe schafft Bescheidenheit“ (J.V. von Scheffel). Das Gegenteil von Bescheidenheit ist Größenwahn, beispielsweise im Rahmen kapitalistischer Völlerei: Grenzenlose Wachstumserwartungen befördern die Gier nach Kapital, während arme Menschen das teilen, was sie haben.157 Ein harter Tadel der Habgier ist hier angebracht.158
► Erfreulich ist, dass es bescheidene Menschen auch heute noch gibt. „Glück ist Selbstgenügsamkeit“ (Aristoteles). „Bescheidenheit ist das Einmaleins zum Glück“ (E. Baschnonga). Und: „Weisheit ist bei den Demütigen“ (Sprüche 11,2). Woher kommt dieses Verhalten? „Die Bescheidenheit glücklicher Menschen kommt von der Ruhe, welches das Glück ihren Gemütern verleiht“ (La Rochefoucauld). Diese Gemüter müssen keineswegs große Lichter sein: „Kleine Lichter leuchten auch“ (M. Wichor). Die Jugend ist seit jeher anspruchsloser, muss aber in der Regel auch nicht für den eigenen Lebensunterhalt sorgen: „Bescheidenheit ziert den Jüngling“ (Plautus). Aus Bescheidenheit kann durchaus Respekt erwachsen: „Du möchtest respektiert werden? Sei bescheiden!“ (P. Kosorin). Und beachte: „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ (G.S. Plinius). Selbstlos sagt der geniale Maler P. Cézanne: „Die Erkenntnis der eigenen Kraft macht bescheiden.“ Manche werden Menschen deshalb bewundert, aber auch nicht registriert: „Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, für die der Mensch bewundert wird, falls die Leute je von ihm hören sollten“ (E.W. Howe). Und Gottfried Keller sagt: „Ich bin noch gar nichts, und muss erst werden, was ich werden will.“ Zum Schluss: „Wenn jemand bescheiden bleibt, nicht beim Lobe, sondern beim Tadel, dann ist er es“ (J. Paul).
► Die Bescheidenheit hat aber auch eine zweite Seite: „Falsche Bescheidenheit ist die schicklichste aller Lügen“ (N. Chamfort). Auch: „Es gibt eine Bescheidenheit, die nur der Mantel des Hochmuts ist“ (C. Sylva). A. Schopenhauer traut dem Verhalten vor allem dann nicht, wenn sich große Geister bescheiden geben: „Bescheidenheit bei mittelmäßigen Fähigkeiten ist bloße Ehrlichkeit. Bei großen Talenten ist sie Heuchelei.“ F.W. Nietzsche interpretiert Bescheidenheit in eine ganz andere Richtung: „Wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden.“ Stimmt das denn? J.W. von Goethe meint: „Nur die Lumpe sind bescheiden, Brave freuen sich der Tat.“ Der irische Dramatiker R.B. Sheridan bringt den Liebhaber ins Spiel: „Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, die die Frauen an einem Liebhaber mehr loben als lieben.“ Die folgende Auffassung ist ganz anders: „Bescheidenheit ist oft nur Mangel an Persönlichkeit“ (U. Löchner). Und mit Bezug zur Kunst: „Die Bescheidenheit hat keine Bretter für die Bühne“ (M. Hinrich). Das Thema ist sehr vielschichtig: „Sobald man sich seiner Bescheidenheit bewusst ist, verliert man sie“ (S. Prudhomme). Eine ähnliche Erkenntnis ist: „Die Bescheidenheit, die zum Bewusstsein kommt, kommt ums Leben“ (M. von Ebner-Eschenbach).
► Was lernen wir daraus? Anspruchslosigkeit und Zurückhaltung werden in unserer satten und verwöhnten Gesellschaft bei den Erwachsenen leider immer seltener. Dazu sagt Katherine Mansfield: „Manchmal befürchte ich, dass es keine Menschen einfachen Gemütes mehr gibt.“ Der bekannte deutsche Philosoph G.F.W. Hegel äußert: „Wer etwas Großes will, der muss sich zu beschränken wissen, wer dagegen alles will, der will in der Tat nichts und bringt es zu nichts.“ Der von mir verehrte chinesische Philosoph Konfuzius stellt fest: „Wer das Gefühl der Menschlichkeit und Bescheidenheit nicht hat, ist kein Mensch.“ Auch in unserer Gesellschaft wünschen wir uns mehr Bescheidenheit. Wie soll das gehen? „Zur Größe gelangt man, indem man demütig ist“ (S. Ramakrishna). Dabei gilt: „Größe und Demut schließen einander nicht aus“ (W. Dilthey).
Wie ist es mit der weiblichen Bescheidenheit? „Das Religiöse steht der weiblichen Bescheidenheit sehr wohl; es gibt der Schönheit ein gewisses edles gesetztes und schmachtendes Aussehen“ (G.E. Lessing). Ein deutsches Sprichwort bringt es auf den Nenner: „Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.“ Dazu bemerkt F. Fellini: „Bescheidenheit ist eine große Tugend – besonders bei anderen Menschen.“ Marie von Ebner-Eschenbach treffend: „Siege, aber triumphiere nicht!“ Kritiker werfen der Bescheidenheit vor, sie sei nur eine anerzogene Verhaltensweise. Die Freiwilligkeit des Verzichts eines Menschen auf Vorteile wird unterschiedlich beurteilt: „Bescheidenheit ist für den beruflichen Erfolg und für die Selbstverwirklichung des Menschen mitunter hinderlich.“* „Falsche Bescheidenheit ist Anmaßung“ (G.E. Lessing). Und André Gide sagt: „Ich glaube, nichts lehrt einen besser Bescheidenheit, als wenn man einen wertvollen Menschen liebt.“ Und Dieter Nuhr meint dazu: „Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind.“ Ich stimme ihm zu und finde, dass sie etwas Edles beinhalten. Deshalb plädiere ich für mehr Bescheidenheit und drücke es positiv so aus: „Bescheidenheit ist der Schlüssel zur Zufriedenheit.“*159
2. 4. 14 Höflichkeit
Die Höflichkeit ist zuvorkommendes, freundliches Verhalten im Umgang mit anderen Menschen und äußert sich in der Achtung, Wertschätzung und Respekt. „Die wahre Höflichkeit besteht darin, dass man einander mit Wohlwollen entgegenkommt“ (J.J. Rousseau). Sie ist vor allem durch gesellschaftliche Normen und Umgangsformen geprägt und äußert sich auch in der Zurückhaltung beim Ausspruch möglicherweise heikler Themen. Hier gilt das Motto: „Wahre den Anstand und verletzte niemand.“ (Sprichwort). Höflichkeit ist ein Verhalten, das zum normalen Umgang der Menschen miteinander gehört, z. B. das Anklopfen an der Tür und das Grüßen des anderen. „Höflichkeit hat auch den Zweck, die Vorzüge eines anderen Menschen indirekt in Erscheinung zu bringen“ (A. Schopenhauer). Das Gegenteil von Höflichkeit ist Unhöflichkeit, Grobheit, Rücksichtslosigkeit oder gar Barbarei.
► „Höflichkeit wirkt wohltuend, wenn sie aus echtem Gefühl heraus kommt“*: „Es gibt eine Höflichkeit des Herzens, sie ist der Liebe verwandt“ (J.W. von Goethe). Ähnlich: „Die Höflichkeit ist die Schwester der Liebe (F. von Assisi). Und: „Takt ist der Verstand des Herzens“ (C.F. Gutzkow). Es reimt sich: „Höflichkeit und Treue bringt nimmer Reue“ (Sprichwort). Höfliches Verhalten ist mit Wohlwollen verbunden: „Höflichkeit ist Wohlwollen in Kleinigkeiten“ (T.B. Macaulay). Oder intellektuell ausgedrückt: „Höflichkeiten sind das Kleingeld unter den Wohltaten“ (H.J. Quadbeck-Seeger). Auf das ganze Leben bezogen: „Das Leben ist kurz, aber man hat immer Zeit, höflich zu sein“ (R.W. Emerson). Oder auch: „Höflichkeit ist der Versuch, die anderen so zu sehen, wie sie nicht sind“ (V. de Kowa).
► „Höflichkeit kann zur Farce werden, wenn sie ins Devote abrutscht.“* Dieses Verhalten kann zu folgender Feststellung führen: „Höflichkeit ist gespielte Unterwürfigkeit“ (F.J. Schaarschuh). Ähnlich: „Höflichkeit ist die angenehmste Form der Heuchelei“ (A.G. Bierce). Aber auch: „Unhöflich sind der Niedrigkeit Genossen“ (J.W. von Goethe). Höflichkeit kann auch aus Berechnung geschehen: „Es gibt Menschen, die einem kleine Höflichkeiten aufdrängen, um nachher große Gegendienste verlangen zu können“ (A. Strindberg). In Frankreich lebt die Höflichkeit mit der Mentalität und mit der Sprache. Etwas direkter ausgedrückt: „Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist“ (J.W. von Goethe). Folgende drei Aussprüche zeigen, wie vielseitig das Thema Höflichkeit ist: „Es ist keine Höflichkeit, einem Lahmen den Stock tragen zu wollen“ (A. Schnitzler). Mit Bezug zur Tierwelt: „Der Fuchs grüßt den Zaun um des Gartens willen“ (Sprichwort). Und der Meister der Aphorismen La Rochefoucauld sagt zum Schluss: „Die Menschen können nur deshalb in Gemeinschaft leben, weil sie Betrüger und Betrogene zugleich sind.“
► Wie manche Antithesen zeigen: „Zu viel Höflichkeit ist unhöflich“ (Nachman, Rabbi von Bratzlaw). „Wir sollten falsche Höflichkeit erkennen bzw. abtrennen und die wahre Höflichkeit als Herzenssache verstehen und praktizieren.“* „Die Höflichkeit ist nicht ein Resultat aus der Erziehung, sondern primär das eigene Ergebnis aus Anstand, Weitsicht und Toleranz“ (O. von Allmen). Einleuchtend ist: „Höflichkeit ist eigentlich weiter nichts als ein vorsichtiges Bestreben, gegen niemand Verachtung und Geringschätzung zu zeigen“ (J. Locke). Einer der größten Menschenkenner erkennt das Wesentliche:
„Höflichkeit ist wie ein Luftkissen: Es mag nichts drin sein, aber sie mildert die Stöße des Lebens“
(Arthur Schopenhauer)
„Soll etwas gelingen, so bedarf es bei allem Nachdenken noch eines sicheren Taktes, welcher nur durch frühe Übung und Angewöhnung gewonnen wird“ (J.G. Fichte). Und zum Schluss der geniale Rat von George Washington: „Sei höflich zu allen, aber freundschaftlich nur mit wenigen, und diese wenigen sollen sich bewähren, ehe du ihnen Vertrauen schenkst.“
2. 4. 15 Menschlichkeit
Die Menschlichkeit ist als Tugend die humane Gesinnung eines Menschen. Sie äußert sich beispielsweise in der Achtung des Mitmenschen, Toleranz Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Nachbarschaftshilfe, Engagement in sozialen Einrichtungen und im achtsamen Umgang mit der Natur. „Dabei heißt tolerant sein, Widersprüche aushalten können“ (G. Grass). Der Gedanke der Humanität umfasst auch die allgemeine Menschenwürde, wie sie im Grundgesetz verankert ist:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“
(Art. 1, 1 Grundgesetz)
Die Menschlichkeit hat auch im Rahmen der Menschenführung als Erfolgsfaktor ihren Stellenwert.160 Grundsätzlich gilt für uns alle: „Behandle Menschen immer so, wie du selbst behandelt werden möchtest“ (nach I. Kant). Der kluge Schöpfer des kategorischen Imperativs lebte in Königsberg und konnte sich im Alter ein Haus, einen Hausdiener und eine Köchin leisten. Kant wird – etwas überzeichnet – als spröder, pünktlicher und professoraler Typ dargestellt. In seiner Studienzeit war er ein guter Katenspieler und verdiente sich sein Studium auch mit Billardspielen. Später litt er an der Alzheimer-Krankheit und war am Ende total orientierungslos.161 Er starb 80jährig in Königsberg. Seine Forderungen nach mehr Menschlichkeit gelten bis heute. Auch der Dalai Lama162 fordert seit Jahren engagiert: „Alles, was wir brauchen, ist mehr Menschlichkeit.“ Das Gegenteil ist die Unmenschlichkeit, die sich z. B. in Rücksichtslosigkeit, Gewalt und unterlassener Hilfeleistung zeigt. Die Menschlichkeit grenzt sich auch von verschiedenen tierischen Eigenheiten und Gegebenheiten ab.
► Was bedeutet Menschlichkeit? „Sie ist die höchste Tugend“ (L. de Vauvenargues). Und: Menschlichkeit ist Humanität: „Sie besteht darin, dass niemals ein Mensch einem Zweck geopfert wird“ (A. Schweitzer). Woran ist sie zu messen? „Menschlichkeit misst sich vor allem an Demut“ (K. Feldkamp). Wie entfaltet sie sich? „Das Wesen der Menschlichkeit entfaltet sich nur in der Ruhe. Ohne sie verliert die Liebe alle Kraft ihrer Wahrheit und des Segens“ (J.H. Pestalozzi). Wie kann man sie erhalten? „Man muss sich besiegen lassen und Menschlichkeit haben“ (Moliére). Zum Verhältnis von Vernunft und Menschlichkeit: „Der Mensch soll nicht vernünftiger, er soll menschlicher werden“ (I.G. von Herder). Zur Partnerschaft äußert sich der österreichische Dichter E. Ferstl: „Solange die Menschlichkeit uns miteinander verbindet, ist mir völlig egal, was uns trennt.“ Und: „Lieben ist für mich die schönste Art von Menschlichkeit“ (D. Wieser). Für uns alle ist wichtig: „Die wirkungsvollste Energiequelle unseres Lebens ist und bleibt die menschliche Wärme“ (E. Ferstl).
► Der Schweizer Journalist W. Ludin wirft die entscheidende Frage auf: „Es gibt Milliarden von Menschen. Warum gibt es so wenig Menschlichkeit?“ Wieso wird die oben gepriesene Menschlichkeit nicht überall im Kleinen und auch im Großen praktiziert? In Mikrosicht eruieren wir: „Bei den meisten Erfolgsmenschen ist Erfolg größer als die Menschlichkeit“ (D. du Maurier). In Makrosicht kann auch aktuell festgestellt werden: „Die fürchterlichen Massaker wurden niemals von Skeptikern oder Nihilisten verübt, sondern von Gläubigen und Utopisten, im Namen von mächtigen Idealen“ (R. Burger). Und für die Politik gilt: „Geschickte Reden und eine zurechtgemachte Erscheinung sind selten Zeichen der Mitmenschlichkeit“ (Konfuzius). Nicht wenige Menschen haben mit der Menschlichkeit nicht nur gute Erfahrungen gemacht: „Wer sich in unserer Gesellschaft menschlich zeigt, unterliegt der Gefahr, ausgenutzt zu werden.“* Deshalb kommt G. Uhlenbruck zu keinem erfreulichen Ergebnis: „Mensch zu sein, das ist heute ein Risikofaktor.“ In anderer Sicht wird Menschlichkeit vorgetäuscht, aber nicht dementsprechend gehandelt: „Sie trinken heimlich Wein. Und predigen öffentlich Wasser“ (H. Heine). Die deutsche Lyrikerin R. Bloch folgert: „Wir sind dort verloren, wo die Menschlichkeit ihr Gesicht verliert.“
► Mögliche Synthese mit Oscar Wilde, der liberal reagiert: „Jeder Mensch hat seinen wunden Punkt und erst das macht ihn menschlich.“ Diese Sicht trifft aber nur partiell zu. Die Menschlichkeit wird meistens erst dann zum wirklichen Thema, wenn wir Menschen sie entbehren müssen. Leider verzeichnen wir auch in unserer Gesellschaft eine zunehmende menschliche Kälte und teilweise einen Mangel an Menschlichkeit, beispielsweise wenn Menschen brutal zusammengetreten werden, obwohl sie hilflos am Boden liegen. Die Aggressionen von Menschen kommen hier an eine Schmerzgrenze.163 „Was nutzt das Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Würde des Menschen, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden? Um der Menschlichkeit wieder mehr Geltung zu verschaffen, dürfen wir alle nicht müde werden, durch eigenes Vorbild und bewusstes und zielgerichtetes Verhalten gegen die Unmenschlichkeit anzugehen.“* Und wir stellen resignierend fest: „Solange Menschlichkeit nur von den anderen gefordert wird, wird das nichts.“* Außerdem: „Ohne den konsequenten Kampf gegen die sozialen Missstände in unserem Landes werden wir das Böse nicht in den Griff bekommen, zumal die Untugenden immer stärker vorankommen.“* Vor allem: „Menschlichkeit bedeutet Herzenswärme.“* Zum Schluss noch die Erkenntnis: „Jeder Mensch ist verdammt, bis in ihm die Menschlichkeit erwacht“ (W. Blake).
2.5 Untugenden des Menschen
Eine Untugend ist im Gegensatz zur Tugend die mangelnde Gesinnung eines Menschen. * Untugenden sind Laster, also die das übliche Maß überschreitenden Gewohnheiten, Neigungen und Willensrichtungen.164 Untugenden äußern sich in schlechten Angewohnheiten von Menschen und werden deshalb als für den Einzelnen und für die Gemeinschaft als schädlich angesehen. Was als Untugend bzw. als Laster angesehen wird, ist in hohem Maße von der Meinung innerhalb einer Gesellschaft abhängig. Beispiele für Untugenden sind Wollust, Zorn, Lüge, Eitelkeit, Geiz, Faulheit, Neid und Stolz.165 In der Welt des geisteswissenschaftlichen Universums sollten wir die Untugenden zwar kennen, aber zu meiden versuchen. Auch die Untugenden werden in dialektischer Sicht vorgestellt.
2.5.1 Stolz
Der Stolz bezeichnet das stark ausgeprägte Selbstwertgefühl eines Menschen. Die Ausprägungen des Stolzes reichen von der positiven Interpretation als berechtigte Freude über eine eigene Leistung (z. B. über einen erfolgreichen Studienabschluss) oder stolz auf einen Freund zu sein, bis hin zu negativer Wertung als übertriebenes Selbstbewusstsein, z. B. Hochmut, Eitelkeit, Hochnäsigkeit, Arroganz, Prahlerei, Überheblichkeit und Narzissmus.166 Der Stolz zählt als Untugend zu den 7 Todsünden. „Der Stolz ist vielfach gleich, verschieden sind nur die Mittel und die Art, ihn an den Tag zu legen“ (La Rochefoucauld). Der Stolz kann auf sich selbst, aber auch auf gesellschaftliche Anerkennung ausgerichtet sein. Er zeigt sich in Gebärden und Gesten, z. B. in einer aufrechten Körperhaltung (positiv) bzw. wenn „die Nase hoch getragen wird.“ Gibt es Zusammenhänge zwischen Stolz und Arroganz? „Arroganz entsteht, wenn der persönliche Erfolg schneller wächst als die eigene Persönlichkeit.“ (S. Kühne). „Arroganz ist die Karikatur des Stolzes“ (E. Freiherr von Feuchtersleben). Dagegen ist Selbstachtung eine positive Pflicht, um das Wertvolle zu erhalten und das Unwürdige zu entfernen. „Wird Stolz sich seiner bewusst, so ist er Eitelkeit“ (W. Rathenau). Das Gegenteil von Stolz ist Demut. „Man kann nicht früh genug die Erfahrung machen, wie entbehrlich man in der Welt ist“ (J.W. von Goethe). Demgegenüber gibt es leider auch den falschen Stolz: „Mancher ertrinkt lieber, als dass er um Hilfe ruft“ (W. Busch). Hochmut ist schwierig zu bekämpfen. Hier ist Selbsterkenntnis nötig. Hilft es, Bescheidenheit dagegenzusetzen? „Oft täuscht man sich, wenn man glaubt, durch Bescheidenheit den Hochmut bezwingen zu können“ (N. Machiavelli). Wie zeigt sich der Stolz?
► Der Stolz zeigt sich im Selbstwertgefühl des Menschen: „Stolz kommt von innen, er ist die direkte Hochschätzung unserer selbst“ (A. Schopenhauer). „Der Stolz ist die berechtigte Freude darüber, etwas Besonderes geleistet zu haben“ (unbekannt). Auf seine Höchstleistungen kann der Mensch stolz sein. Mancher lebt aber mit seinem Stolz in einer anderen Welt: „Traumprinzen wohnen in Luftschlössern“ (A. Adler). Oftmals kommt dann das Erwachen zu spät. Trotzdem muss auch eine Niederlage nicht in Depression enden: „Eine stolz getragene Niederlage ist auch ein Sieg“ (M. von Ebner-Eschenbach). Nach dem Motto: „Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist“ (Sprichwort).
► Demgegenüber sind Hochnäsigkeit und Überheblichkeit Untugenden, die dem Menschen schaden: „Wer von oben herabschaut, ist nicht stolz, sondern arrogant“ (E. Blanck). Noch besser: „Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden“ (Sokrates). Ähnlich: „Dummheit, Stolz und Unverschämtheit sind Blutsverwandte“ (aus Russland). Wogegen müssen wir angehen? „Ärger, Stolz und Neid sind unsere wahren Gegner“ (Dalai Lama). Jeder sollte die Folgen seines Verhaltens durchdenken, denn man kann sehr tief fallen: „Wer abhebt, benötigt einen guten Fallschirm.“* Etwas deftiger: „Ein Esel bleibt immer ein Esel, auch wenn sein Sattel aus feinstem Leder ist“ (aus Türkei). Interessant ist auch die folgende Erkenntnis: „Stolze Menschen hassen Stolz bei anderen“ (B. Franklin). Deshalb verwundert uns nicht: „Unter den Stolzen ist immer Hader“ (Sprüche 13,10). Stolze reagieren oft falsch: „Demütigung beschleicht die Stolzen oft“ (J.W. von Goethe). Zum Schluss: „Der Stolze verzehrt sich selbst“ (Ch. W. von Gluck).
► Fazit: Der wirklich Erfolgreiche weiß: „Wer stolz auf sich selber ist, braucht wenig Komplimente“ (A. Marti). Auch gilt: „Ein stolzer Mensch verlangt von sich das Außerordentliche, ein hochmütiger schreibt es sich zu“ (M. von Ebner-Eschenbach). Es stimmt auch: „Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz“ (Sprichwort). Sie schaden uns: „Stolz ist das Haupthindernis auf dem Wege der Entwicklung“ (Dalai Lama). Geltung, Ansehen und Macht werden zur Bedrohung, wenn das Geltungs- und Machtstreben ausartet. Und es gilt: „Zu viel Stolz lässt kaum Platz für Weisheit“ (C.K. Rath). „Wer aus Geltungssucht zum Streber wird, denkt nur an seine Karriere und schiebt alles beiseite, was ihm im Wege steht. Er ist sogar bereit, seinen Glauben und seine Religion aufzugeben, wenn er dadurch sein Ziel erreichen kann“ (Auszug aus dem Katholischen Katechismus für Erwachsene). Merke: „Den Stolz hat Gott noch stets vernichtet und Demut immer aufgerichtet“ (K.L. Immermann). So mancher Hagestolz täuscht sich enorm:
„Manche Hähne glauben,
dass die Sonne ihretwegen aufgeht“
(T. Fontane)
Dazu Goethe: „Wie gerne säh ich jeden stolzieren, könnt er das Pfauenrad vollführen.“ Und: „In Wirklichkeit ist vielleicht keine unserer natürlichen Leidenschaften so schwer zu überwinden wie der Stolz“ (B. Franklin). Zum Nachdenken: „Wer über die Verächtlichkeit des Ruhmes Bücher schreibt, wird es trotzdem nicht versäumen, seinen Namen auf das Titelblatt zu setzen“ (Cicero).167 Freiherr von Knigge äußert dazu folgende edle Wünsche: „Ich möchte gern, dass man Stolz als eine edle Eigenschaft der Seele ansähe; als ein Bewusstsein wahrer innerer Erhabenheit und Würde; als ein Gefühl der Unfähigkeit, niederträchtig zu handeln.“ Zum Schluss sucht Albert Schweitzer den wissenschaftlichen Bezug: „Die Wissenschaft, richtig verstanden, heilt den Menschen von seinem Stolz, denn sie zeigt ihm seine Grenzen.“168 Oder in anderer Sicht: „Je größer der Mann, desto geringer der Stolz“ (C.F. Hebbel).