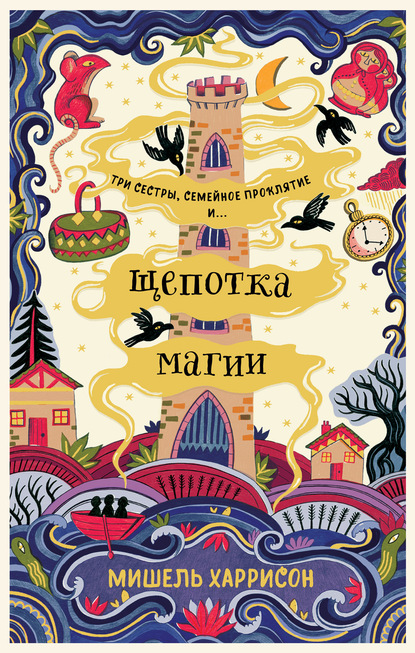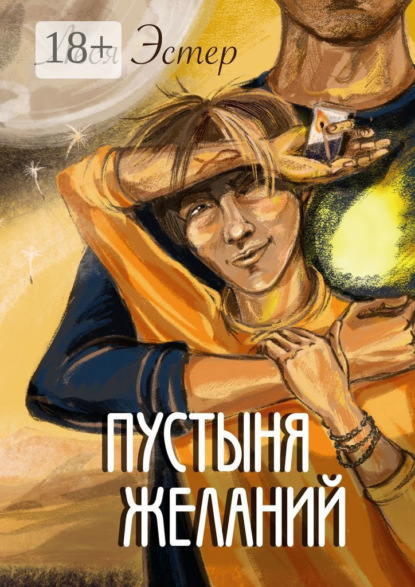Dialektik des geisteswissenschaftlichen Universums
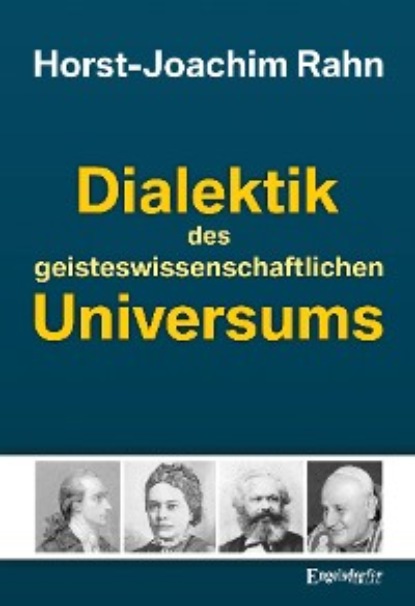
- -
- 100%
- +
„Wenn der Geist jung ist, spielt das Alter keine Rolle“
(Ralf S. Kassemeier)
In der Praxis unterscheiden wir große und kleine Geister: „Ein kleiner Geist will nur glauben, was er sieht“ (F. de La Rochefoucauld). Auch gilt: „Je kleiner der Geist, umso größer die Einbildung“ (Aesop). Ohne Frage ist großer Geist mit schöpferischer Intelligenz verbunden. „Genialität beginnt dort, wo man den normalen Geist aufgibt“ (M.M. Jung). Aber wir müssen einschränken: „Ein geistreicher Mann ist nur etwas wert, wenn er Charakter hat“ (N. Chamfort). Zum Schluss: „Unser Geist muss offen, kritisch und kreativ sein, wenn wir unsere Chancen nutzen wollen“ (Jürgen Witt).81
2.2.1 Denken
Das Denken ist jedes aktive kognitive Verhalten des Menschen. Damit ist es ein wesentliches Elemente des psychischen Systems Geist. Denken prägt den Verstand als Fähigkeit bzw. Tätigkeit, sich mit einer Menge von Informationen über Wirklichkeiten auseinanderzusetzen, sie zu bestimmten Zwecken zu unterscheiden und mit Informationen zu vergleichen, zu werten, zu ordnen und zu speichern. Das Denken ist auch mit Problemlösen verbunden.82 Aber einschränkend: „Das Bedenklichste in unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir noch nicht denken.“83 In das, was Denken heißt, gelangen wir, wenn wir selbst denken lernen. Denken ist also mit Lernen verbunden.84 „Wer selber denkt, hat Heimvorteil“ (M. Rumpf). Aber bedauerlich ist: „Leider lernt der Mensch Denken immer als Letztes“ (W. Fürst). Übertreiben sollte man es aber auch nicht: „Wer ständig denkt, wird zum Thinkoholic“ (H.J. Quadbeck-Seeger). Wie ist das Denken als Teil des menschlichen Geistes dialektisch zu beurteilen?
► These: „Das Denken macht die Größe des Menschen aus“ (B. Pascal). Außerdem gilt: „Denken ist des Menschen bestes Teil“ (H. Ibsen). „Gedanken leben vom Denken“ (M. Hinrich). „Das Denken ist die Arbeit des Geistes, die Träumerei seine Lust“ (V.M. Hugo). Weltberühmt ist der folgende Ausspruch:
„Ich denke, also bin ich“
(René Descartes)
Descartes war zunächst Soldat und entwickelte sich zu einem exzellenten Mathematiker. Er hasste es, wenn er zu früh geweckt wurde, weil er morgens gern lange ausschlief.85 Aufgrund seiner Intelligenz erfreute er sich großen Ruhmes, doch sein tiefes Misstrauen und seine Arroganz machten ihn empfindlich gegenüber jeder Kritik.86 Hier bewahrheitet sich wieder meine Erkenntnis: „Sehr kritische Menschen vertragen selbst überhaupt keine Kritik.“* Bescheiden meint demgegenüber L.A. Seneca: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Der mallorquinische Philosoph und Theologe Raimundus Lullus fand: „Denken macht durstig … und wer Durst hat, kann nicht denken.“87 Zum Denken sollte man sich die Zeit nehmen: „Man kann nicht denken, wenn man es eilig hat“ (Platon). „Nur wer viel allein ist, lernt gut zu denken“ (W. Ronsels). Deshalb sage ich: „Denken blüht in der Stille.“* S. Graff meint dazu: „Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als den Menschen zum Nachdenken zu bringen.“ Kommt die Bildung vom Lesen? „Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene“ (C. Hilty). Ein bekannter Politiker bekennt: „Man muss einfach reden, aber kompliziert denken, und nicht umgekehrt“ (F.J. Strauß). Typisch ist der folgende Ausspruch von Thomas Gottschalk: „Ich habe eine große Klappe und kann schnell denken.“ Zum Schluss: „Wer mundfaul ist, kann trotzdem denkfleißig sein!“*
► Antithese: „Manchmal bezweifle ich, dass das Denken wirklich ein Vorteil ist“ (D. Wieser). Denn: „Denken heißt zerstören“ (F. Pessoa). Und: „Manchmal ist das Denken eine Plage“ (A. Merbach). Dann wundert es uns nicht: „Denken macht einsam“ (P. Rudi). „Auch das Denken schadet bisweilen der Gesundheit“ (Aristoteles). Zum Verhältnis Sein und Denken: „Denken und Sein werden vom Widerspruch bestimmt“ (Aristoteles). Denken ist mit Logik verbunden, aber: „Scharfkantiges Denken eckt an“ (H.J. Quadbeck-Seeger). Auch Gefühl ist nötig: „Unsere Gedanken beginnen zu welken, sobald ihnen die Sonnenstrahlen des Herzens fehlen“ (D. Mühlemann). Und es gilt: „Denken, ohne zu zweifeln ist Schwärmerei“ (H.J Quadbeck-Seeger). Leider: „Jeder akzeptiert nur die Zusammenhänge, die er überschaut“ (M. Richter). „Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt“ (E.R. Hauschka). Verblüffend ist: „Bei manchen Köpfen steigt beim Denken so viel Rauch auf, dass die Umgebung total vernebelt wird“ (T. Zölffel). Ein Top Manager muss es wissen: „Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt“ (A. Herrhausen).
► Synthese: Das logische Denken prägt insbesondere den Verstandesmenschen.88 „Zu einem vollkommenen Menschen gehört die Kraft des Denkens, die Kraft des Willens und die Kraft des Herzens“ (L. Feuerbach). Aber: „Wir lieben die Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken, vorausgesetzt, sie denken dasselbe wie wir“ (M. Twain). Ein berühmter französischer Staatsmann plädiert für das Handeln, vor allem, wenn die Zeit gekommen ist:
„Nimm dir Zeit zum Nachdenken, aber wenn die Zeit zum Handeln gekommen ist, dann höre auf nachzudenken und handle“
(Napoleon Bonaparte)
„Das Denken ist als Arbeit des Geistes etwas Wunderbares, vor allem, wenn es zum Erfolg führt.“* „Zum Denken sind wenige Menschen geneigt, obwohl alle zum Rechthaben“ (A. Schopenhauer). „Denken ist schwer, darum urteilen die meisten“ (C.G. Jung). Vieles wiederholt sich: „Alles ist schon gedacht worden, man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken“ (J.W. von Goethe). Wir wissen: „Das Denken ist keine Massenveranstaltung“ (R. Walden). Denken ist manchmal Wahnsinn: „Je näher man dem Wahnsinn kommt, desto besser versteht man die Wirklichkeit“ (D. Mühlemann). Und zum Schluss sollten wir auch im Rahmen der Betrachtungen des Denkens nie vergessen: „Der Mensch denkt, Gott lenkt!“ (unbekannt).
2.2.2 Vernunft
Die Vernunft ist die geistige Fähigkeit des Denkens eines Menschen, nämlich in konkreten Fällen zu erkennen, aus welchen Gründen etwas geschieht und welche Folgen abzuleiten sind. Die Vernunft ist einerseits als theoretische Art (als sinnliche Wahrnehmung) und andererseits praktisch als Orientierung des Handelns zu sehen. „Vernünftig ist, was mit Verstand geschieht.“* Außerdem: Vernunft ist eng mit Kritik verbunden.89 Die Vernunft wird aber nicht einheitlich bewertet.
► Es gibt zur Vernunft viele Meinungen: „Die Vernunft unterscheidet uns Menschen von Tieren.“* „Einsicht ist der erste Schritt zur Vernunft“ (S. Gönül). „Durch Vernunft, nicht durch Gewalt, soll man Menschen zur Wahrheit führen“ (D. Diderot). „Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünftig fragen“ (J.W. von Goethe). Rudolf Walter Leonhardt betont folgende pro-Argumente zur Vernunft: Wo die Vernunft nicht in höhere Vernunft abhebt, leistet sie einiges. Wenn wir selbst unsere Interessen durchboxen und gegen eine allgemeine Vernunft handeln, dann spüren wir, dass es eine solche gibt. Auch wer überall nur Unvernunft zu entdecken meint, setzt damit eine Norm, die Vernunft heißt. Die Vernunft ist der größte Hauptnenner der Menschheit (z. B. gegen den Atomtod). Zum Schluss: Ohne Vernunft gäbe es die Wissenschaft nicht.90
► „Der Mensch ist vielerlei, aber vernünftig ist er nicht“ (O. Wilde). „Vor allem ökonomische Interessen können die Vernunft am Gängelband führen.“* „Fast nie kommt der Mensch aus Vernunft zur Vernunft“ (C. de Montesquieu). „Wo der Mut keine Zunge hat, bleibt die Vernunft stumm“ (J. Müller). „Kein Vormarsch ist so schwer wie zurück zur Vernunft“ (B. Brecht). „Mit unserer Vernunft ist es so weit nicht her: was vermag sie gegen die Liebe?“ (unbekannt). Und vor allem: „Die Vernunft ist des Herzens größte Feindin“ (G. Casanova). Auch: „Gegen Emotionen hat die Vernunft kaum eine Chance.“* Interessant: „Wer sich ständig von der Vernunft leiten lässt, ist nicht vernünftig“ (Ch. Tschopp). Ähnlich: „Vielleicht ist es unvernünftig, immer vernünftig zu sein.“ (S. Rogal). „Wenn man sich von der Vernunft lange genug leiten lässt, kommt man zu ganz unvernünftigen Schlussfolgerungen“ (S. Butler). Auch die „großen“ Philosophen konnten nicht einheitlich klären, was „vernünftig“ ist.91
► Ein Fazit zieht Grillparzer: „Die Vernunft ist der durch die Phantasie erweiterte Verstand.“ Wir Menschen haben aber mitunter unsere Probleme mit der Vernunft. Die Vernunft ist wohl auch nicht die Schaltzentrale unseres Verhaltens. Deshalb kommen Wissenschaftler zu dem folgenden Ergebnis:92
„Der klare Verstand als zentrales Merkmal des menschlichen Handelns ist eine Fiktion“
(Richard David Precht)
Die wichtigsten Impulse unseres Verhaltens kommen nicht aus dem Großhirn – dem Sitz der Vernunft, sondern sie kommen aus unserer Gefühlszentrale im Zwischenhirn. J.J. Rousseau meint dazu: „Die Vernunft formt des Menschen, das Gefühl leitet ihn.“ Als Vordenker in der Zeit der Aufklärung war Rousseau überall in Frankreich bekannt. Er war zu einem kleinen Waldgasthaus gewandert und er merkte, dass die Leute wieder einmal über ihn tuschelten. „Das ist der Lohn meines Ruhmes“, brummelte er vor sich hin und setzte sich an einen freien Tisch. Ein älteres Weib wagte sich an seinen Tisch und fragte: „Sind sie nicht der bekannte Philosoph Voltaire?“ „Nein, Madame! Der bin ich nicht!“ knurrte Rousseau. Dennoch ließ die Frau nicht von Rousseau ab, der in Ruhe gelassen sein wollte und nun bereits etwas unwirsch reagierte. Endlich kam der Wirt mit dem Wein: „Madame!“ sagte er tadelnd zu der Frau: „Wisst Ihr denn nicht, wer dieser Herr ist? Es ist der vortreffliche Diderot, Frankreichs Stolz und unter den Lebenden unser gewaltigster Philosoph.“93
2.2.3 Verstand
Der Verstand ist die Fähigkeit des Menschen, durch das Denken, Bedeutungen, Beziehungen und Sinnzusammenhänge zu erfassen und zu erschließen.94 Deshalb die Folgerung: „Der Mensch sollte sich immer darum bemühen, vernünftig zu handeln.“ Der kategorische Imperativ fordert: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ (E. Kant). Also postulieren wir mit Kant: „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ Auch gilt: „Der Verstand steht als schlussfolgerndes Denken“ (Aristoteles) in enger Beziehung zur Vernunft. Folge deshalb dem guten Rat eines weisen Menschen:
„Lass die Zunge nicht dem Verstand vorauseilen“
(Chilon aus Sparta)
► „Verstehen setzt einen Verstand voraus“ (E. Klepgen). Aber: „Menschenverstand ist viel seltener als man denkt“ (Friedrich der Große). „Derer sind wenige, die Verstand haben“ (Dante). „Wer großen Verstand hat, weiß viel“ (L. de Vauvenargues). „Wo Verstand ist, braucht es nicht viele Worte“ (Sprichwort); denn: „Verstand zeigt sich im klaren Wort“ (Euripides). G. Klopstock geht noch weiter: „Verstand ist ein Edelstein, der am schönsten glänzt, wenn er in Demut gefasst ist.“ Und es gilt: „Horizont ist keine Frage der Größe“ (H. Lahm). „Immer etwas Schönes zu ersinnen, ist die Gabe eines göttlichen Geistes“ (Demokrit). Daraus entsteht die weitere Folgerung: „Möge Gott dir gesunden Menschenverstand geben“ (irischer Spruch).
► Verstand kann aber mitunter auch hinderlich sein: „Verstand hemmt die Spontaneität“ (Querulix). Auch: „Der Verstand schützt uns nicht vor Launen“ (Vauvenargues). „Nicht jeder, der Verstand hat, hat auch Verständnis“ (H. Lahm). Ähnlich: „Wo Verständnis fehlt, hat es der Verstand schwer“ (K.W. Dickhöfer). Interessant sind Zusammenhänge zwischen Gefühl und Verstand: „Ohne den Verstand würde das Gefühl mitunter ausufern.“* Stärker ausgedrückt: „Der Verstand ist die Zwangsjacke unserer Gefühle“ (P. Sereinigg). „Wo unser Verstand aufhört, beginnt unser Herz“ (A. Maggauer-Kirsche). Ähnlich: „Manchmal versteht das Herz mehr als der Verstand“ (J.M. Kulmer). „Das Herz kennt Gründe, von denen der Verstand nichts weiß“ (Pascal). Das Verhalten von Menschen hängt auch vom Kopf ab: „Leere Köpfe verlieren ihren Verstand viel leichter“ (M.G. Reisenberg). Und: „Mit dem Kopf durch die Wand, deutet auf wenig Verstand“ (E.H. Bellermann). Resignierend, aber wahr: „Es gibt so weniges, worüber wir richtig urteilen“ (L. de Vauvenargues). Zum Nachdenken: „Das Unbegriffene verbirgt das Unbegreifliche.“ (S. Weil).
► Fazit: Gefühle, Spontaneität, Launen und Eitelkeit wirken zuweilen dem Verstand entgegen. „Wo die Eitelkeit anfängt, hört der Verstand auf“ (M. von Ebner-Eschenbach). Auch: „Wo Verstand befiehlt, ist Gehorsam leicht“ (Th. Fontane). „Ohne Verstand ähnelt der Kopf einem leeren Topf“ (aus Spanien). Der Verstand lässt sich treffend anhand des Verstandesmenschen erklären:95 Er zeichnet sich durch logisches Denken, seine Vernunft, seine Abstraktionsfähigkeit und durch sein scharfsinniges Urteil aus. Dabei verbindet er logische Denkarbeit mit einem guten Gedächtnis. Aber: „Das Gefühl ist nicht die Stärke des Verstands.“* Und: „Das Gefühl versteht, was der Verstand nicht begreift“ (Bonaventura). Auch: „Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt“ (B. Pascal). Außerdem: „Der Verstand und die Fähigkeit, ihn zu gebrauchen, sind zwei verschiedene Gaben“ (Grillparzer). Aber: „Je weniger Verstand einer hat, umso weniger merkt er den Mangel“ (aus Großbritannien). Und: „Nicht alles, das man nicht versteht, muß deshalb gleich falsch sein“ (K.W. Dickhöfer). Interessant: „Der Blick des Verstandes fängt an scharf zu werden, wenn der Blick der Augen an Schärfe verliert“ (Platon). Zum Schluss das treffende Zitat von Wilhelm Hey: „Verstand und Witz kann leicht entzücken, doch fesseln kann allein das Herz.“ Diesen schönen Satz habe ich 1974 meiner Isolde in das Album zu unserer Hochzeit geschrieben.
2.2.4 Gefühl
Das Gefühl ist ein Gestimmtsein, das sich im Fühlen des Menschen ausdrückt und mit Sensibilität verbunden ist. Wir Menschen erleben alles, was uns fördert als Wert und alles, was uns hemmt als Unwert. Diese Erlebnisse heißen Gefühle.96 Das Gefühl ist ein Grundphänomen des Erlebens einer Erregung (Spannung) oder Beruhigung, z. B. Entspannung. Es wird mehr oder weniger von Lust oder Unlust begleitet. Menschen haben negative Gefühle, wie Angst bzw. Ärger und positive Gefühle, wie beispielsweise Freude und Liebe. Gefühle sind mit Affekten, Emotionen und Empfinden verbunden.97 Gemütsbewegungen im Sinne eines Affekts sind Emotionen, mit denen sich die Emotionspsychologie beschäftigt.98 Wie erkennt man Gefühle? Sie lassen sich z. B. in Gesichtern ablesen.99 Ein Individuum, das sich in seinem Handeln stark von seinen Gefühlen leiten lässt, ist ein Gefühlsmensch (s. unten).
► „Das Gefühl ist die lebendige Mutter des gesamten Geisteslebens“ (F.T. von Vischer). „Insbesondere Menschen, die sich lieben, werden vom Gefühl getrieben“ (F. Ammon). „Nichts richtet das Gemüt so auf, wie das Gefühl, geliebt zu sein“ (Th. Fontane). „Nur das Gefühl versteht das Gefühl“ (H. Heine). „Das höchste aller Gefühle für einen Menschen ist, dass er anerkannt und geschätzt wird“ (unbekannt). Und es ist nachweisbar: „Einfühlungsvermögen ist der Reichtum unseres Herzens“ (Almut Adler). „Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden“ (C. Spitteler). Auch gilt: „Für die Sprache des Herzens braucht es keinen Duden“ (A. Marti). Papst Benedikt XVI sagte etwas, was man so nicht erwarten konnte: „Mein Herz schlägt bayerisch.“ „Welch eine himmlische Empfindung ist es, seinem Herzen zu folgen“ (J.W. von Goethe). „Kein Gefühl ist gleich dem Gefühl der Zufriedenheit“ (K. Eisenlöffel). Und: „Ein großes Gefühl braucht Raum für Ausschweifungen“ (E. Ellinger). Zum Schluss: „Die wichtigste Energiequelle unseres Lebens ist und bleibt die menschliche Wärme“ (E. Ferstl).
► Die andere Seite des Gefühls lässt sich so ausdrücken: „Wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid“ (Leonardo da Vinci). Ähnlich: „Jedes schöne Gefühl hat seine Tränen“ (L. Bechstein). Wenn wir Gefühl und Verstand vergleichen, kommen wir zu folgendem Ergebnis: „Das Gemüt hat mehr Mängel als der Verstand“ (F. de la Rochefoucauld). Vor allem: „Autorität, wie Vertrauen werden durch nichts mehr erschüttert, als durch das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden“ (Th. Storm). „Auch in einem Rolls-Royce wird geweint, vielleicht mehr als in einem Bus“ (F. Sagan). Wie zeigen sich Gefühle? „Die Gefühle offenbaren sich umso weniger, je tiefer sie sind“ (H. de Balzac). „Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht“ (F. von Schiller). Nicht nur für Musiker gilt: „Wer zart besaitet ist, kann nie die erste Geige spielen“ (G. Uhlenbruck).
► Zusammenfassend erkennen wir: „Unsere Gefühle sagen mehr als tausend Worte“ (G. Kropp). Das Gefühl lässt sich am Verhalten eines Gefühlsmenschen100 erklären. Dieser gibt sich ganz seinen Werterlebnissen hin. Er ist durch seine leichte Gefühlsansprechbarkeit und den oft raschen Wechsel der Stimmungslage gekennzeichnet. Der Gefühlvolle ist verständig und einfühlsam (z. B. gutes Empfinden für Musik), gutmütig und interessiert, entscheidet oft „aus dem Bauch heraus“, hat eine reiche Phantasie und neigt zu Kompromissen. Dazu passt die folgende Feststellung eines klugen Kopfes:
„Die großen Gedanken kommen aus dem Herzen“
(Vauvenargues)
Der Gefühlsmensch kann sich in andere Menschen hineinversetzen und kann ihnen wirksamen Zuspruch geben. Wir folgern: „Gefühlvolle Menschen haben ein Herz für andere. Menschen ohne Gefühl verstehen andere kaum.“* Nachteilig kann sein, dass dem Gefühlsmenschen manchmal die Konzentration bzw. das logische Denken abhanden kommen. Denn: „Denken und Empfinden sind von Natur aus verschieden“ (Aristoteles). Nicht selten lässt sich der Gefühlsmensch von anderen Menschen stärker beeinflussen als andere. Außerdem ist er sehr empfindsam und auch die Tränen fließen schneller als bei den mehr zum Denken neigenden Menschen.
2.2.5 Wollen
Das Wollen ist das Streben des Menschen, das sein Handeln leitet. Es ist die Fähigkeit, sich auf Grund von Motiven und in bewusster Stellungnahme zu ihnen für Handlungen zu entscheiden, im Unterschied zu Trieb, Instinkt und Begehren. Zu einem vollständigen Willensvorgang gehören das Motiv, das eigentliche Wollen und die Verwirklichung des Gewollten. Wille entzündet sich nur am Antrieb und kann mit hoher Beharrlichkeit verbunden sein. Zum Willen gehört nicht nur das Umsetzen von Entschlüssen durch Handeln oder Willensäußerung.101 Auch das Unterlassen einer Handlung kann eine Willensverwirklichung sein. Der Wille hat seine positiven, aber auch seine negativen Seiten.
► „Des Menschen Wille ist sein Himmelreich“ (Sprichwort). „Der Wille ist der Antrieb des Menschen zur Zielerreichung.“* Auch: „Der Wille ist der Ursprung aller Taten“ (F. Schmidberger). „Der gute Wille ist das Kostbarste im Menschen“ (Fénélon). „Guter Wille und gute Tat sind die Eltern des Glücks“ (Sprichwort). Auch folgendes ist Ausdruck des Wollens: „Ich lasse nicht locker“ (R. Koch). Konfuzius sagt: „Wenn der Wille auf das Gute ausgerichtet ist, gibt es nichts Böses.“ Ebenfalls: „Der Wille öffnet die Türen zum Erfolg“ (L. Pasteur). „Mut und Wille ergeben manchmal Mutwillen“ (W. Busch). Und: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ (Sprichwort). Ähnlich: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch“ (J. Eberwein). Zum Schluss: „Wenn der Wille da ist, sind die Füße leicht“ (aus England).
► Die andere Seite zeigt sich in folgender Erkenntnis: „Des Menschen Wille ist seine Hölle“ (W. Busch). Das zeigt sich nicht selten bei Zerwürfnissen: „Streit fängt dort an, wo der gute Wille aufhört“ (F. Ammon). Manchmal muss man ab und zu geben: „Der unbedingte Wille ist vor allem in der Liebe absolut tödlich“ (P. Rudi). „Schlecht kämpft der Wille gegen stärkeren Willen“ (Dante). Und: „Aufgeben heißt, am eigenen Willen gescheitert zu sein“ (B. Stramke). „Wo der Mut fehlt, fehlt der Wille“ (A. Selacher). „Den Menschen fehlt nicht die Kraft, es fehlt ihnen der Wille“ (V. Hugo). Auch Ziele sind bedeutsam: „Wo Ziele fehlen, irrt der Wille umher“ (H.J. Quadbeck-Seeger). Ein zu starker Wille ist gefährlich: „Beharrlichkeit ist eine gute Sache, solange sie nicht in Sturheit gipfelt“ (E. von Ostheim). „Je heftiger man nach etwas strebt, desto weiter kommt man von Ziel ab“ (Lu Bu We). Für manchen ist es einfach: „Der hat alles, der nichts will“ (Sprichwort). Auch gilt: „Es lacht mancher, der beißen will“ (Sprichwort). „Im Willen liegt die Schuld, nicht in der Tat“ (E.B.S. Raupach). Zum Schluss: „Manche müssen durch Nachgeben ihren Willen durchsetzen“ (P. Sirius).
► Fazit: „Einerseits ist des Menschen Wille sein Himmelreich, andererseits seine Hölle“*: Es kommt also darauf an, in welcher Weise der Mensch seinen Willen gebraucht. Der Wille ist dauernd auf die betreffende Zielvorstellung eingestellt. Das Handeln ist die Wirkung eines Willensentschlusses nach außen. Ohne Streben gibt es kein Wollen: Dieses ist anhand des Willensmenschen102 gut erklärbar: „Der Willensmensch verfolgt seine persönlichen Ziele beharrlich, manchmal pedantisch, mitunter ausdauernd und mit großen Betätigungsdrang. Bisweilen kommt es bei ihm zu Ausbrüchen, wenn es bei der Zielerfüllung nicht vorangeht.“*
„Wenn dein Wille nicht will, wird dein Wollen nicht können
und das Können nicht dürfen“
(P.E. Schumacher)
„Der Mensch muss nichts wollen, aber wenn er will, dann muss er“ (unbekannt). „Ich kann, weil ich will, was ich muss“ (I. Kant). Und auch: „Ein williges Pferd soll man nicht zuviel reiten“ (M. Luther). Oder: „Wer will, der kann und wer nicht kann, der soll nicht wollen“ (M. Genin). Vor allem: „Man darf nichts Unmögliches wollen“ (I. von Loyola). Merke eine wahre Erkenntnis zur Lebensbewältigung: „Du sollst nicht wollen, was du nicht kannst“ (F. Ammon).
2.2.6 Wissen
Das Wissen umfasst einerseits als Alltagswissen allgemein verfügbare Orientierungen alltäglicher Sach- und Handlungszusammenhänge. Andererseits sind es umfassende Kenntnisse als vernetzte Informationen aus den verschiedenen Wissenschaften103, z. B. ein verfügbarer Bestand von Fakten, Theorien und Regeln. Dabei wird von der Gültigkeit bzw. von der Wahrheit des Wissens ausgegangen. Es gibt also Alltagswissen und Spezialwissen. Konfuzius erklärt das Wissen auf seine Weise: „Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen.“ Im Grunde gibt es drei Wege zum Wissen: Die Selbsterfahrung, eigenes Handeln und die Fremderfahrung.104 Das Wissen ist als grundlegender erkenntnistheoretischer Begriff Gegenstand philosophischer Diskussionen. Trotzdem gilt leider: „Wir lernen viel und wissen wenig“ (C.L. von Knebel). Auch die Wissenschaft hat ihre Grenzen.105 In eine ganz andere Richtung wurde festgestellt: „Die Wissenden reden nicht viel. Die Redenden wissen nicht viel“ (unbekannt). Und es gilt: „Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen – man muss auch tun“ (J.W. von Goethe).