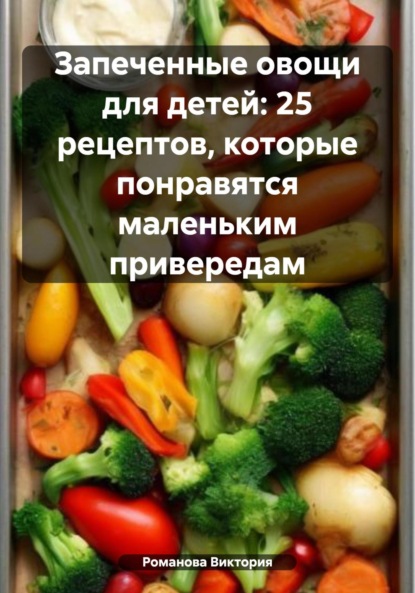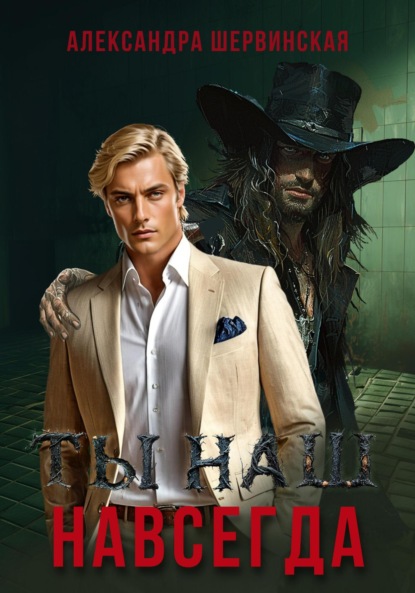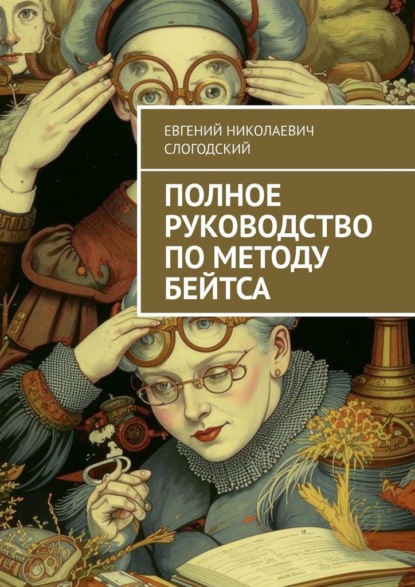Dialektik des geisteswissenschaftlichen Universums
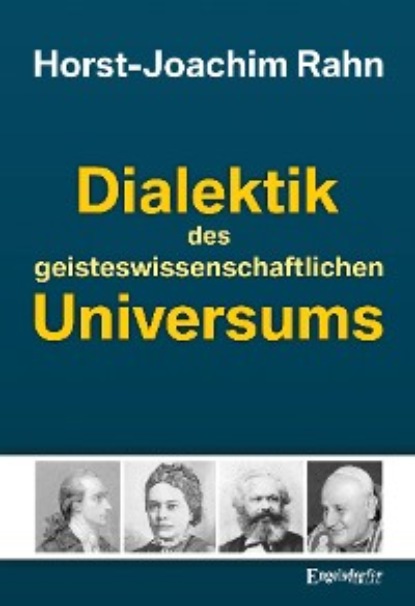
- -
- 100%
- +
► Was lernen wir nun daraus? „Wer aus Übermut alles umrennt, wird scheitern.“* Merke vor allem: „Der Mutige landet eher am Haken.“* Aber wer im Leben nichts wagt und überall ängstlich ist, der gewinnt ebenfalls nichts. „Wer nie über seine Grenzen geht, bleibt immer unter seinen Möglichkeiten“ (M. Knecht). Vor allem die nächste Generation wird zur Lebensbewältigung im sich immer mehr wandelnden geisteswissenschaftlichen Universum viel Mut und auch Gelassenheit brauchen: „Ob du Mut hast, erkennst du, wenn du in Not bist!“ (P.E. Schumacher). Reinhold Niebuhr hat sich sehr treffend zum Zusammenhang zwischen Gelassenheit und Mut geäußert: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Für die nächste Generation, die einiges durchmachen wird, womit sie nicht gerechnet hat, habe ich folgenden, gut gemeinten Rat:
„Um im Leben zu bestehen, braucht der Mensch viel Mut und Zuversicht, denn sonst überlebt er nicht“
(Horst-Joachim Rahn)
Vor allem dürfen wir uns nicht hängen lassen: „Du kannst in jedem Moment neu anfangen, denn der Fehler ist nicht das Hinfallen, sondern das Liegenbleiben“ (M. Pickford). Interessant ist auch die folgende Feststellung: „Wirklichen Mut haben nur die Narren“ (A.F. Galiani). Die folgende Erkenntnis verblüfft: „Als ich mich entschlossen hatte, Mut zu zeigen, waren alle Gegner bereits gegangen“ (A. van Rheyn). Nicht jeder Mensch ist allerdings mutig, was wohl auch mit seinen Genen zusammenhängt. Der Mensch muss aber mit seinen Veranlagungen leben, denn kein Mensch kann aus seiner Haut heraus. Zur konkreten Tat ist der Mut aber eine unabdingbare Voraussetzung: „Sich opfern ist Tat“ (M. Richter). Zum Schluss: „Alles, was Mut macht, ist ein Geschenk des Himmels“ (H. Joost). Und es gilt für uns alle heute der gute Rat: „Schöpfe aus der Vergangenheit Kraft für die Zukunft.“ (J.V. von Scheffel).
2.4.3 Mäßigung
Die Mäßigung ist das Abschwächen extremer Verhaltensweisen von Menschen im Leben, z. B. das Vermeiden von Völlerei, von Zorn, von Geiz und von sexuellen Ausschweifungen. Das Ergebnis der Mäßigung ist die Mäßigkeit. Dazu sind Besonnenheit und Selbstbeherrschung erforderlich. Es gilt, bei unserem Verhalten züchtig131 bzw. genügsam zu sein. Nach Aristoteles steht die Mäßigung zwischen Empfindungslosigkeit (Stumpfheit) und Zügellosigkeit. Im Christentum gilt die Mäßigung als grundlegende Tugend. Der Mangel an Mäßigung ist die Maßlosigkeit. Mein Lieblingsphilosoph Konfuzius wird insbesondere wegen seiner Bescheidenheit verehrt. Er plädierte auch für Mäßigung, die bedeutet Maß zu halten, also jeweils nur so viel zu nehmen, wie man wirklich braucht: also von allem nicht zu viel und nicht zu wenig.
► Wir stellen zunächst fest: „Genügsamkeit ist großer Gewinn“ (aus Indien). „Nur durch die Mäßigung erhalten wir uns“ (J.W. von Goethe). Deshalb der gut gemeinte Rat: „Drum lebe mäßig, denke klug, wer nichts gebraucht, der hat genug“ (W. Busch). Und es gilt auch: „Die Tugend des Glücks ist die Mäßigung“ (F. Bacon). Auf einen einfachen Nenner gebracht bedeutet das: „Wer barfuss geht, den drücken die Schuhe nicht“ (Sprichwort). „Mäßigung und Enthaltsamkeit sind das sicherste Verwahrungsmittel gegen Überdruss und Erschlaffung“ (M. Wieland). Die Folge daraus ist: „Arbeit und Mäßigung halten den Menschen gesund“ (J.J. Rousseau).
► Der Genießer Oscar Wilde kontert: „Mäßigung ist eine verhängnisvolle Sache. Nichts ist so erfolgreich wie der Exzess.“ Auch gilt: „Gelegentliche Ausschweifungen wirken anregend. Sie verhüten, dass Mäßigkeit zur Gewohnheit abstumpft“ (W.S. Maugham). Wir wissen alle: „Im praktischen Leben kommt man leider mit Mäßigung oft nicht weiter:“* „Lauten Forderungen wird leider öfter entsprochen als stillen Bitten“ (H. Lahm). Und: „Durch ständiges Nehmen vergisst man oft das Geben“ (H. Joost). Mancher muss sich erst übergeben, bevor er begreift, was Mäßigkeit bedeutet: „Wer sich den Magen verdorben hat, lobt die Mäßigkeit“ (H. Mardach). Oder: „Abstinenz ist leichter als Mäßigung“ (E. Balser). Auch: „Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr Maß zu halten“ (F.W. Nietzsche). Zum Nachdenken: „Wo Mäßigung ein Fehler ist, ist Gleichgültigkeit ein Verbrechen“ (G.C. Lichtenberg).
► Was sagen uns die Erkenntnisse aus obigen Thesen und Antithesen? „Zu große Mäßigung führt zu schmerzlichen Entbehrungen und unmäßiges Verhalten kann Krankheiten mit sich bringen.“* Deshalb gilt es, das richtige Maß des Verhaltens zu finden. „Maßvoll“ heißt nicht, „bis das Maß voll ist“ (P. Cerwenka). „Trotzdem muss man im Leben ab und zu „ausflippen“ und richtig genießen, ohne dass es in Völlerei ausartet.“* In den meisten Fällen des Übermaßes ist Mäßigung oder sogar Enthaltsamkeit angebracht, mit Ausnahme der Liebe: „Wahre Liebe kennt kein Maß“ (S. Properz). Oder ähnlich: „Das Maß der Liebe ist zu lieben ohne Maß“ (Aurelius Augustinus). Es besteht auch Bezug zur Gesundheit: „Heiterkeit, körperliche Bewegung und Mäßigkeit sind die besten Ärzte“ (F.M. Grimm). Das Prinzip der Mäßigung gilt für groß und klein. Allerdings: „Die Mäßigung der Großen mäßigt nichts als ihre Laster“ (L. de Vauvenargues). Zum Schluss der Rat: „Vergesset nie, dass ohne Mäßigung auch die natürlichsten Begierden zu Quellen des Schmerzes, durch Übermaß die reinste Wollust zu einem Gifte wird, das den Keim eures künftigen Vergnügens zernagt“ (C.M. Wieland).
2.4.4 Dankbarkeit
Dankbarkeit ist eine Tugend bzw. eine Haltung des Menschen in Anerkennung einer erhaltenen positiven Zuwendung. Sie zeigt sich im Dank als der wohlwollenden Erwiderung von empfangener Hilfe oder von anderen Leistungen. Dankbare Menschen fühlen sich subjektiv gesehen besser und sind zufriedener mit ihrem Leben. Dankbarkeit kann sogar glücklich machen132 und hat somit durchaus etwas Mächtiges.133 Die Dankbarkeit setzt voraus, dass der Nehmer einer Wohltat etwas bekommt, was er nicht fordern kann. Von Dank ist das Wort „danke“ abgeleitet. Das Gegenteil von Dank ist der Undank als das Fehlen von Dankbarkeit. Wir wissen aus der Praxis: Viele Menschen sind dankbar, andere leider nicht!
► „Dank und Liebe sind die größten Mächte der Welt“ (F. von Bodelschwingh). Was ist die größte Kraft des Lebens? „Die größte Kraft des Lebens ist der Dank“ (H. von Bezzel). Der deutsche Arzt A. Schweitzer hat im Leben viel Gutes getan. Er postuliert: „Vergiss den Anfang nicht, den Dank. Verschiebe die Dankbarkeit nie.“ Außerdem: „Du sollst dankbar sein für das Geringste, und du wirst würdig sein, Größeres zu empfangen“ (T. von Kempen). Hinzu kommt der Rat, im Leben nicht alles als selbstverständlich zu nehmen: „Gedenke der Quelle, wenn du trinkst“ (aus China). Mit dem Herzen ausgedrückt: „Das Gedächtnis des Herzens heißt Dankbarkeit“ (P. Bosmans). „Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder, sie geben das Empfangene zehnmal zurück“ (A. von Kotzebue). Und ebenfalls treffend: „Dankbarkeit und Weizen gedeihen nur auf gutem Boden“ (Sprichwort). Zum Schluss die These: „Wir sind für nichts so dankbar, wie für Dankbarkeit“ (M. von Ebner-Eschenbach).
► Leider sind nicht alle Menschen dankbar: „Sie bitten zwar inständig, wenn sie aber ihr Ziel erreicht haben, reagieren sie falsch.“* „Die Bitte ist immer heiß, der Dank kalt“ (Sprichwort). Manche Menschen reagieren unverschämt: „Wenn man einem den Finger bietet, nimmt er gleich die ganze Hand“ (Sprichwort). Und vor allem ist weit verbreitet: „Undank ist der Welt Lohn“ (Sprichwort). Anderen Menschen ist Dankbarkeit sogar lästig: „Die Dankbarkeit ist eine Last, und jede Last will abgeschüttelt sein“ (D. Diderot). Manche kommen zu einem ganz anderen Ergebnis: „Die Dankbarkeit der meisten Menschen ist nichts als eine geheime Begierde nach größeren Wohltaten“ (La Rochefoucauld). Es kommt auch auf das Ausmaß der zugrunde liegenden Tat an: „Wer für alles gleich Dank begehrt, der ist selten des Dankes wert“ (J. Trojan). Interessant ist auch der Standpunkt von Ewald v. Kleist: „Wer sich viel über Undankbarkeit beschwert, ist ein Taugenichts, der niemals aus Menschlichkeit, sondern aus Eigennutz andern gedient hat.“ Jetzt wird es deftig: „Wenn die Sonne auf einen Misthaufen scheint, so antwortet er mit Gestank“ (Sprichwort). Und mit Bezug zum Tier: „Wenn die Sau satt ist, stößt sie den Trog um“ (aus Holland). So kommen wir zu dem unbefriedigenden Ergebnis: „Dankbarkeit ist in den Himmel gestiegen und hat die Leiter mitgenommen“ (aus Polen).
► Fazit: „Wer heute für seine guten Taten Dank erwartet, wird leider oft enttäuscht.“* Der Textdichter Lothar Peppel stellt erstaunt fest: „Waren das noch Zeiten, als man den kleinen Finger reichte, und sie einem nur die ganze Hand nahmen.“ „Undank und Unverschämtheiten sind leider heute weit verbreitet. Aber das sollte uns nicht abhalten, auch ohne Dank weiterhin Gutes zu tun.“* Der Journalist Walter Ludin sagte einmal: „Der schönste Dank ist jener, der aus lauter Freude vergessen wird.“ Oder die Meinung von W. Schlichting: „Rechne nie auf Dank und du wirst zuweilen angenehm überrascht sein.“ Ganz anders hat sich Shakespeare in seinem Werk „Was ihr wollt”. (Viola) geäußert: „Ich hasse Undank mehr in einem Menschen als Lügen, Hoffahrt, laute Trunkenheit, als jedes Laster, dessen starkes Gift das schwache Blut bewohnt.“ Ähnlich auch der Ausspruch:
„Ich hasse jeden, dessen Dankbarkeit erlischt“
(Euripides)
Und der Heilpraktiker E. Blanck stellt fest: „Ich erwarte keinen Dank mehr, nur weniger Undank.“ In der Erziehung sollte dem Phänomen des Dankens wieder mehr verpflichtende Beachtung geschenkt werden: „Heute gewinnt man vielfach den Eindruck, als wenn alles selbstverständlich sei und vor allem bei noch jungen Menschen mitunter die Wahrnehmung der Rechte gegenüber den Pflichten dominiere.“* „Wir danken zu wenig und fordern zu viel“ (S. Wittlin). Dennoch: Wir gläubigen Menschen stehen zur zur Dankbarkeit: „Das Gefühl für Dank und Liebe ist die Quelle des Glaubens“ (Pestalozzi).
2.4.5 Vertrauen
Das Vertrauen134 ist die subjektive Überzeugung von der Richtigkeit bzw. Redlichkeit von Personen, von Handlungen anderer Menschen oder auch von sich selbst. Es basiert auf einer Vertrauensgrundlage (z. B. die Vertrauenswürdigkeit eines Freundes oder das gegenseitige Vertrauen der Partner in der Ehe) und ist eine durch Erfahrung bekräftigte Hoffnung auf Erfüllung von erwünschten Gegebenheiten. Es ist ein elementarer Tatbestand des sozialen Lebens.135 C.F. Hebbel äußerte sich dazu so: „Vertrauen ist die größte Selbstaufopferung.“ Dabei wird das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten als Selbstvertrauen136 bzw. als Selbstwertgefühl137 bezeichnet. Das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. M. Gandhi war ein guter Mensch und kommt zu den Ergebnis: „Misstrauen ist ein Zeichen von Schwäche.“ Ist das wirklich so?
► Ein deutsches Sprichwort verdeutlicht: „Vertrauen strahlt Zuversicht und Güte aus.“ Und es galt immer: „Vertraue dem, der dir vertraut ist“ (V. Frank). Obwohl das auch Grenzen hat, wie es Missbrauch mancher Kinder bestätigt. Deshalb sollte man Kinder auf solche Gefahren hinweisen und sie vor zu viel Zutrauen warnen. Wenn die Menschen erwachsen werden, sollte sie aber ihr Leben nicht auf der Basis von Misstrauen verwirklichen. Trotzdem sollte kein Mensch unvorsichtig sein. Für die Liebe gelten sowieso ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Grundsätzlich gilt für wachsende Partnerschaften: „Ohne Vertrauen kann die Liebe nicht wachsen“ (E. Ferstl). Dazu passt: „Vertrauen ist eine Blume, die man zart behandeln muss“ (A. Ritter). „Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat“ (M. Claudius). Und zum Schluss: „Das Vertrauen ist etwas so Schönes, dass selbst der ärgste Betrüger sich eines gewissen Respekts nicht erwehren kann vor dem, der es ihm schenkt“ (M. von Ebner-Eschenbach).
► Demgegenüber meinte W.I. Lenin: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. Auch: „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist menschlicher“ (G. Dunkl). Schlechte Erfahrungen führen zu folgendem Ergebnis: „Hast du gar zu viel Vertrauen, wirst du über’s Ohr gehauen.“* „Das Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es zerstört, kommt es sobald nicht wieder“ (O. von Bismarck). Und es gilt auch: „Wer das Vertrauen hat zerstört, der wird so bald nicht mehr gehört.“* Auch: „Wer damit anfängt, dass er allen traut, wird damit enden, dass er jeden für einen Schurken hält“ (C.F. Hebbel). Alles entwickelt sich: „Vertrauen ist das, was man hat, bevor man die Realität begreift“ (W. Meurer). Und treffend zum Schluss: „Vertrauen ist die Mutter der Sorglosigkeit“ (B.C. y Morales).
► Zusammenfassung: Bei kaum einem Stichwort gehen die Meinungen so weit auseinander wie bei der Beurteilung des Vertrauens, was wohl an den unterschiedlichen Erfahrungen liegt, die die Menschen mit ihm machen. Vertrauen hat ganz unterschiedliche Folgen: „Aus Vertraulichkeit entsteht die zarteste Freundschaft und der größte Hass“ (A.C. de Rivarol). Und es gilt: „Trau keinem, der nie Partei genommen!“ (G. Keller). Es gilt aber auch: „Wer nicht genügend vertraut, wird kein Vertrauen finden“ (Laotse). Vor allem Freundschaft basiert auch auf gegenseitigem Vertrauen:
„Die Freundschaft ist das edelste Gefühl,
dessen das Menschenherz fähig ist“
(Carl Hilty)
„Ich weiß, dass ich jemanden in meiner Nähe habe, dem ich rückhaltlos vertrauen kann, und das ist etwas, was Ruhe und Kraft gibt“ (E. Stein). Der folgende Ausspruch von König Ludwig II. von Bayern verdeutlicht, dass man vor allem zu einem engen Freund Vertrauen haben soll: „Wenn jemand schlecht von deinem Freunde spricht, und scheint er noch so ehrlich, glaub ihm nicht! Spricht alle Welt von deinem Freunde schlecht, misstrau der Welt und gib dem Freunde Recht! Nur wer so standhaft seine Freunde liebt, ist wert, dass ihm der Himmel Freunde gibt.“ Eine wesentliche Erkenntnis zum Schluss: „Ohne Vertrauen zu schenken, wird man nie Vertrauen zurückbekommen“ (unbekannt). „Für viele Menschen hält das Leben Enttäuschungen bereit, die unser Vertrauen stark erschüttern. Trotzdem sollten wir nicht verzagen, im Leben Vertrauen zu wagen.“*138
2.4.6 Ehrlichkeit
Die Ehrlichkeit ist eine sittliche Eigenschaft des Menschen, die sich beispielsweise in der Aufrichtigkeit, Redlichkeit, Offenheit und Wahrhaftigkeit äußert. „Ehrlichkeit ist das erste Kapitel im Buch der Weisheit“ (T. Jefferson). Ehrlich zu sein ist eine besondere Charaktereigenschaft des Menschen: Wer ehrlich ist, der täuscht oder belügt andere nicht. Ich habe Menschen kennen gelernt, die das vorgelebt haben, aber auch andere, die das Wesen der Ehrlichkeit nicht antizipiert haben. Beispielsweise dann, wenn anderen Menschen – mitunter verletzend – ehrlich die Meinung gesagt wird. Damit provozieren wir Konflikte. Auch: „Ehrlichkeit ist keine Kategorie der Rhetorik“ (G. Beck). Das Gegenteil von Ehrlichkeit ist die Unehrlichkeit, also die Lüge, die heute leider weit verbreitet ist. Betrug gehört leider zum alltäglichen Leben: „Der Ehrliche ist leider oft der Dumme.“139 Trotzdem bleiben nicht wenige Menschen bei der Ehrlichkeit, weil sie innerlich stark sind. „Die Verabscheuung der Lüge ist sowohl ein Anliegen der Theologie als auch der Pädagogik.“* Das Ergebnis der Ehrlichkeit ist die Ehrenhaftigkeit. Sie sucht dabei den direkten Bezug zum Menschen.
► Das bedeutendste pro-Argument ist für mich: „Ehrlich währt am längsten“ (Sprichwort). Und: „Jede Ehrlichkeit beginnt mit der Ehrlichkeit zu sich selbst“ (D. Gropp). Hier können wir viel von den meisten Kindern lernen: „Ehrlichkeit ist die Weisheit der Kinder“ (M. Richter). Warum gilt das nicht ebenso für die Erwachsenen? Weil das geradlinige Leben mit zunehmendem Alter immer schwieriger wird? Dabei gilt: „Ehrlichkeit ist anstrengend“ (H. Stendhal). Dabei ist es doch gar nicht so schwierig: „Alle Meinungen sind achtenswert, wenn sie aufrichtig sind“ (J.P. Sartre). Und es gilt: „Eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge“ (Th. Mann). Vor allem für die Liebe gilt: „Ehrlichkeit und Offenheit sind Bestandteile einer dauerhaften Partnerschaft.“* „Wir haben die Pflicht, unseren Partner darüber zu informieren, was auch für ihn wichtig ist. Auch dann, wenn der Partner vielleicht verärgert reagiert.“* „Ehrlichkeit schafft Vertrauen und Unehrlichkeit wirkt sich früher oder später negativ aus!“* Ehrlichkeit in diesem Sinne bedeutet auch, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
► Demgegenüber haben nicht wenige Menschen mit der Ehrlichkeit keine guten Erfahrungen gemacht: „Mit der Ehrlichkeit fängt auch die Dummheit an“ (aus Japan). Folge: „Wo Ehrlichkeit das Dümmste ist, wird Ehrlichkeit auch nicht vermisst“ (E.H. Bellermann). Oder karrieremäßig interpretiert: „Ehrlichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr“ (Sprichwort). Auch wurde in Erfahrung gebracht: „Ehrlichkeit öffnet nicht jede Tür“ (V. Frank). Oder: „Mit Offenheit verschließt man sich alle Türen“ (G.W. Heyse). Vorsicht vor der „ehrlichen“ Meinung: „Was dem einen leicht von der Zunge geht, liegt dem anderen schwer im Magen“ (G.W. Heyse). Manchmal macht sie einsam: „Ehrlich sein: einsam sein“ (Max Frisch). Oder sie trifft uns innerlich: „Ehrlichsein tut mitunter weh.“*140 Aber: „Lieber ehrlich und einsam als unehrlich und angriffslustig.“* Stimmt das Folgende? „Die Ehrlichkeit dient mehr dem Selbstzweck als der Nächstenliebe“ (D. Mühlemann). Und: „Ehrlichkeit wär’ eine schöne Bürde, wenn sie nicht so drücken würde“ (E. Blanck). Ganz anders ist folgende Erfahrung: „Spontane Ehrlichkeit geht meistens mit der Lüge schwanger“ (V. Frank). Und: „Auf die Dauer kriegt auch die Ehrlichkeit Probleme mit dem Gleichgewicht“ (Art v. Rheyn). Für die Geschäftswelt gilt: „Wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht trauen kann, ist ein Vertrag nutzlos“ (J.P. Getty). Zum Schluss: „Das Tragische ist, dass man mit Lüge und Falschheit im Leben weiter kommt als mit Offenheit und Ehrlichkeit“ (P.E. Schulberg). Ich bezweifle das!
► Was ist nun richtig? Ehrlichkeit erfordert gerade in der heutigen Zeit viel Mut: „Sie ist die … die Mutprobe unserer Zeit“ (R. Karius). Und: „Ehrlichkeit wiegt mehr als Erfolg des Augenblicks“ (unbekannt). Ich stehe persönlich dazu: „Ehrlichkeit währt am längsten.“ Zum Nachdenken: „Wer Geradlinigkeit krumm nimmt, liegt schief“ (W. Lörzer). Etwas eigen interpretiert: „Sieh zu, dass du ein ehrlicher Mensch wirst, denn dann sorgst du dafür, dass es einen Schurken weniger auf der Welt gibt“ (T. Carlyle). „Ehrlichkeit ohne Offenheit ist wie ein Haus ohne Tür“ (A. Brie). Zur Entwicklung der Ehrlichkeit: „Manche sind nur ehrlich geworden, nachdem sie entdeckt haben, dass auch das sich lohnen kann“ (Ch. Chaplin).
Heute sind viele Menschen nicht mehr ehrlich, sondern sie lügen, um sich vermeintliche Vorteile zu verschaffen. Der Trieb, seinen eigenen Vorteil zu suchen ist so stark, dass er den Trieb zur Wahrhaftigkeit ständig gefährdet.141 Wir sind heute schon so weit, dass sich nicht wenige Kinder und Jugendliche die Lügen von Erwachsenen zum Vorbild nehmen. Damit muss Schluss sein: „Wir sollten wieder zu den alten Werten zurückkehren, beispielsweise zu Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Bescheidenheit.“* „Ohne Ehrlichkeit kein Vertrauen, ohne Vertrauen keine Zusammenarbeit“ (V. Frank). „Ich behaupte: Es geht auch ohne Lügen.“* Und diese Erkenntnis zeigt uns: „Die Wahrheit der Dialektik liegt nicht immer in der Mitte.“* Das Motto sollte sein:
„Sei immer redlich, wenn du auch betrogen wirst, denn das ist der Probierstein des Wackeren, dass er selten auf redliche Menschen trifft und doch sich selber gleich bleibt“
(Ludwig Tieck)
Manche machen sich über die Ehrlichkeit von Menschen sogar lustig: „Wie kann man so dumm sein, ich bin doch nicht blöd!“ (unbekannt). Die Antwort von G. Klopstock: „Wer redliche Arme verachtet, Weh dem!“. Zum Schluss sagt ein indischer Weiser sehr treffend: „Ehrlichkeit ist eine einzigartige Tugend, auf der der Einzelne und das Leben des Volkes sicher ruhen kann. Die Gesellschaft kann nur fortdauern, wenn sie mit angelassenem Mörtel der Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit gebaut ist“ (Swami Sivananda).
2.4.7 Besonnenheit
Die Besonnenheit142 ist die Haltung der Gelassenheit eines Menschen, insbesondere in schwierigen Situationen selbstbeherrscht, vernünftig, abwägend bzw. distanziert zu handeln und die Vernunft walten zu lassen. Dabei gilt es, Geduld zu zeigen und vorschnelle bzw. unüberlegte Handlungen zu vermeiden. Die Besonnenheit zählt zu den Kardinaltugenden wie Weisheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit. Im Gegensatz zur Besonnenheit steht die menschliche Impulsivität, bei dem der Mensch spontan und ohne jeden Einbezug von Konsequenzen reagiert. Dazu ein Beispiel:
Der Philosoph Ludwig Feuerbach hatte sich mit Berta Löw verheiratet und suchte im Wald seine Ruhe auf einer Holzbank. Da stand plötzlich der Förster vor ihm: „Angermaier ist mein Name, ich bin der Oberforstrat des hiesigen Reviers. Mit wem habe ich das Vergnügen?“ „Das weiß ich nicht, ich kenne ihre näheren Lebensumstände nicht“ sagte Feuerbach. „Mein Herr, sagte der Forstrat Angermeier ungehalten“. Er sah Feuerbach streng an: „Sie sind recht unhöflich und seltsam dazu. Sie sollten wissen, dass ich ein namhafter Gelehrter bin, der schon zwei Bücher geschrieben hat. Meine Werke sind im hiesigen Revier von durchschlagender Wirkung, wenn Sie verstehen, was ich meine!“ Feuerbach antwortete besonnen: „Ich denke schon, Sie sehen mich zutiefst beeindruckt. Neben einem Mann wie Ihnen, Herr Angermeier, kann ein schlichter Waldläufer wie ich, sich nur klein vorkommen, wenn auch nicht unbedingt hässlich!“143
► Sophokles sagt zur Gelassenheit würdigend: „Aller Güter höchstes sei Besonnenheit.“ Und es gilt: „Besonnenheit ist eine Tugend, die mit dem Alter wächst“ (F. Schmidberger). Auch Politiker sollten sie beherzigen, denn: „Besonnenheit ist die Vernunft der Politik“ (L. Genbetta). Grundsätzlich zählt das deutsche Sprichwort: „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.“ In ganz anderer Interpretation sieht es N.G. Dávila: „Die Gelassenheit ist die Folge akzeptierter Unsicherheit.“ Auch in kriegerischen Zeiten hat sie ihre Bedeutung: „Die höchste Krone des Helden ist die Besonnenheit mitten in Stürmen der Gegenwart“ (J. Paul). Außerdem: „Mut und Besonnenheit paarten sich, ihr geliebtes Kind nannten sie Tapferkeit“ (Sprichwort). Wir können in aller Gelassenheit feststellen: „Wer mit Bedacht handelt, erreicht, was er erstrebt“ (aus Arabien). Oder auch: „Kommt Zeit, kommt Rat“ (Sprichwort). Zum Schluss: „..zu dem, der warten kann, kommt alles mit der Zeit“ (aus Frankreich).
► Dem wird entgegengehalten: „Niemand ist mehr Fehlern ausgesetzt, als der Mensch, der nur aus Überlegung handelt“ (Vauvenargues). Oder deftiger: „Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz“ (M. Luther). „Die Besonnenheit bedeutet Gelassenheit und Selbstbeherrschung, zu langes Zaudern kann aber auch schaden. Deshalb mein Rat: „Sei besonnen, aber warte nicht, bis es zu spät ist.“* Und es gilt: Einseitige, unkritische Besonnenheit gleitet in die Tatenlosigkeit ab.“* Dazu passt: „Zu dem der immer wartet, kommt gewöhnlich alles zu spät“ (E. Oesch). Außerdem gilt in unserer hektischen Zeit: „Der Mensch hat das Warten verlernt. Darin liegt das Grundübel unserer Zeit“ (W.S. Maugham). Zum Schluss: „Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten“ (F. von Schiller).