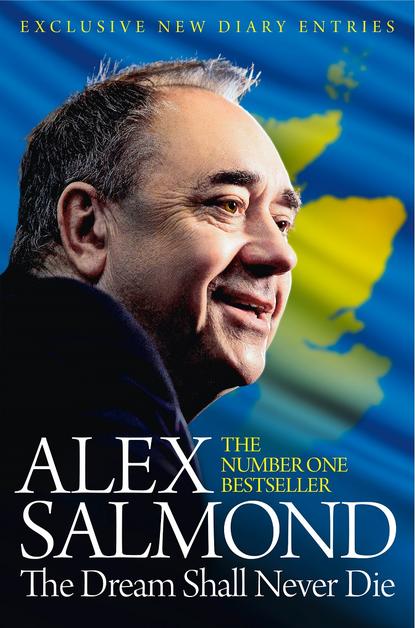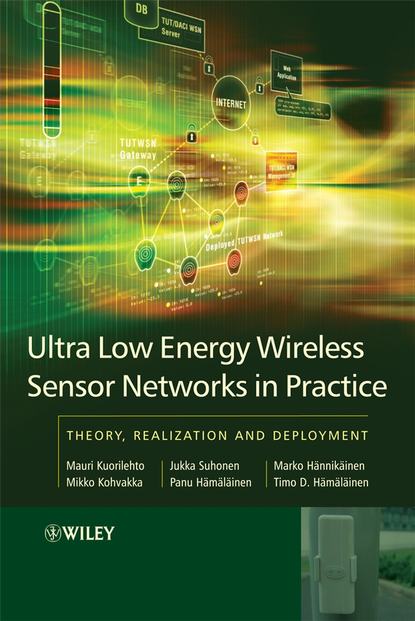Das Gewicht der Ehre

- -
- 100%
- +
Der Eisbrocken schlug in der Mitte der Steinfestung ein und der Aufprall war stärker als alles, was Duncan bisher in seinem Leben gehört hatte. Es war, als ob ein Komet in Escalon eingeschlagen wäre, das Echo des Donners war so laut, dass er sich die Ohren zuhalten musste, der Boden bebte unter ihm und ließ ihn straucheln. Eine riesige Staub- und Eiswolke erhob sich mehrere Meter hoch und die Luft wurde sogar hier oben von den erschrockenen Schreien der Männer erfüllt. Die Hälfte der Garnison war durch den Aufprall zerstört worden und der Eisbrocken rollte weiter, zerquetschte Männer, planierte Häuser und hinterließ eine Spur der Zerstörung und des Chaos.
„MÄNNER VON KOS!” rief Kavos. „Wer hat es gewagt sich unserem Berg anzunähern?
Es ertönte ein lautes Rufen, als sich seine tausend Krieger auf einmal nach vorne bewegten und über den Rand der Klippe sprangen, Kavos folgend, ergriffen sie alle die Seile und seilten sich so schnell ab, so dass sie praktisch im freien Fall den Berg hinunter fielen. Duncan folgte mit seinen Männern, auch sie sprangen alle, die Seile ergreifend und ließen sich so schnell herab, dass er kaum atmen konnte; er war davon überzeugt sich den Hals bei diesem Stoß zu brechen.
Sekunden später landete er hart am Fuß des Berges, hunderte von Metern weiter unten, in einer riesigen Wolke aus Eis und Staub, das Grollen hallte immer noch von dem rollenden Felsbrocken nach. Alle Männer drehten sich um, stellten sich vor die Festung und ließen ein riesiges Kampf Geschrei ertönen als sie ihre Schwerter zogen und sich kopfüber in das Chaos des pandesischen Lagers stürzten.
Die immer noch von der Explosion benommenen pandesischen Soldaten, sahen mit geschockten Gesichtern auf die Armee, die sich formierte; damit hatten sie definitiv nicht gerechnet. Betäubt, ohne Schutz und mit ihren, vom Brocken zerquetschten, toten Kommandanten, vor ihnen liegend, erschienen sie zu verwirrt um auch nur einen klaren Gedanken fassen zu können. Als Duncan und Kavos und ihre Männer sich ihnen annäherten, drehten sich einige um und liefen weg. Andere versuchten ihre Schwerter zu ziehen, doch Duncan und seine Männer fielen wie Heuschrecken über sie her und erstachen sie, bevor sie auch nur eine Chance hatten zu zustechen.
Duncan und seine Männer stürzten durch das Lager, niemals zögerten sie, denn sie wussten das Zeit die Essenz des ganzen Angriffs war und so schlugen sie die sich erholenden Soldaten auf jeder Seite nieder, der Spur der Zerstörung, die vom Felsbrocken zurückgelassen wurde, folgend. Duncan schlug in jede Richtung, er stach einem Soldaten in die Brust, einem anderen schmetterte er den Griff seines Schwertes ins Gesicht, einen weiteren trat er um, und sofort duckte er sich und stoß mit seiner Schulter gegen den Nächsten als dieser seinen Kopf mit einer Axt einschlagen wollte. Duncan hielt nicht inne, er schlug jeden nieder, der sich in seinen Weg stellte, schwer atmend, wusste er, dass die anderen immer noch in der Überzahl waren und dass er so viele so schnell wie möglich töten musste.
Neben ihm schlossen sich Anvin, Arthfael und seine Männer an, jeder von ihnen deckte den Rücken des anderen, jeder von ihnen kämpfte sich vorwärts und stieß und verteidigte in jede Richtung während das Kriegsgeräusch die Garnison erfüllte. In diesem unübersichtlichen Kampf verwickelt, wusste Duncan, dass es schlauer gewesen wäre die Kraft seiner Männer zu sparen und diese Konfrontation zu vermeiden und direkt nach Andros zu ziehen. Aber er wusste auch das es Ehre war, die die Männer von Kos zwang diesen Kampf zu kämpfen und er verstand wie sie fühlten; die klügste Vorgehensweise war nicht immer die, die die Herzen der Männer bewegte.
Sie bewegten sich mit Geschwindigkeit und Disziplin durch das Lager, die Pandesier waren so verwirrt, dass sie kaum in der Lage waren eine organisierte Verteidigung aufzubauen. Jedes Mal wenn ein Kommandant auftauchte oder sich eine Formation bildete, zerschlugen Duncan und seine Männer diese.
Duncan und seine Männer rauschten wie ein Sturm durch die Garnison und nachdem gerade erst eine Stunde vergangen war, stand Duncan endlich dort am Ende des Forts in jede Richtung blickend, realisierend, blutüberströmt, dass niemand mehr zum Töten da war. Er stand dort, schwer atmend, als die Dämmerung einfiel und der Nebel über die Berge zog. Alles war unheimlich still.
Die Garnison war ihre.
Als die Männer sich dessen bewusst wurden, stießen sie einen spontanen Freudenruf aus, und Duncan stand dort, Anvin, Arthfael, Seavig, Kavos und Bramthos kamen zu ihm rüber, wischten das Blut von seiner Klinge und seiner Rüstung und nahmen alles um sich herum auf. Er nahm eine Wunde auf Kavos Arm wahr, Blut sickerte durch.
„Du bist verwundet“, er zeigte auf Kavos, der es nicht zu merken schien. Kavos schaute nach unten und zuckte mit den Schultern. Dann lächelte er.
„Ein Schönheitskratzer“, antwortete er.
Duncan betrachtete das Schlachtfeld, so viele tote Männer, die meisten waren Pandesier, aber es waren auch einige seiner Männer. Dann schaute er nach oben, auf die eisigen Berge von Kos, die über ihnen aufragten und in den Wolken verschwanden, verblüfft darüber wie hoch sie geklettert waren und wie schnell sie hinuntergekommen waren. Es war ein Blitzangriff gewesen – wie der Tod, der vom Himmel regnet – und es hatte funktioniert. Die pandesische Garnison, die Stunden zuvor noch so unverwundbar erschien, war nun ihre, nichts als eine besiegte Ruine, mit all ihren Männern in Blutlachen, tot in der Abenddämmerung liegend. Es war surreal. Die Krieger von Kos verschonten niemanden, hatten keine Gnade walten lassen und waren eine unaufhaltsame Kraft gewesen. Duncan fühlte neuerlangten Respekt für sie. Sie würden entscheidende Partner bei der Befreiung Escalons sein.
Kavos ebenfalls schwer atmend, betrachtete die Leichen.
„Das ist es, was ich einen Ausstiegsplan nenne”, antwortete er.
Duncan sah ihn grinsen als er die feindlichen Körper betrachtete und ihre Männer den Tod von ihren Waffen abstreiften. Duncan nickte.
„Und ein guter Ausgang war es“, antwortete er.
Duncan drehte sich um und schaute nach Westen, vorbei an der Garnison, in Richtung der untergehenden Sonne und eine Bewegung verfing sich in seinem Auge. Er blinzelte und sah etwas, dass sein Herz mit Wärme erfüllte, einen Anblick, den er irgendwie erwartet hatte zu sehen. Dort, am Horizont stand sein Schlachtross. Es stand stolz vor seiner Herde, mit hunderten von Schlachtrössern hinter sich. Es hatte wie immer gespürt, wo Duncan war und hier stand es, treu auf ihn wartend. Duncans Herz machte einen Sprung, wissend das sein alter Freund seine Armee das letzte Stück des Weges bis in die Hauptstadt bringen würde.
Duncan pfiff und als er dies tat, drehte sich sein Pferd um und lief in seine Richtung. Die anderen Pferde folgten, es ertönte ein lautes Dröhnen in der Dämmerung, als die Herde durch die schneebedeckte Ebene galoppierte und zu ihnen liefen.
Kavos nickte bewundernd neben ihm.
„Pferde”, bemerkte Kavos, ihr Näherkommen beobachtend. „Ich wäre nach Andros gelaufen.“
Duncan grinste.
„Ich bin sicher, das wärst du, mein Freund.“
Duncan trat nach vorne als sich sein Pferd ihm näherte und streichelte die Mähne seines alten Freundes. Er bestieg ihn und als er dies tat, stiegen all seine Männer mit ihm auf, Tausende von ihnen, eine berittene Armee. Sie saßen dort, voll bewaffnet und starrten in die Dämmerung, nichts vor ihnen als schneebedeckte Ebenen, die in die Hauptstadt führten.
Ein Sturm der Aufregung durchfuhr ihn als er spürte dass sie an der Schwelle standen. Er konnte es fühlen, konnte den Sieg in der Luft riechen. Kavos hatte sie den Berg hinuntergebracht; jetzt war er dran.
Duncan erhob sein Schwert und fühlte die Augen all seiner Männer, aller Armeen, auf ihn gerichtet.
„MÄNNER!“, rief er. „Nach Andros!“
Sie alle ließen einen lautes Kampfgebrüll ertönen und folgten ihm in die Nacht, über das verschneite Flachland, darauf vorbereitet nicht anzuhalten bis sie die Hauptstadt erreicht und den größten Kampf ihres Lebens gefochten hatten.
KAPITEL VIER
Kyra sah nach oben in die einbrechende Morgendämmerung und sah einen Schatten über sich, eine Silhouette die vor der aufsteigenden Sonne stand, ein Mann der nur ihr Onkel sein konnte. Sie blinzelte in Ungläubigkeit als er in ihr Blickfeld eintrat. Hier war nun endlich der Mann, für den sie durch ganz Escalon gereist war, der Mann, der ihr Schicksal preisgeben würde, der Mann, der sie ausbilden würde. Hier war er nun, der Bruder ihrer Mutter, die einzige Verbindung, die es zur Mutter, die sie nie kennengelernt hatte, gab.
Ihr Herz schlug vor Erwartung schneller als er aus dem Licht heraustrat und sie sein Gesicht sehen konnte.
Kyra war erstaunt: Er sah ihr verblüffend ähnlich. Sie hatte noch nie jemanden getroffen, der Ähnlichkeit mit ihr hatte – nicht mal ihr Vater, so sehr sie es auch hoffte. Sie hatte sich immer wie eine Fremde in dieser Welt gefühlt, von einer wirklichen Abstammung isoliert – aber nun, als sie das Gesicht dieses Mannes, seine hoch gemeißelten Wangenknochen und seine grauen blitzenden Augen sah, einen Mann der hoch und aufrecht stand, mit breiten Schultern, muskulös, in eine glänzende, goldene Ketten –Rüstung gekleidet, mit hellbraunem Haar, das bis zu seinem Kiefer hinabfiel, der unrasiert und vielleicht in seinen Vierzigern war, realisierte sie schnell, dass er etwas Besonders war. Und das machte sie daher auch zu etwas Besonderem. Sie konnte es zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich spüren. Das erste Mal fühlte sie sich mit jemandem verbunden, mit einer mächtigen Blutlinie, mit etwas, dass größer als sie selbst war. Sie spürte ein Zugehörigkeitsgefühl in dieser Welt.
Dieser Mann war augenscheinlich anders. Er war offensichtlich ein Krieger, stolz und edel, dennoch trug er keine Schwerter, Schilder oder Waffen anderer Art. Zu ihrer Verwunderung und Freude trug er nur ein einziges Teil: einen goldenen Stab. Einen Stab. Er war genau wie sie.
„Kyra”, sagte er.
Seine Stimme tönte durch sie hindurch, eine Stimme so vertraut, so ähnlich ihrer. Als sie ihn sprechen hörte, spürte sie nicht nur eine Verbindung zu ihm, sondern noch viel aufregender, eine Verbindung zu ihrer Mutter. Hier stand der Bruder ihrer Mutter. Hier war der Mann, der wusste wer ihre Mutter war. Endlich, würde sie die Wahrheit erfahren – es würde keine Geheimnisse mehr in ihrem Leben geben. Schon bald würde sie alles über die Frau wissen, die sie immer kennenlernen wollte.
Er senkte seine Hand und sie reichte nach oben und nahm sie, ihre Beine waren von der langen Nacht des Sitzens vor dem Turm ganz steif. Es war eine starke Hand, muskulös, aber dennoch überraschend sanft und er half ihr auf die Beine. Leo und Andor gingen zu ihm und Kyra war überrascht, dass sie nicht wie üblich anfingen zu knurren. Stattdessen gingen sie näher zu ihm und leckten seine Hand, als ob sie ihn schon immer kennen würden.
Dann zu Kyras Verwunderung, stellten sich Leo und Andor aufmerksam neben ihm, als ob er es ihnen still befohlen hätte. Kyra hatte so etwas noch nie gesehen. Welche Kräfte hatte dieser Mann?
Kyra brauchte nicht zu fragen, ob er ihr Onkel war – sie fühlte es mit jedem Gramm ihres Köpers. Er war mächtig, stolz, alles, was sie sich erhofft hatte. Da war noch etwas anderes in ihm. Etwas, dass sie noch nicht ganz erfassen konnte. Es war eine mystische Energie, die ihn umgab, eine Aura aus Ruhe, die aber dennoch Stärke ausstrahlte.
„Onkel“, sagte sie. Sie mochte es, wie sich das Wort anhörte. Den Klang des Wortes.
„Du kannst mich Kolva nennen”, antwortete er.
Kolva. Irgendwie fühlte sich der Name vertraut an.
„Ich durchquerte Escalon um dich zu sehen”, sagte sie, nervös, nicht wissend was sie sonst sagen sollte. Die Morgenruhe schluckte ihre Worte, die unfruchtbaren Ebenen waren erfüllt mit dem entfernten Geräusch des Ozeans. „Mein Vater hat mich geschickt.“
Er lächelte zurück. Es war ein warmes Lächeln, welches die Falten oben in seinem Gesicht bündelte, als hätte er bereits tausend Jahre gelebt.
„Es war nicht dein Vater, der dich schickte“, antwortete er. „Es war etwas viel Mächtigeres.“
Er drehte sich plötzlich ohne Vorwarnung um und begann sich, auf seinen Stab stützend, vom Turm zu entfernen.
Kyra sah ihn weggehen, und stand wie betäubt, sie verstand nicht; hatte sie ihn beleidigt?
Sie beeilte sich aufzuholen, Leo und Andor waren an ihrer Seite.
„Der Turm“, sagte sie, verwundert. „Gehen wir dort nicht hinein?“
Er lächelte.
„Vielleicht ein anderes Mal”, antwortete er.
„Aber ich dachte, ich müsste den Turm erreichen.“
„Das musstest du”, antwortete er. „Aber du musstest nicht hinein gehen.“
Sie hatte Probleme ihn zu verstehen, er lief schnell und hatte den Waldrand schon fast erreicht und wieder beeilte sie sich aufzuholen. Sein Stab klapperte auf dem Boden und den Blättern, so wie ihrer auch.
„Und wo sollen wir dann üben?“, fragte sie.
„Du wirst üben, da, wo alle großen Krieger ausgebildet wurden”, antwortete er. Er blickte nach vorn. „In den Wäldern jenseits des Turmes.“
Er betrat den Wald und lief so schnell, dass Kyra fast rennen musste, um mit ihm mitzuhalten, obwohl es schien, als ob er langsam ging. Das Geheimnis um ihn vertiefte sich, eine Million Fragen ratterten ihr durch den Verstand.
„Lebt meine Mutter?“ fragte sie schnell, nicht imstande ihre Neugier zu zügeln. „Ist sie hier? Hast du Sie getroffen?“
Der Mann lächelte bloß und schüttelte seinen Kopf, während er weiterlief.
„So viele Fragen”, antwortete er. Er lief eine Zeitlang weiter, der Wald war von den Geräuschen komischer Kreaturen erfüllt und dann fügte er endlich hinzu: „Fragen, dass wirst du sehen, haben wenig Bedeutung hier. Und Antworten sogar noch weniger. Du musst lernen deine eigenen Antworten zu finden. Die Quelle deiner Antworten. Und noch wichtiger – du musst die Quelle deiner Fragen finden.“
Kyra wurde immer verwirrter während sie durch den Wald wanderten, an diesem mystischen Ort schien das Grün der Bäume um sie herum zu leuchten. Bald verlor sie den Turm aus den Augen und das Krachen der Wellen wurde leiser. Sie kämpfte um mitzuhalten als der Weg sich in verschiedene Richtungen schlängelte. Viele Fragen brannten ihr auf der Seele und schließlich konnte sie nicht mehr still sein.
„Wo bringst du mich hin?“ fragte sie. „Wirst du mich dort ausbilden?“
Der Mann lief weiter, hüpfte über einen fließenden Bach, er lief zwischen alten Bäumen hin und her, deren Rinde in einem leuchtenden Grün erstrahlte und sie folgte ihm auf den Fersen.
„Ich werde dich nicht ausbilden”, sagte er. „Dein Onkel wird das tun.“
Kyra war völlig verwirrt.
„Mein Onkel?” fragte sie. „Ich dachte du wärst mein Onkel.”
„Bin ich auch”, antwortete er. „Und du hast noch einen.“
„Noch einen?“ fragte sie.
Schließlich erreichten sie eine Waldlichtung, und er blieb am Rand stehen und sie kam atemlos neben ihm zum Stehen. Sie schaute nach vorne und war sprachlos bei dem Anblick.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung war ein riesengroßer Baum, der Größte, den sie jemals gesehen hatte, alt, seine Äste erstreckten sich in alle Richtungen, seine purpurroten Blätter schimmerten und sein Stamm war um die neun Meter breit. Die Äste waren ineinander verflochten und kreuzten sich untereinander und schufen so ein kleines Baumhaus, welches vielleicht drei Meter über dem Boden hing und so aussah als ob es dort schon immer gehangen hatte. Ein kleines Licht drang nach draußen auf die Äste. Kyra schaute nach oben und sah eine einsame Gestalt am Rand der Äste sitzen, die aussah als ob sie sich in einem Meditationszustand befand und sie von oben anstarrte.
„Er ist auch dein Onkel.“ sagte Kolva.
Kyras Herz hämmerte in ihrer Brust, nichts von all dem verstehend. Sie sah nach oben zu dem Mann, vom dem er sagte er sei ihr Onkel und fragte sich, ob er ihr einen Streich spielte. Ihr anderer Onkel sah aus wie ein kleiner Junge, der vielleicht zehn Jahre alt war. Er saß komplett aufrecht, wie in Meditationshaltung und starrte vor sich hin ohne sie direkt anzugucken, seine Augen schimmerten blau. Sein jungenhaftes Gesicht war voller Falten, so als ob er tausend Jahre alt wäre, seine Haut war leicht braun und übersät mit Altersflecken. Er konnte nicht viel größer als 1,20 Meter sein. Es war als ob er ein Junge mit einer Alterskrankheit wäre.
Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte.
„Kyra”, sagte er, „das ist Alva.“
KAPITEL FÜNF
Merk trat in den Turm von Ur ein und ging durch die hohen, goldenen Türen, die er, wie er geglaubt hatte, nie durchschreiten würde. Das Licht schien so hell innen, dass es ihn fast blind machte. Er hob eine Hand um seine Augen abzuschirmen und als er dies tat, erstarrte er in Ehrfurcht vor dem was er vor sich sah.
Dort, auf der anderen Seite stand ihm ein echter Wächter gegenüber, seine gelben Augen musterten ihn durchdringend, es waren dieselben Augen, die Merk schon hinter dem Türschlitz verfolgt hatten. Er trug eine gelbe, wehende Robe, seine Arme und Beine wurden verdeckt und die wenige Haut, die er zeigte, war blass. Er war überraschend klein, sein Kiefer länglich, seine Wangen eingefallen und als er zurückstarrte fühlte sich Merk unwohl. Licht erstrahlte aus dem kurzen, goldenen Stab, den er vor sich hielt.
Der Wächter beobachtete ihn schweigend und Merk fühlte einen Luftzug als die Türen auf einmal zuschlugen und ihn im Turm einschlossen. Das Echo des hohlen Klanges schallte von den Wänden wieder und er zuckte unfreiwillig zusammen. Er merkte wie abgespannt er von all den Tagen, die er nicht geschlafen hatte, von all diesen Albtraum geplagten Nächten und von seiner Besessenheit in den Turm zu kommen, war. Jetzt drinnen stehend, hatte er das seltsame Gefühl der Zugehörigkeit, als ob er endlich in seinem neuen Zuhause angekommen wäre.
Merk erwartete, dass der Wächter ihn begrüßen und ihm erklären würde wo er sich befand. Aber stattdessen, drehte sich dieser um und ging wortlos davon und ließ Merk fragend zurück. Er wusste nicht, ob er ihm folgen sollte.
Der Wächter lief zu einer elfenbeinernen Wendeltreppe ganz am Ende des Saales und zu Merks Überraschung, ging er diese nicht hinauf, sondern hinab. Er stieg schnell hinab und verschwand außer Sichtweite. Merk stand dort perplex in der Stille und wusste nicht, was von ihm erwartet wurde.
„Sollte ich Ihnen folgen?“ rief er endlich.
Merks Stimme schallte und hallte von den Wänden wieder zu ihm zurück, als ob sie ihn verspottete.
Merk sah sich um und betrachtete das Innere des Turmes. Er sah die glänzenden Wände, die aus Gold gemacht waren; er sah den Boden, der aus altem schwarzem Marmor und von Goldstreifen durchzogen war. Der Ort war schwach beleuchtet, und wurde nur erhellt durch den mystischen Schein, welcher von den Wänden kam. Er sah nach oben und sah die alte aus Elfenbein geschnitzte Treppe; er trat nach vorne und seinen Hals reckend, konnte er ganz oben eine goldene Kuppel, die mindestens dreißig Meter hoch war und Sonnenlicht einließ, erblicken. Er sah all die Stockwerke, Treppenabsätze und Etagen und er fragte sich, was dort oben alles verborgen lag.
Er schaute nach unten und wurde sogar noch neugieriger, als er sah, dass die Stufen nach unten, weiter in unterirdische Etagen führten, dorthin wo der Wächter gegangen war und er wunderte sich darüber. Diese wunderschöne, elfenbeinerne Treppe, wie ein Kunstwerk, drehte und wand sich geheimnisvoll in beide Richtungen, einmal führte sie nach oben bis in den Himmel und dann bis zu den untersten Ebenen der Hölle. Aber am meisten fragte sich Merk, ob das legendäre Flammenschwert, das Schwert, dass ganz Escalon beschützte, in diesen Wänden verborgen lag. Er spürte Aufregung, als er nur daran dachte. Wo könnte es wohl sein? Oben oder unten? Welche anderen Relikte und Schätze waren hier noch verborgen?
Plötzlich öffnete sich eine versteckte Tür, die aus der Wand neben Merk erschien, er drehte sich um und sah einen ernst dreinschauenden Krieger auftauchen, ein Mann der ungefähr Merks Größe hatte und ein Kettenhemd trug, seine Haut war blass, von zu vielen Jahren ohne Sonnenlicht. Er kam auf Merk zu, er war ein Mensch, ein Schwert an seiner Hüfte mit einem markanten Abzeichen, dasselbe Symbol, welches Merk draußen auf den Wänden des Turmes gesehen hatte; ein elfenbeinernes Treppenhaus, welches in den Himmel führte.
„Nur Wächter gehen hinunter“, sagte der Mann, seine Stimme war dunkel und rau. „Und du, mein Freund, bist kein Wächter. Zumindest, bis jetzt noch nicht.“
Der Mann stoppte vor ihm und musterte ihn von oben bis unten und legte seine Hände in die Hüften.
„Aber“, sprach er weiter, „Ich nehme an, wenn sie dich hereinlassen, dann muss das einen Grund haben.“
Er seufzte.
„Folge mir.“
Damit drehte sich der Krieger abrupt um und stieg die Treppe hinauf. Merks Herz schlug schnell als er sich beeilte aufzuholen, sein Kopf voller Fragen, und mit jedem Schritt tauchte er immer weiter in die Geheimnisse dieses Ortes ein.
„Mach deine Arbeit und mach sie gut”, sprach der Mann, mit dem Rücken zu Merk gewandt, seine dunkle Stimme echote von den Wänden, „und du wirst die Erlaubnis bekommen zu dienen. Den Turm zu beschützen ist die höchste Berufung, die es in Escalon gibt. Du musst mehr sein als ein bloßer Krieger.“
Sie blieben auf dem nächsten Stockwerk stehen und der Mann hielt an und starrte Merk in die Augen, also ob er eine tiefe Wahrheit in ihm spürte. Merk fühlte sich unwohl.
„Wir alle haben dunkle Vergangenheiten”, sagte der Mann. „Das ist es, was uns hierher gebracht hat. Aber welcher Vorteil liegt in deiner Vergangenheit? Bist du bereit wiedergeboren zu werden?”
Er pausierte und Merk stand dort und versuchte seine Worte zu begreifen, unsicher, wie er darauf antworten sollte.
„Respekt ist hier schwer zu gewinnen.“, fuhr er fort. „ Wir sind, jeder von uns, das Beste was Escalon zu bieten hat. Verdiene ihn dir und eines Tages wirst du vielleicht in die Bruderschaft aufgenommen. Falls nicht, wirst du gebeten zu gehen. Vergiss nicht: Diese Türen, die dich hereingelassen haben, können dich genauso schnell wieder rauslassen.“
Merks Herz stach bei dem Gedanken.
„Wie kann ich dienen?“ fragte Merk und glaubte seine Berufung, nach der er sich immer gesehnt hatte, zu spüren.
Der Krieger stand dort für eine lange Zeit, dann drehte er sich schließlich um und begann die nächste Etage hinaufzusteigen. Als Merk ihn gehen sah, dämmerte ihm, dass es viele Geheimnisse gab, die er vielleicht nie erfahren würde.
Merk wollte ihm folgen, doch plötzlich, schlug ihm eine große, kräftige Hand gegen die Brust und stoppte ihn. Er sah einen anderen Krieger aus einer anderen geheimen Tür auftauchen, der erste Krieger lief weiter nach oben und verschwand in den oberen Stockwerken. Der neue Krieger überragte Merk und trug das gleiche goldene Kettenhemd.
„Du wirst auf diesem Stockwerk dienen“, sagte er schroff, „mit dem Rest von denen. Ich bin dein Kommandant. Vicor.“
Sein neuer Kommandant, ein dünner Mann mit einem Gesicht so hart wie Stein, sah aus, als ob man sich nicht mit ihm anlegen sollte. Vicor drehte sich um und zeigte auf eine offene Tür in der Wand und Merk trat vorsichtig ein, sich fragend was dieser Ort war als er kreuz und quer durch enge Steinhallen ging. Sie liefen wortlos an großen offenen Gewölbebögen vorbei und die Halle öffnete sich zu einem ausgedehnten Raum mit spitz zulaufenden Decke mit Steinböden und Steinwänden, der von Tageslicht erleuchtet wurde, welches durch die schmalen zugespitzten Fenster hereinfiel.
Merk erschrak als er Dutzende Gesichter sah, die ihn alle anstarrten, Gesichter von Kriegern, einige dünn, einige muskulös, alle mit harten, unerschrockenen Augen, alle mit einem Ausdruck von Pflichtgefühl und von Erfüllung in ihrem Gesicht.
Sie alle waren im Raum verteilt, jeder war vor einem Fenster stationiert und auch sie trugen alle das goldene Kettenhemd und drehten sich herum, um den Fremden der ihren Raum betrat zu beobachten.
Merk fühlte sich selbstbewusst und starrte zurück zu diesen Männern in dieser seltsamen Stille.
Neben ihm räusperte sich Vicor.
„Die Brüder vertrauen dir nicht”, sagte er zu Merk. „Sie werden dir vielleicht niemals vertrauen. Und du wirst ihnen vielleicht auch nie trauen. Respekt wird hier nicht verschenkt und es gibt keine zweite Chance.“
„Was ist es, das ich tun soll?“ fragte Merk, verwirrt.
„Dasselbe wie diese Männer”, antwortete Vicor schroff. „Du wirst beobachten.“