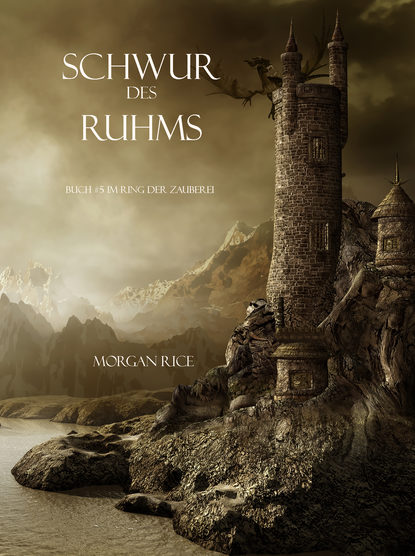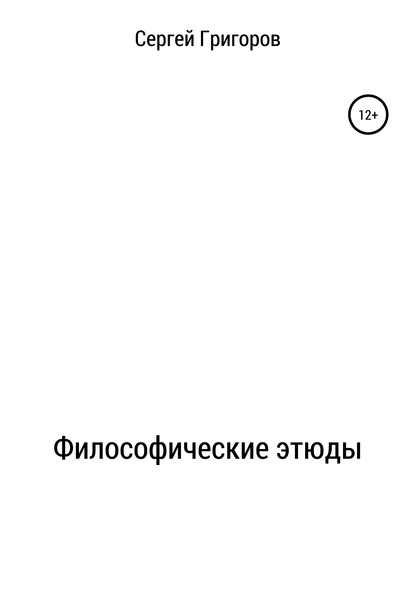Queste der Helden

- -
- 100%
- +
Nach ein paar Sekunden blickte der Soldat auf ihn hinunter und verzog das Gesicht.
„Könnt Ihr mir sagen, wo sie ist?“, drängte Thor.
„Und was wirst du wohl dort zu suchen haben?“
„Etwas äußerst Wichtiges“, drängte Thor weiter. Er hoffte, der Soldat würde nicht auf Einzelheiten bestehen.
Der Soldat wandte sich wieder ab, um weiterhin geradeaus zu starren, und ignorierte ihn wieder. Thor fühlte, wie sein Herz sank. Er befürchtete schon, dass er nie eine Antwort bekommen würde.
Doch nach einer gefühlten Ewigkeit antwortete der Soldat: „Nimm das östliche Tor, dann geh nach Norden, soweit es geht. Nimm das dritte Tor links, dann die Abzweigung rechts, und bieg noch einmal rechts ab. Passiere den zweiten Steinbogen, und ihre Gründe liegen hinter dem Tor. Aber ich sage dir, du verschwendest deine Zeit: sie halten sich dort nicht mit Besuchern auf.“
Mehr wollte Thor gar nicht hören. Ohne sich weiter aufzuhalten, drehte er sich um und rannte über das Feld, der Wegbeschreibung folgend, die er im Kopf vor sich her sagte, damit er sie nicht vergaß. Er bemerkte, dass die Sonne höher am Himmel stand, und konnte nur beten, dass es noch nicht zu spät war, bis er dort ankam.
*
Thor rannte die makellosen, muschelgesäumten Wege entlang und bahnte sich seinen gewundenen Weg durch Königshof. Er versuchte, der Wegbeschreibung zu folgen, so gut er konnte und hoffte, dass er nicht in die Irre geleitet worden war. Er erreichte das andere Ende des großen Hofs, blickte auf alle Tore und nahm das dritte von links. Er lief hindurch und folgte den Abzweigungen, bog um eine Ecke nach der anderen. Er rannte gegen den Strom; tausende Menschen strömten in die Stadt hinein, die Menge wurde von Minute zu Minute dichter. Er stieß gegen die Schultern von Lautenspielern, Jongleuren, Hofnarren und allen möglichen anderen Unterhaltungskünstlern, allesamt besonders prächtig herausgeputzt.
Thor ertrug den Gedanken nicht, dass die Ernennung ohne ihn beginnen sollte, und tat sein bestes, sich auf den Weg zu konzentrieren, während er einen Pfad nach dem anderen nahm und nach irgendeinem Anzeichen für die Trainingsgründe Ausschau hielt. Er lief durch einen Bogen, bog in eine weitere Straße ein, und erblickte endlich in der Ferne etwas, das nichts anderes als sein Ziel sein konnte: ein kleines Kolosseum, ein kreisrundes Bauwerk aus Stein. In seiner Mitte befand sich ein riesiges Tor, an dem Soldaten Wache standen. Thor konnte hinter den Mauern gedämpften Jubel hören, und sein Herz schlug schneller. Er war am Ziel.
Er rannte schneller, seine Lunge drohte schon zu platzen. Als er zum Tor kam, traten zwei Wachen vor und senkten ihre Lanzen, und versperrten ihm so den Weg. Ein dritter Wachmann trat vor und hob die Hand.
„Anhalten“, befahl er.
Thor blieb abrupt stehen, schnappte nach Atem, kaum in der Lage, seine Aufregung zu beherrschen.
„Ihr...versteht...nicht“, keuchte er, die Worte zwischen seinen Japsern hervor stoßend, „ich muss hinein. Ich bin spät dran.“
„Spät dran wofür?“
„Die Ernennung.“
Der Wachmann, ein kurzer, schwerer Mann mit pockennarbiger Haut, warf den anderen hinter ihm einen Blick zu, den sie zynisch erwiderten. Er sah Thor abfällig an.
„Die Rekruten wurden schon vor Stunden mit dem königlichen Transportzug hereingebracht. Wenn du nicht eingeladen wurdest, kannst du nicht eintreten.“
„Aber Ihr versteht nicht. Ich muss—“
Der Wachmann streckte die Hand aus und packte Thor am Hemd.
„Du verstehst wohl nicht, du unverschämter kleiner Junge. Wie kannst du es wagen, hier aufzutauchen und zu versuchen, dich hineinzuzwängen? Und jetzt hau ab—bevor ich dich in Ketten lege.“
Er versetzte Thor einen Stoß, der ihn mehrere Fuß weit zurückwarf.
Thor spürte ein Stechen auf der Brust, wo die Hand des Wachmanns ihn gestoßen hatte—doch umso mehr spürte er den Stich der Abweisung. Er war empört. Er war nicht bis hierher gekommen, um von einem Wachmann abgewiesen zu werden, ohne überhaupt angesehen worden zu sein. Er war entschlossen, es bis hinein zu schaffen.
Der Wachmann drehte sich wieder seinen Männern zu, und Thor zog langsam von dannen, links um das kreisförmige Gebäude herum. Er hatte einen Plan. Er ging weiter, bis er außer Sichtweite war, dann verfiel er in ein gemächliches Lauftempo, seinen Weg an der Mauer entlang ziehend. Er versicherte sich, dass die Wachen ihn nicht beobachteten, dann wurde er schneller. Als er den Bau zur Hälfte umrundet hatte, fand er eine weitere Möglichkeit, in die Arena zu gelangen: hoch oben befanden sich gewölbte Öffnungen im Stein, die von Eisengittern versperrt waren. In einer dieser Öffnungen fehlte das Gitter. Er hörte erneut Gejubel, zog sich auf die Kante hoch und blickte hinein.
Sein Herz schlug höher. Da, über den riesigen, kreisrunden Trainingsplatz verteilt, standen dutzende Rekruten—einschließlich seiner Brüder. In Reih und Glied aufgestellte standen sie einem Dutzend der Silbernen gegenüber. Des Königs Mannen gingen durch die Reihen und begutachteten sie.
Eine weitere Gruppe von Rekruten stand etwas abseits, unter den wachsamen Augen eines Soldaten, und warf Speere auf ein fernes Ziel. Einer von ihnen warf daneben.
Thors Adern brannten vor Empörung. Er hätte dieses Ziel treffen können; er war genauso gut wie jeder Beliebige von denen. Nur weil er jünger war, etwas kleiner vielleicht, war es noch lange nicht gerecht, dass er übergangen wurde.
Plötzlich spürte Thor eine Hand auf seinem Rücken, wurde nach hinten gerissen und flog durch die Luft. Er landete hart auf dem Boden unter ihm; der Aufprall nahm ihm den Atem.
Er blickte hoch und sah den Wachmann vom Tor, der höhnisch auf ihn herabblickte.
„Was habe ich dir gesagt, Junge?“
Bevor er reagieren konnte, holte der Wachmann aus und verpasste Thor einen kräftigen Tritt. Thor spürte einen scharfen Schlag gegen seine Rippen, und der Wachmann holte zu einem weiteren Tritt aus.
Diesmal fing Thor den Fuß des Wachmanns in der Luft ab; er zog an ihm, bis dieser das Gleichgewicht verlor und hinfiel.
Thor stand schnell wieder auf den Füßen. Zur gleichen Zeit stand auch der Wachmann wieder auf. Thor starrte ihn an, schockiert darüber, was er gerade getan hatte. Ihm gegenüber blickte der Wachmann zornig zurück.
„Ich werde dich nicht nur in Ketten legen“, fauchte der Wachmann, „ich werde dich für das hier auch bezahlen lassen. Niemand vergreift sich an einer königlichen Wache! Einen Beitritt zur Legion kannst du vergessen—jetzt wirst du in den Kerkern versauern! Du hättest Glück, wenn dich je wieder jemand zu Gesicht bekäme!“
Der Wachmann holte eine Kette mit Schellen an den Enden hervor. Er trat Thor mit einem rachsüchtigen Ausdruck auf dem Gesicht näher.
Thors Gedanken rasten. Er konnte nicht zulassen, dass er in Ketten gelegt wurde—aber ein Mitglied der königlichen Wache verletzen wollte er auch nicht. Er musste sich etwas einfallen lassen—und zwar schnell.
Da fiel ihm seine Schleuder ein. Seine Reflexe übernahmen die Kontrolle, als er sie packte, einen Stein auflegte, zielte, und losließ.
Der Stein flog durch die Luft und schlug dem verblüfften Wachmann die Fesseln aus der Hand; er traf aber auch die Finger des Mannes. Der Wachmann zog die Hand zurück und schüttelte sie brüllend vor Schmerz, während die Fesseln zu Boden rasselten.
Der Wachmann warf Thor einen mörderischen Blick zu. Er zog sein Schwert. Es kam mit einem unverkennbaren metallischen Klingen zum Vorschein.
„Das war dein letzter Fehler“, grollte er bedrohlich und griff an.
Thor hatte keine Wahl: dieser Mann würde ihn einfach nicht in Ruhe lassen. Er legte einen weiteren Stein in seine Schleuder und schoss. Er zielte bewusst: er wollte den Mann nicht töten, aber er musste ihn aufhalten. Anstatt also auf sein Herz, seine Nase, Augen oder seinen Kopf zu zielen, zielte Thor auf die eine Stelle, von der er wusste, es würde ihn aufhalten, aber nicht umbringen.
Zwischen seine Beine.
Er ließ den Stein fliegen—nicht mit voller Kraft, aber ausreichend, um den Mann zu Boden zu bringen.
Es war ein perfekter Treffer.
Der Wachmann kippte vornüber, ließ sein Schwert fallen, hielt sich den Schritt, brach auf den Boden zusammen und krümmte sich.
„Dafür wirst du hängen“, ächzte er unter Schmerzen. „Wache! Wache!“
Thor blickte hoch und sah in der Ferne mehrere Männer der königlichen Wache auf ihn zulaufen.
Jetzt oder nie.
Ohne einen weiteren Augenblick zu vergeuden, spurtete er auf die Kante unter dem Fenster zu. Er würde durchspringen müssen, in die Arena hinein, und auf sich aufmerksam machen müssen. Und er würde jeden bekämpfen, der sich ihm in den Weg stellte.
KAPITEL FÜNF
MacGil saß in der oberen Halle seiner Burg, in seiner Kammer für vertraulichere Besprechungen, die er für persönliche Angelegenheiten benutzte. Er saß auf seinem persönlichen Thron—dieser war aus Holz gefertigt—und blickte auf die vier seiner Kinder, die vor ihm standen. Zuerst sein ältester Sohn, Kendrick, mit seinen fünf-und-zwanzig Jahren ein feiner Krieger und ein wahrer Edelmann. Von allen Kindern sah er MacGil am meisten ähnlich—was ironisch war, da er ein Bastard war, MacGils einziger Nachkomme von einer anderen Frau; einer Frau, die er längst vergessen hatte. MacGil hatte Kendrick trotz der anfänglichen Proteste seiner Königin mit seinen ehelichen Kindern gemeinsam aufgezogen, unter der Bedingung, dass er nie den Thron besteigen würde. Darunter litt MacGil nun, da Kendrick der anständigste Mann war, den er je gekannt hatte; ein Sohn, der ihn stolz machte, sein Vater zu sein. Das Königreich könnte sich keinen feineren Nachfolger wünschen.
Im starken Kontrast dazu stand neben ihm sein zweitgeborener—jedoch der erstgeborene legitime—Sohn Gareth, drei-und-zwanzig, mager, mit hohlen Wangen und großen braunen Augen, die pausenlos in Bewegung waren. Charakterlich konnte er seinem älteren Bruder nicht unähnlicher sein. Gareths Charakter war alles, was Kendricks nicht war: wo sein Bruder offenherzig war, versteckte Gareth seine wahren Gedanken; wo sein Bruder stolz und nobel war, war Gareth durchtrieben und hinterlistig. Es schmerzte MacGil, dass er seinen eigenen Sohn nicht leiden konnte, und er hatte viele Male versucht, dessen Natur geradezubiegen; doch es kam ein Punkt in den Jugendjahren des Jungen, an dem er sich eingestehen musste, dass seine Natur festgelegt war: intrigant, machthungrig, und alle falschen Arten von ehrgeizig. Gareth, so wusste MacGil auch, hatte nichts für Frauen übrig und hatte zahlreiche Liebhaber. Andere Könige hätten einen solchen Sohn verstoßen, doch MacGil war aufgeschlossener und für ihn stellte dies keinen Grund dar, ihn nicht zu lieben. Er verurteilte ihn nicht dafür. Wofür er ihn sehr wohl verurteilte, war seine boshafte, intrigante Natur, über die er nicht einfach hinwegsehen konnte.
In der Reihe neben Gareth stand MacGils zweitgeborene Tochter Gwendolyn. Gerade erst ihr sechzehntes Lebensjahr erreicht, war sie eines der schönsten Mädchen, die seine Augen je gesehen hatten—und ihr Gemüt überstrahlte sogar ihr Aussehen: sie war gütig, großherzig, aufrichtig—die feinste junge Frau, die er je gekannt hatte. In dieser Hinsicht war sie seinem Kendrick ähnlich. Sie sah MacGil mit der Liebe einer Tochter für ihren Vater an, und er spürte stets ihre Loyalität, mit jedem Blick. Er war auf sie sogar noch stolzer als auf seine Söhne.
Neben Gwendolyn stand MacGils jüngster Sohn Reece, ein stolzer und temperamentvoll junger Mann, der mit seinen vierzehn Jahren gerade erst dabei war, ein Mann zu werden. MacGil hatte seiner Aufnahme in die Legion mit großer Freude entgegengesehen, und er konnte jetzt bereits den Mann in ihm sehen, zu dem er werden würde. Eines Tages, da hatte MacGil keine Zweifel, würde Reece sein feinster Sohn sein, und ein großer Herrscher. Doch dieser Tag war noch nicht gekommen. Er war noch zu jung und hatte noch zu viel zu lernen.
MacGil betrachtete diese vier Kinder mit gemischten Gefühlen, seine drei Söhne und seine Tochter, wie sie so vor ihm standen. Er verspürte Stolz gemischt mit Enttäuschung. Er verspürte außerdem Ärger und Gereiztheit darüber, dass zwei seiner Kinder fehlten. Die Älteste, seine Tochter Luanda, bereitete sich natürlich gerade auf ihre eigene Hochzeit vor, und da sie in ein anderes Königreich verheiratet wurde, hatte sie keinen Anteil an der Debatte über die Nachfolge. Aber sein anderer Sohn Godfrey, der mittlere, achtzehn Jahre alt, war nicht anwesend. MacGil wurde lief beim Gedanken an diese Missachtung rot an.
Seit er ein kleiner Junge gewesen war, wies Godfrey eine derartige Respektlosigkeit gegenüber dem Königtum auf, dass es stets klar war, dass sie ihn nicht interessierte und er niemals regieren würde. Zu MacGils größter Enttäuschung zog Godfrey es stattdessen vor, seine Tage gemeinsam mit nichtsnutzigen Freunden in Kneipen zu vergeuden und der königlichen Familie immer größer werdende Schmach und Unehre einzubringen. Er war ein Taugenichts, verschlief die meisten seiner Tage und füllte den Rest davon mit Trunk. Auf der einen Seite war MacGil erleichtert, dass er nicht hier war; auf der anderen stellte es eine Beleidigung dar, die er nicht übersehen konnte. Er hatte dies allerdings vorausgesehen und seine Mannen frühzeitig ausgeschickt, um die Kneipen zu durchkämmen und ihn zurückzubringen. MacGil saß schweigend da und wartete darauf, dass dies eintrat.
Die schwere Eichentür wurde schließlich aufgestoßen und herein marschierten die königlichen Wachen, Godfrey zwischen sich schleppend. Sie gaben ihm einen Schubs und Godfrey stolperte in den Raum, während sie die Tür hinter ihm zuschlugen.
Die Kinder drehten sich zu ihm um und starrten. Godfrey war eine ungepflegte Erscheinung, stank nach Bier, war unrasiert und nur halb bekleidet. Er lächelte ihnen entgegen. Unverschämt. Wie immer.
„Hallo Vater“, sagte Godfrey. „Habe ich den ganzen Spaß verpasst?“
„Du wirst dich zu deinen Geschwistern stellen und warten, bis ich gesprochen habe. Wenn du das nicht tust, so hilf mir Gott, werde ich dich in Ketten legen und zu den anderen gemeinen Gefangenen in den Kerker stecken, und du wirst für volle drei Tage kein Essen—geschweige denn Bier—zu sehen bekommen.“
Godfrey stand trotzig da und warf seinem Vater einen giftigen Blick zu. In diesem Blick erkannte MacGil eine tief verborgene Kraftreserve, etwas von ihm selbst, einen Funken von etwas, das Godfrey eines Tages von großem Dienst sein könnte. Das heißt, wenn er je über seinen eigenen Schatten springen konnte.
Trotzig bis zum Ende wartete Godfrey gute zehn Sekunden, bevor er sich schließlich fügte und zu den anderen hinüberschlurfte.
Wie sie alle so dastanden, betrachtete MacGil eingehend diese fünf Kinder: den Bastard, den Abwegigen, den Trunkenbold, seine Tochter und seinen Jüngsten. Es war eine eigentümliche Mischung und er konnte kaum glauben, dass sie alle von ihm stammten. Und nun, am Hochzeitstag seiner ältesten Tochter, war es nun schlussendlich seine Aufgabe, aus diesem Haufen einen Erben zu wählen. Wie sollte das möglich sein?
Es war eine sinnlose Geste: immerhin stand er in seinen besten Jahren und konnte noch gut weitere dreißig Jahre regieren; welchen Erben auch immer er heute erwählte, er würde den Thron vielleicht noch jahrzehntelang nicht besteigen. Diese gesamte Tradition verärgert ihn. Sie mag vielleicht zu Zeiten seiner Vorväter von Bedeutung gewesen sein, aber sie hatte keinen Platz mehr in der heutigen Zeit.
Er räusperte sich.
„Wir sind hier heute versammelt, um einer Tradition Ehre zu erweisen. Wie ihr wisst, fällt mir an diesem Tag, dem Tag der Hochzeit meines ältesten Kindes, die Aufgabe zu, einen Nachfolger zu nennen. Einen Erben der Herrschaft über dieses Königreich. Sollte ich sterben, so gäbe es keinen geeigneteren Herrscher als eure Mutter. Doch die Gesetze unseres Reiches gebieten, dass nur der Nachkomme eines Königs die Thronfolge antreten kann. Und so muss ich wählen.“
MacGil hielt den Atem an und dachte nach. Eine bleierne Stille hing in der Luft, und er spürte das Gewicht der Erwartung. Er sah ihnen in die Augen und sah in jedem einen anderen Ausdruck. Der Bastard blickte resigniert im Wissen, dass die Wahl nicht auf ihn fallen würde. Die Augen des Abwegigen glühten vor Ehrgeiz, als ob für ihn klar wäre, dass die Wahl auf ihn fallen müsse. Der Trunkenbold blickte aus dem Fenster; ihm war es egal. Seine Tochter blickte liebevoll zurück, wissend, dass sie nicht Teil dieser Debatte war, und dennoch voller Liebe für ihren Vater. Mit seinem Jüngsten war es dasselbe.
„Kendrick, ich habe dich stets als einen wahren Sohn betrachtet. Doch die Gesetze unseres Reiches verhindern, dass ich die Herrschaft an jemanden von weniger als vollständiger Legitimität weitergebe.“
Kendrick verbeugte sich. „Vater, ich hatte nicht erwartet, dass du dies tun könntest. Ich bin mit meinem Los zufrieden. Bitte lass dich dadurch nicht beunruhigen.“
MacGil schmerzte seine Antwort, da er spürte, wie aufrichtig sie war, und er wollte ihn nur noch mehr zum Erben ernennen.
„Damit bleibt ihr vier. Reece, du bist ein feiner junger Mann, der feinste, den ich je gesehen habe. Doch du bist zu jung, um Teil dieser Debatte zu sein.“
„Damit habe ich gerechnet, Vater“, antwortete Reece mit einer leichten Verbeugung.
„Godfrey, du bist einer meiner drei legitimen Söhne—und doch ziehst du es vor, deine Tage in den Kneipen zu vergeuden, zusammen mit dem Abschaum. Dir wurde jede Gunst im Leben zuteil, und du hast jede davon verschmäht. Wenn ich in diesem Leben eine große Enttäuschung zu tragen habe, so bist es du.“
Godfrey verzog zur Antwort sein Gesicht und fühlte sich sichtlich unwohl.
„Nun, dann bin ich hier wohl fertig und kann zurück in die Kneipe, nicht wahr, Vater?“
Mit einer flüchtigen, respektlosen Verbeugung drehte Geoffrey sich um und stakste zur Tür.
„Wirst du wohl zurück kommen!“, schrie MacGil. „SOFORT!“
Godfrey stolzierte weiter, ihn völlig ignorierend. Er durchquert den Raum und zog die Türe auf. Dort standen zwei Wachen.
MacGil kochte vor Wut, während die Wachen ihn fragend ansahen.
Doch Godfrey zögerte nicht lange; er schob sich an ihnen vorbei in den offenen Flur.
„Nehmt ihn fest!“, schrie MacGil. „Und seht zu, dass er der Königin nicht unter die Augen kommt. Ich möchte seine Mutter am Hochzeitstag ihrer Tochter nicht mit seinem Anblick belasten.“
„Jawohl, Herr“, sagten sie und schlossen die Tür, bevor sie ihm nacheilten.
MacGil saß schwer atmend mit hochrotem Gesicht da und versuchte, sich zu beruhigen. Zum tausendsten Mal fragte er sich, was er angestellt hatte, um so ein Kind zu verdienen.
Er blickte zurück auf seine verbleibenden Kinder. Die vier standen da und warteten in der schweren Stille. MacGil holte tief Luft und versuchte, sich zu konzentrieren.
„Somit bleiben zwei von euch übrig“, fuhr er fort. „Und aus diesen zweien habe ich einen Nachfolger erwählt.“
MacGil wandte sich an seine Tochter.
„Gwendolyn, das wirst du sein.“
Ein überraschtes Schweigen erfüllte den Raum; seine Kinder sahen alle schockiert aus, am meisten jedoch Gwendolyn.
„Hast du richtig gesprochen, Vater?“, fragte Gareth. „Sagtest du Gwendolyn?“
„Vater, ich fühle mich geehrt“, sagte Gwendolyn. „Aber ich kann es nicht annehmen. Ich bin eine Frau.“
„Es ist wahr, noch nie zuvor hat eine Frau auf dem Thron der MacGils gesessen. Doch ich habe beschlossen, dass es an der Zeit ist, die Tradition zu ändern. Gwendolyn, du bist von feinstem Verstand und Gemüt, feiner als ich es je in einer jungen Frau gesehen habe. Du bist jung, aber mit Gottes Willen werde ich nicht so bald sterben, und wenn die Zeit kommt, wirst du weise genug sein, um zu regieren. Das Königreich soll dir gehören.“
„Aber Vater!“, rief Gareth aus, sein Gesicht aschfahl. „Ich bin der älteste legitim geborene Sohn! Immer, in der gesamten Geschichte der MacGils, ging die Herrschaft auf den ältesten Sohn über!“
„Ich bin der König“, erwiderte MacGil düster, „und ich bestimme die Tradition.“
„Aber das ist nicht gerecht!“, flehte Gareth mit klagender Stimme. „Ich bin es, der König sein sollte. Nicht meine Schwester. Nicht eine Frau!“
„Zäume deine Zunge, Junge!“, rief MacGil, zitternd vor Zorn. „Wagst du es, mein Urteil zu hinterfragen?“
„Werde ich also zugunsten einer Frau übergangen? So also denkst du von mir?“
„Ich habe meine Entscheidung getroffen“, sagte MacGil. „Du wirst sie respektieren und dich ihr gehorsam fügen, so wie jeder andere Untertan in meinem Königreich. Und nun könnt ihr alle gehen.“
Seine Kinder beugten rasch ihre Köpfe und eilten aus dem Zimmer.
Nur Gareth blieb an der Tür stehen, unfähig, sich zu überwinden, den Raum zu verlassen.
Er kehrte um und stellte sich alleine seinem Vater.
MacGil konnte die Enttäuschung in seinem Gesicht lesen. Sichtlich hatte er erwartet, heute zum Erben benannt zu werden. Mehr noch: er hatte es begehrt. Unbedingt. Was MacGil nicht im Geringsten überraschte—und was genau der Grund war, warum er es ihm nicht gewährt hatte.
„Warum hasst du mich, Vater?“, fragte er.
„Ich hasse dich nicht. Ich finde dich nur nicht geeignet, mein Königreich zu regieren.“
„Und warum das?“, bestand Gareth.
„Weil es genau das ist, was du begehrst.“
Gareths Gesicht lief feuerrot an. Offenbar hatte MacGil ihm einen Einblick in seine wahre Natur verschafft. MacGil beobachtete seine Augen, sah, wie sie von einem Hass für ihn erfüllt waren, den er nie für möglich gehalten hätte.
Ohne ein weiteres Wort stürmte Gareth aus dem Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu.
Das hallende Echo ließ MacGil erschaudern. Er dachte an den Blick seines Sohnes zurück und verspürte einen Hass von enormer Tiefe, tiefer noch als der seiner Feinde. In dem Moment erinnerte er sich an Argons Worte, seine Ankündigung, dass Gefahr nahe lag.
Konnte sie gar so nahe liegen?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.