Gottes Herz für dein Dorf
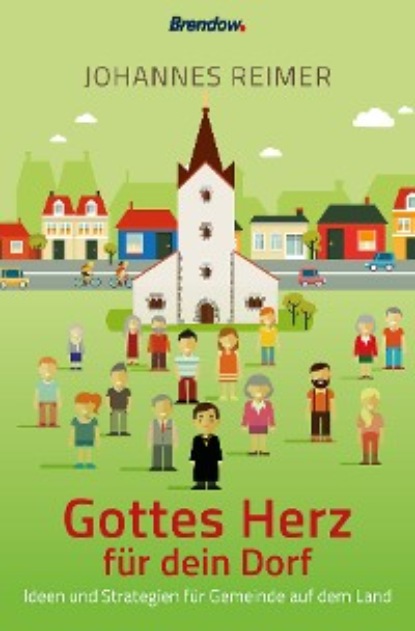
- -
- 100%
- +
Traditionsbewusstsein kann zu einer gewissen Erstarrung von Gemeindeinhalten und Strukturen führen. Karl Barth schrieb vor Jahren über eine in Traditionen verhaftete Gemeinde: „Sie kann sich nicht mehr erneuern, sondern erzeugt immer wieder Gesetzlichkeit, und die Freude am Evangelium erlischt.“19 Das ist sicher ein Grund, warum man heute auf dem Land so wenig geistliches Leben findet. Aber Traditionen haben auch positive Seiten. Sie halten Symbole hoch, die für Fremde zu einem willkommenen Anlass werden können, sich doch einmal Gedanken über den eigenen Glauben zu machen.
Mir fällt an dieser Stelle Sabine ein. Sie ist 50 und erst vor Kurzem aus Köln in das kleine idyllisch gelegene Dorf im Sauerland gezogen. Mitten im Dorf liegt die jahrhundertealte katholische Kirche. Schon lange werden hier keine regelmäßigen Gottesdienste mehr angeboten. Aus Pfarrermangel, wie es offiziell heißt. Sabine ist weder katholisch noch gläubig. Trotzdem sagt sie von sich:
„Ich gehe mittlerweile regelmäßig in die Kirche. Die Ruhe in ihren Räumen, das sakrale Etwas, tut mir gut. Die Erinnerungen nach der Scheidung von meinem Mann verstummen dann. Irgendwie finde ich hier zu mir selbst. Manchmal rede ich vor mich hin, klage den alten Mauern meine Situation. Oder auch den Bildern an den Wänden. Neulich konnte ich mir sogar zum ersten Mal vorstellen, dass es vielleicht doch so etwas wie Gott gibt.“
Sabine ist bei Weitem nicht die Einzige, die so etwas in verlassenen Landkirchen erlebt. Tausende begeben sich auf ihrer Suche nach Stille, Sinn und spiritueller Lebenstiefe aufs Land. Manche Landregionen werben bereits mit entsprechenden Angeboten, so beispielsweise das Tölzer Land in Bayern.20 Pilgerschaften, Wanderschaften, Zeiten der Stille und des Schweigens – all das scheint der gestressten Seele in unserer schnelllebigen Welt gutzutun.
Natürlich bezieht sich ein solch dörfliches Traditionsbewusstsein nicht nur auf das Kirchengebäude und die Erhaltung religiöser Bräuche. Da kann es auch um ein altes Backhaus oder den Dorfversammlungsplatz gehen. Wo wenige Menschen auf beschränktem Raum zusammenleben, sind gemeinsame Werte von ganz besonderem Interesse. Sie nicht zu fördern ist auf kurz oder lang kontraproduktiv. Man gewinnt Beachtung bei den Menschen nur dann, wenn man ihren Lebensstil und ihre Geschichte wertschätzt.
Es macht daher Sinn, altbewährte Strukturen mit Leben zu füllen, statt völlig neue zu schaffen. Die Renovierung einer alten Kirche kann deshalb mehr bewirken als der Bau eines völlig neuen Gemeindezentrums. Der Aufbau neuer Formen des Glaubens sollte traditionelle Strukturen berücksichtigen.
2.3.Menschen und Gemeinschaft
Christliche Gemeinden auf dem Land müssen auf die Menschen in ihrem Gemeinwesen hören und sich ihrer Geschichte und Tradition stellen. Dass die Landbevölkerung schon lange nicht mehr so einheitlich gestrickt ist und, besonders in der Nähe der Städte, recht bunt zusammengewürfelt wurde, scheint nur bedingt bei den Gemeindeaufbau-Experten angekommen zu sein. Hier braucht es kreative Neuansätze. Der Glaubenssatz von Donald McGavran, der lange die Gemeindeentwicklung dominiert hat, hat sich im großen Ganzen als falsch erwiesen. McGavran schrieb:
„Menschen werden gerne Christen, wenn sie dazu nicht Rassen-, Klassen-, oder Sprachbarrieren überwinden müssen. [...] Alle Menschen bauen Mauern um ihre eigene gesellschaftliche Gruppe.“21
Heute wissen wir, dass es weniger die Konzentration auf die homogene Zielgruppe, sondern ein gemeinwesen-zentrierter Ansatz im Gemeindebau ist, der in der Stadt wie auf dem Dorf Erfolg verspricht. Menschen suchen Gemeinschaft im Alltag, und je bunter dieser Alltag ist, desto schneller suchen sie nach integrativen Wegen, mit Menschen, so anders diese auch sein mögen, gut und nachbarschaftlich auszukommen.
2.4.Typen ländlicher Räume und Gemeinden
In ihrer Studie zu Kirche im ländlichen Raum unterscheidet die EKD sieben Typen ländlicher Räume. Die Autoren der Studie schreiben: „So ist – in Aufnahme einer verbreiteten Unterscheidung nach Zentrenerreichbarkeit und Bevölkerungsdichte – zwischen: Peripherieräumen (dünn besiedelte Gebiete, größere Entfernung zu Zentren), Zwischenräumen (erweitertes Umland der Zentren, mittlere Siedlungsdichte) und Zentralräumen (städtische Siedlungsgebiete mit Siedlungskorridoren, hohe Siedlungsdichte) zu unterscheiden.“22
Diese Typen reflektieren die komplexer gewordene soziale Welt auf dem Land:
Typ 1: Strukturschwache Räume
Der strukturschwache Raum beschreibt das, was Bischof Russel als das „marginalisierte, weit entfernte Land“ bezeichnet hat. Die EKD-Studie spricht auch vom „Peripherieraum mit geringer Bevölkerungsdichte“23. Entfernt von der Stadt, Industrie und Entwicklungsschwerpunkten stellt sich dieser Raum in jeder Hinsicht als weniger entwickelt dar.
Mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als 100 Einwohnern pro Quadratkilometer stehen diese Räume in allen Fragen gesellschaftlicher Entwicklung hintenan. Die soziale, infrastrukturelle und demographische Erosion sind an der Tagesordnung. Die Bevölkerung überaltert, junge Leute ziehen auf der Suche nach Arbeit weg. Und die Kirche verliert ihre Mitglieder und Mitarbeiter. Was das im Einzelnen heißen kann, zeigt das Beispiel der Evangelisch-Lutherischen Kirche Mecklenburgs:
„Die Propstei Stargarder Land in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs umfasst 10 Kirchgemeinden, in denen 53 Kirchen und Kapellen stehen, drei Gemeindezentren und viele Pfarrhäuser und in der knapp 6.000 Mitglieder leben. Sie wohnen auf einer Fläche von ca. 50 Kilometern Länge und 25 Kilometern Breite. Es gibt 7,5 Pfarrstellen, drei Stellen für gemeindekatechetische Mitarbeitende (die sich fünf Mitarbeitende teilen), einen Jugendmitarbeiter (für eine Hälfte des Kirchenkreises), eine befristete Projektstelle für Kirchenmusik (finanziert von der Landeskirche) und einige kleine Honorarstellen für Kirchenmusik und Sekretariatsarbeit.
Die Bevölkerungszahlen in der Region gehen stark zurück, sie sind zwischen 1989 und 2003 um knapp 12 % gesunken, die Zahl der Gemeindeglieder sogar noch stärker. Drei Viertel dieses Verlustes sind darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen sterben als geboren werden, ein Viertel hängt mit der Abwanderung aus der Region zusammen. Das Land verliert wichtige Unternehmen und gut ausgebildete Menschen. Die Zahlen der Arbeits- und Ausbildungsplätze gehen zurück. Etwa 20 % der Einwohner sind arbeitslos. Vor 13 Jahren war Mecklenburg-Vorpommern noch das jüngste Bundesland, 2020 wird es wohl das älteste sein. Damit ist deutlich, dass das Land nicht nur seine Jugend verliert, sondern auch seine Dynamik und Zukunftsfähigkeit.“ 24

Typ 2: Periphere Räume mit einzelnen Entwicklungsfeldern
Periphere Räume oder in den Worten Russels „weniger zugängliche Räume“, markieren die Grenze zwischen strukturschwachen und dynamischen Regionen.25 In peripheren Räumen können sich neben effektiver Landwirtschaft auch touristische Betriebe ansiedeln, was die Chancen auf Arbeit für die ansässige Bevölkerung erhöht und auch saisonale Arbeiter anzieht.

Typ 3: Periphere Räume mit ausgesprochener Eigendynamik
Dieser Typ zeichnet sich durch Nähe zu den Klein- und Mittelstädten aus. Hier siedeln sich an zentralen Verkehrsadern der Region mittelständische Wirtschaftsbetriebe in ländlichen Industriezonen an. Sie bieten Arbeit. Der günstige Wohnraum auf dem Land, vorhandene Arbeit und Ausbildung für junge Leute mindern die Abwanderung der Bevölkerung und unterstützen den Ausbau der Infrastruktur vor Ort.27

Typ 4-5: Ländliche Räume im weiteren Umfeld von Verdichtungsgebieten
Bei den ländlichen Räumen im weiteren Umfeld von Verdichtungsgebieten handelt es sich um klassische Zwischenräume, die in der Nähe der Städte entstehen und die sowohl die aufs Land ziehende städtische als auch die in die Stadt drängende ländliche Bevölkerung anziehen.

Typ 6-7: Ländliche Räume im engeren Umfeld von Verdichtungsgebieten
Die hier genannten Räume grenzen direkt an urbane Gebiete an und bieten der Stadt Wachstumsräume. Hier kommt es zu den typisch suburbanen Entwicklungen, die je nach Stadt positiv oder negativ ausfallen. Wächst die Stadt, so wächst die Zwischenstadt, der Vorort, mit, geht sie ein, so leidet auch das verstädterte Umland.29

2.5.Kirche auf dem Dorf
Die Kirche gehört zum europäischen Dorf wie die Landwirtschaft. Das ist seit Jahrhunderten so. Hier liegen die Wurzeln christlicher Identität Europas. Dörfer entstanden einst um die Kirche herum und die Städte um die Dörfer. Als im Mittelalter immer mehr städtische Siedlungen entstanden, blieben am Anfang die Pfarrkirchen außerhalb dieser in den Dörfern. Ein klassisches Beispiel ist die Stadt Ulm. Bevor das Ulmer Münster gebaut wurde, wurde das kirchliche Leben von dem auf dem Land liegenden Kloster Reichenau bestimmt. Erst mit dem zunehmenden ökonomischen Erfolg der Stadt wanderten auch die kirchlichen Autoritäten dorthin. Die Dorfbewohner wehrten sich, ihre Pfarrei in die Stadt zu verlegen. Daher pflegt man bis heute „Lass die Kirche im Dorf“ zu sagen.
Die Kirche auf dem Dorf ist somit ein Symbol christlicher Identität und immer noch in einem Gemeindemodell verhaftet, das aus einer Zeit kommt, als wir in Europa noch christlich waren. Tim Chester und Steve Timmis nennen es das „christliche System“, das nach dem Motto zu funktionieren schien: „Ring the bell and the people come“ (Lass die Glocken läuten, und die Menschen kommen).31
Die Glocken mögen auf dem Dorf immer noch läuten, nur die Menschen kommen nicht mehr. Der Säkularismus hat auch die Landbevölkerung erfasst. Was gestern noch so selbstverständlich war (Jeder Bauer hatte seine Kirche.), ist heute ganz und gar nicht mehr selbstverständlich. Wer heute Gemeinde auf dem Land bauen will, der muss damit rechnen, dass auch hier die meisten Menschen der Kirche den Rücken gekehrt haben, auch wenn zumindest die traditionelle Landbevölkerung immer noch formal der Kirche angehört.
Die neue Landbevölkerung geht dagegen nicht mehr geschlossen zur Kirche, jedenfalls nicht in den durchs Kirchenjahr bestimmten Gottesdienst. Man hat die dörfliche Bevölkerung in vier Gruppen eingeteilt:
(a) die Kirchenzentrierten;
(b) die Kirchenkulturellen;
(c) die Kirchendistanzierten und
(d) Anti-Kirchlichen.32
Dabei ist die erste Gruppe bei Weitem die Kleinste, und sie vermag es immer weniger, ein kirchliches pastorales Angebot für alle anzubieten, was Bernhard Spielberg als potenzielle Gefahr ansieht, dass die Kirche in eine „pastorale Mittelmäßigkeit“ abrutscht.33
Wenn überhaupt, dann ist die Kirche auf dem Land zu einem Ort undefinierter spiritueller Suche geworden. Obgleich das alte Gemäuer der Dorfkirchen auf einen gewissen säkularisierten Menschentyp eine magische Anziehungskraft auszuüben scheint. Die Frage aber lautet: Können Kirchen wieder zu Plätzen vitaler christlicher Spiritualität werden? Ich glaube: Ja, das können sie. Und Erfahrungen bestätigen meine Vermutung. Aber hierfür muss Kirche wieder zu ihrer eigenen Bestimmung zurückkehren und eben Kirche werden.
Fragen zum Nachdenken:
1.Wie erleben Sie das Dorfleben?
2.Was gehört typischerweise zum Dorf? Welche Charakteristika dörflichen Lebens finden Sie gut? Welche weniger?
Warum?
3.Zu welchem Typ ländlicher Raum gehört das Dorf, in dem Sie leben?
4.Was macht Ihrer Meinung nach kirchliches Leben in Ihrem Dorf so schwierig?
5.Wie würden Sie es verändern? Geht das überhaupt?
Kapitel 3
Dorfgemeinde Begriff und Wirklichkeit
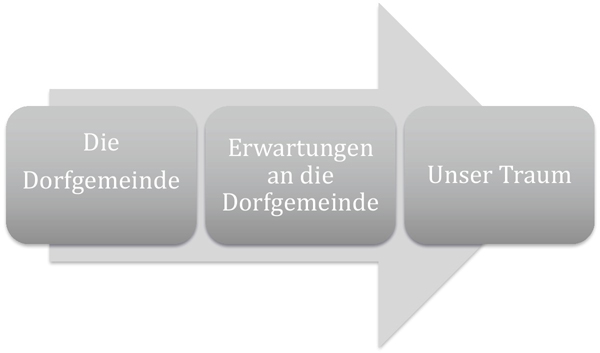
3.1.Die Dorfgemeinde
Die klassische Dorfgemeinde gibt es nicht mehr. Die EKD konstatiert:
„Es gibt nicht den einen ländlichen Raum, sondern sehr unterschiedliche ländliche Räume mit divergierenden Entwicklungstendenzen und folglich verschiedenen Herausforderungen und Chancen für das missionarische Wirken von Kirche.“34
Gemeindeaufbau auf dem Land wird sich deshalb auf unterschiedliche Gemeindekonzepte konzentrieren müssen, wenn man zu den entsprechenden Ergebnissen kommen möchte. Dabei ist es wichtig zu klären, was wir unter Gemeinde verstehen. Mit Luther entscheiden wir uns bewusst für den Begriff Gemeinde und nicht Kirche. Gemeinde ist, wo sich die Gläubigen versammeln.
Jesus drückt diesen Gedanken mit dem griechischen Begriff ekklesia aus, wenn er in Matthäus 16,18 sagt: „Ich will meine Gemeinde (ekklesia) bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden.“
Ekklesia beschreibt hier eine aus der Welt herausgerufene Gemeinschaft, die Verantwortung für die Welt übernehmen soll.35 Sie ist von ihrem Wesen her missionarisch und somit missional.36 Dabei steht „Welt“ an dieser Stelle immer für das lokale Gemeinwesen.37 In diesem Gemeinwesen hat sie ihren Platz.
Hier soll sie …
„Salz der Erde und Licht der Welt“ (Matthäus 5,13-15),
Botschafterin der Versöhnung mit Gott und Mensch (2. Korinther 5,18-20),
Gottes auserwähltes Volk (1. Petrus 2,10),
königliches Priestertum (1. Petrus 2,9-10) sein.
Mit anderen Worten: Mit seiner Gemeinde zeigt Gott den Menschen seine eigene Gestalt, den Leib Christi (Epheser 1,23), seine Gerechtigkeit (2. Korinther 5,21), ja sein Königreich. Sie ist „eine Bundesgemeinschaft, Zeichen und Vorgeschmack, Agent und Instrument der Herrschaft Gottes“.38
Der ekklesiale und damit lokale Charakter der Gemeinde als Versammlung der zur Verantwortung für die Welt berufenen Menschen bestimmt ihre kontextuelle Gestalt. Sie ist gesandt, wie Jesus gesandt wurde (Johannes 20,21). Und er kam in die Welt der Menschen als „Mensch wie wir ... nur ohne Sünde“ (Hebräer 4,15). Nur so konnten Menschen seine göttliche Herrlichkeit sehen (Johannes 1,1,14).
Analog dazu kann und muss die Gemeinde im Dorf eben das sein, was sie im Dorf ist – Dorfgemeinde, die die Verantwortung für Lebensräume im Dorf zugesprochen bekommen hat. Ihre Aufgabe im Dorf besteht darin, dem Leben Grundzüge eines unter der guten Herrschaft Gottes stehenden Gemeinwesens zu vermitteln. Mit anderen Worten, sie setzt sich für soziale Räume ein, in denen Gerechtigkeit, Wohlbefinden, Lebensfreude und Frieden herrschen. In solchen Räumen leben, arbeiten und feiern Menschen gern.
Hier wird das Wirklichkeit, was der Prophet Jesaja einmal seinem eigenen Volk Israel zugesagt hat: Menschen arbeiten und genießen das Werk ihrer Hände, sie bauen Häuser und leben selbst darin, sie setzen sich füreinander ein und kennen Gott persönlich (Jesaja 65,1ff.).
Natürlich ist das eine Vision, eine Zielvorgabe, aber nichts weniger meint Jesus, wenn er seinen Jüngern befiehlt, die Völker zu Jüngern zu machen (Matthäus 28,19-20).
Der Begriff Volk = griechisch ethnos steht für den soziokulturellen Raum und ist am besten als Gemeinwesen zu übersetzen. Man kann daher auch übersetzen: „Gehet in alle Welt und machet zu Jüngern alle Gemeinwesen.“ In unserem Fall ist das Gemeinwesen ein Dorf. Was aber bedeutet es, wenn die christliche Gemeinde sich auf dem Land bemüht, das ganze Dorf zum Jünger Jesu zu machen? Doch nur das Eine – dass die Einwohner des Dorfes so leben, wie Jesus es seine Jünger gelehrt hat.
Die Gemeinde Jesu ist somit für die Menschen da. So hat es Dietrich Bonhoeffer formuliert: „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.“39 Als solche müsse sie sich am allgemeinen Leben der Menschen beteiligen.40 Auch wenn andere, allen voran der Heidelberger Missionswissenschaftler Theo Sundermeier, Bonhoeffers Satz kritisiert haben und statt einer Kirche für Andere von der Kirche mit Anderen gesprochen haben41, bleibt klar – Gemeinde Jesu ist „von ihrem Wesen her als missionarische Gemeinde zu sehen“42. Sie ist es, weil Gott einen Plan mit den Menschen hat. Um Menschen geht es ihm. Für sie gab er „seinen eingeborenen Sohn hin auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben“ (Johannes 3,16).
Deswegen existiert die Kirche im Dorf, weil Gott Interesse an den Menschen dort und am Gelingen ihres Zusammenlebens hat. So gesehen ist sie der beste Liebesbeweis Gottes. In der Zuwendung Gottes zu den Menschen zeigt sich seine souveräne Herrschaft.
Es ist hilfreich, zwischen Gemeinde als Bewegung und Gemeinde als Institution zu unterscheiden.43 Kirche im Dorf ist zunächst und vor allem Gemeinde Jesu, aber als Dorfgemeinde wird sie sich als dörfliche Institution etablieren müssen, wenn die Einwohner in ihr eine Institution erkennen sollen, die zu ihnen gehört.
Jesus beispielsweise kam zu den Seinen, und man hat an seinem Äußeren erkannt, dass er Jude war. Paulus wiederum ging zu den Griechen und wurde unter ihnen wie ein Grieche (1. Korinther 9,19 ff.), um sie für Jesus zu gewinnen. Und so lehrte er auch die Gemeinde in Korinth – und folglich auch uns. Denn wenn wir aufs Land gehen, um die Landbevölkerung für den Glauben an Jesus zu gewinnen, sollte die Landbevölkerung an der Gemeinde erkennen, dass diese zu ihnen gehört.
Dekan Martin Reppenhagen hat acht Charakterzüge einer missionarischen Gemeinde formuliert. Danach (1) hat eine Gemeinde eine missionale Berufung, (2) lebt sie Nachfolge und Jüngerschaft mit der Bibel als Grundlage, (3) geht sie Risiken ein im Kontrast zur Welt, (4) verkörpert sie Gottes Absichten für die Welt, (5) hat sie den Gottesdienst im Zentrum, in dem sie Gott feiert, (6) lebt sie in Abhängigkeit zum Heiligen Geist und im Gebet, (7) ist sie Zeugin, Agentin, Instrument und Zeichen des anbrechenden Reichs Gottes (mit vorläufigem Charakter) und (8) hat sie eine missionale Autorität in der Gemeinde, um die missionale Berufung zu fördern.44
Alle diese Positionen beziehen sich auch auf die Gemeinde im Dorf, aber das dörfliche Leben wird jedem der acht Charakterpunkte seinen eigenen Stempel aufdrücken. Nur wer auf dem Dorf angekommen ist, kann auch eine Dorfgemeinde bauen. Edmonson schreibt mit Recht: „Effektive Evangelisation auf dem Land kann nur von Menschen gestaltet werden, die das ländliche Leben verstehen und sich hingegeben haben, auf dem Land zu leben.“45 Und der britische Gemeindeaufbau-Experte Stuart Murray behauptet gar, dass man kaum Gemeinden auf dem Land mit Menschen von außerhalb bauen kann.46
3.2.Erwartungen an die Dorfgemeinde
Gemeinde ist Gottes Pflanzung, aber sie ist in menschlicher Gestalt in der Welt. In ihr sehen Menschen Gottes Herrschaft im Vollzug. Hier können sie das Evangelium sehen, erfahren und hören. Durchaus können die Menschen Gottes Absichten am Leben der Gemeinde auch missverstehen. Was also können Menschen von der Gemeinde Jesu auf dem Dorf erwarten?
In einer Untersuchung im Unterallgäu, die erforschte, was Dorfbewohner von der Kirche im Dorf erwarten, sind unter anderem folgende Ergebnisse zutage getreten47.
Die Kirche soll …
(1)Glauben vermitteln,
(2)das Dorf zusammenbringen,
(3)soziales Leben schaffen und unterhalten,
(4)unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in die Gemeinschaft integrieren,
(5)seelsorgerliche Betreuung leisten,
(6)für Menschen in Notlagen sorgen,
(7)Menschen zum Ehrenamt motivieren,
(8)Heimatgefühle stiften sowie
(9)Ruhe und Kontemplation bieten.
Damit beschreiben die Unterallgäuer ziemlich genau die Bedürfnisse in ihrem Lebensraum. Die Kirche soll Verantwortung für ihren Lebensraum übernehmen, diesen gestalten und zum Besseren transformieren. Unmissverständlich schließen ihre Wünsche geistliche und soziale Aspekte ein. Glauben, Seelsorge und Gebet stehen hier neben sozialem Miteinander, Fürsorge, Integration und Heimat. Kann das eine Dorfgemeinde leisten? Muss sie es gar? Sind die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt? Und wenn sie es nicht schaffen kann, wie soll der Gemeindeaufbau all das leisten? Welche Art von Aufbau braucht die Gemeinde, und wer kann ihn leisten?
3.3.Wir hatten einen Traum
„Ein Traum von der Gemeinde: Mut zum Missionarischen Gemeindeaufbau“, so betitelt Bernd Schlottoff sein überaus lesenswertes Buch zum missionarischen Gemeindebau.48 Offenbar muss man ein Träumer sein, wenn man heute noch missionarische Gemeinden bauen will. Das gilt vor allem für den Gemeindeaufbau auf dem Land.
Ich bin ein solcher Träumer. Aber der Traum, den ich da träume, ist weniger das Ergebnis eines überreizten Gehirns, sondern einer von Gott geschenkten Vision. Mir wurde sie, zusammen mit einigen anderen, zum ersten Mal 1999 geschenkt. Gerade nach einem längeren Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückgekehrt, standen meine Frau und ich vor der Frage, welcher Gemeinde wir uns in der neuen Heimat im Bergischen Land anschließen würden. Doch dazu kam es nicht. Denn ein befreundetes Ehepaar sprach uns an, eine neue Gemeinde zu gründen, und zwar auf dem Dorf. Zugegeben, ich hätte mir einen solchen Auftrag niemals selbst gegeben. Ich bin eigentlich ein Stadtmensch. Obwohl auf dem Land geboren, habe ich den allergrößten Teil meines Lebens in der Stadt gelebt. Das Dorfleben war mir fremd. Die Einladung unserer Freunde traf uns also überraschend und stieß erst mal auf Ablehnung. Aber der Gedanke, gegen alle Vernunft den Gemeindeaufbau auf dem Land zu wagen, reizte uns.

