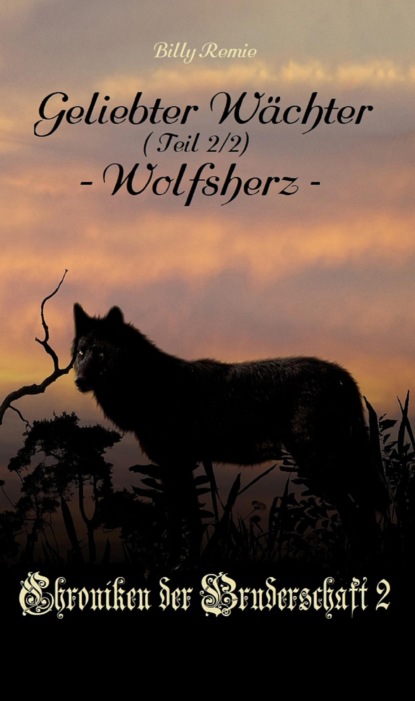- -
- 100%
- +
Für einen Moment war es lieblich ruhig und friedlich, so als würde die Zeit stillstehen. Er wünschte, dieser Moment würde ewig dauern und er müsste nie wieder aufstehen. Mit Bellzazar einfach hier zu sitzen und die Verbindung zwischen ihnen zu spüren, die greifbarer war als der Wind um sie herum, erfüllte ihn schlicht mit einem Frieden, den er niemandem hätte begreiflich machen können.
Er hätte es wohl auch nicht zugegeben.
Trotzdem runzelte er nach einem Moment die Stirn und stellte fest: »Etwas ist anders als sonst.«
Bellzazar gab einen Laut von sich, der sich wie ein Seufzen anhörte. »Du bist ja jetzt auch … anders.«
»Wir sind nicht wirklich hier«, warf Cohen ein und betrachtete mit Wehmut die Berge hinter dem Bachverlauf, »das ist nicht die Wirklichkeit.«
»Genau genommen, ist es schon Wirklichkeit, aber eben eine andere als jene, die du kennst«, warf Bellzazar mit seiner knurrenden Stimme ein, »du träumst. Das hier ist das Traumreich. Aber das heißt nicht, dass alles hier nicht auch irgendwie existiert. Was du siehst ist auch dann wahrhaftig, selbst wenn es verschwindet, sobald du die Augen öffnest.«
Cohen verzog die Lippen zu einem traurigen Ausdruck. »Es fühlt sich nicht an, als würde ich träumen, das meinte ich. Ich kann … fühlen. Mehr als je zuvor. Ich kann sogar den Wind fühlen, wie er durch die Bäume zieht, das Wasser, wie es die Steine im Bach schleift, das Leben in den Grashalmen.« Ratlos schüttelte er den Kopf. »Ich konnte in meinen Träumen noch nie irgendetwas fühlen.«
»Weil du ein Mensch warst«, erklärte Bellzazar und streckte dann seinen langen Körper genüsslich aus, ehe er den Wolfskopf wieder unter Cohens Arm hindurchzwängte und sich halb auf dessen Schoß legte. »Wenn Dämonen träumen, wandeln sie durch Träume. Manche von ihnen sind in der Lage, Sterbliche im Traumreich ausfindig zu machen und zu verführen, so können sie von ihnen Besitz ergreifen oder sie gar verzaubern. Du wirst dich daran gewöhnen, dein Verstand schläft eigentlich nie, und jetzt als Dämon nimmst du das ganz bewusst wahr. Das Traumreich ist auch nur eine andere Geisterwelt.« Seine Wolfsaugen leuchteten mystisch, als er beruhigend zu Cohen aufsah. »Deine Seele ist nun in der Lage, sich ganz frei und ganz bewusst hier zu bewegen, als wärest du wach, weil du im Grunde gar keinen Schlaf mehr benötigst. Wenn du in der anderen Welt einschläfst, bist du in dieser Welt wach, und schläfst du in dieser, erwachst du in der anderen.«
Cohen streckte die Beine aus und legte einen Arm um Bellzazars Hals. Sein schwarzes Fell fühlte sich speckig und heiß an, trotzdem grub er die langen Finger tief hinein und kraulte ihn ausgiebig. »Das ist mir zu kompliziert. Sagen wir einfach, als Dämon ist alles etwas anders.«
Der Wolf grollte, was sich wie ein dunkles Kichern anhörte, und rieb mit geschlossenen Augen den Kopf an Cohens flachem Bauch. »Langsam lernst du, nicht alles zu zerdenken.«
»Ja«, seufzte er und musste leicht lächeln. Und es fühlte sich gut an, nicht ständig alles zu hinterfragen und zu ergründen, Erklärungen zu suchen und immer nach Antworten zu forschen. Er hatte viel mehr Zeit für andere Gedanken.
Vielleicht war die Tatsache, dass er jetzt ein Dämon war schuld, aber irgendwie waren ihm gewisse Dinge gleichgültiger als vor dieser Wandlung. Vor allem die Tatsache, wo er war und bei wem er war und was er mit ihm gemacht hatte.
Hatte er zuvor noch eine gewisse Scham und Reue verspürt, wenn er daran dachte, wie er sich Bellzazar einfach hingegeben hatte, wurde ihm bei der Erinnerung jetzt nur noch warm.
Und wäre Bellzazar jetzt in Menschengestalt… Cohen schloss die Augen und stellte sich sehr lebhaft vor, wie er sich rittlings auf diesen rollen und gleichzeitig seine Hand unter das schwarze Hemd gleiten lassen würde. Wie er sich hinabbeugen und seine Zunge in Bellzazars Mund schieben würde. Allein der Gedanke, ihn zu berühren und zu schmecken und ihrer fleischlichen Begierde einfach ohne Hemmung nachzugeben, verursachte ihm einen prickelnden Schauer. Denn er wusste, wie stark sein Körper auf Bellzazar reagierte, wie intensiv sich seine Berührungen anfühlten, und dass er Cohen Erfüllung schenken würde.
Als hätte er Cohens inneren Nervenkitzel gespürt, knurrte Bellzazar leise und hob den Kopf an.
»Du bist jetzt ein Dämon, Coco«, sagte er mit mühsam beherrschter Wolfsstimme, »das heißt, du nährst dich von falschen und bösen Gefühlen. Von Leid, Gier und Wollust. Nicht, dass ich es nicht genießen würde, aber dennoch. Versuch wenigstens, dagegen anzukämpfen.«
Bellzazar erhob sich und schüttelte sein schwarzes Fell, als hätte ihn eine Armee Ameisen erfasst, die er abzuschütteln versuchte.
»Nein!«, sagte Cohen entschlossen und stand auf. »Warum sollte ich?« Er ballte die Hände zu Fäusten und sah entschlossen auf Bellzazar herab. »Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, meine Gefühle zu verschleiern, mich zu verstecken und zu verleugnen. Ich war ein Jäger, der seine Gabe vor der Kirche verbergen musste, für die ich kämpfte, weil mein Vater sich entschloss, ihr zur Macht zur verhelfen. Ich musste meine Liebe zu Männern vor dieser Kirche verstecken, und musste meine Begierde gegenüber meinem Bruder vor allem und jedem verbergen! Ich habe mein Leben lang mich selbst verleugnet und immer in Angst gelebt.« Seine Stimme war aufgebracht, er sprach sich geradezu in Rage. »Ich lebte ein schauriges, lebensfeindliches Leben auf dem Schlachtfeld.«
Bellzazar setzte sich wieder auf seinen fellbesetzten Hintern und legte neugierig den Wolfskopf schief, wobei seine zu langen Ohren wippten.
»Das ist jetzt vorbei!« Cohen ging vor ihm auf die Knie und sah ihm von Angesicht zu Angesicht tief in die blauen Augen. »Ich habe mein Leben im Schatten verbracht, Bell, und es immer dem Dienen anderer gewidmet, habe nie an mich gedacht. Aber jetzt habe ich eine zweite Chance. Du hast sie mir geschenkt! Ich mag ein Dämon und unsterblich sein, aber dennoch ist es eine zweite Gelegenheit, zu dem zu werden, der ich hätte werden können, wenn ich für, statt gegen meine Gefühle gekämpft hätte.«
»Und wer bist du?«, fragte ihn Bellzazar mit gelangweilter Stimme. Er kannte die Antwort, sie kannten sie beide.
Doch davon ließ Cohen sich nicht entmutigen. Er stieß den Atem schwer aus und ließ die angespannten Schultern sinken. »Das gilt es für mich, herauszufinden.«
Einen Moment lang forschten die mystischen Wolfsaugen in Cohens blutroten Iriden, als hielte er sein Gefühlshoch für einen Trugschluss. Vielleicht war dem auch so, vielleicht würde auf die Euphorie, die sein knappes Überleben ausgelöst hatte, ein schwarzes, trostloses Tief folgen.
Aber im Moment ging es Cohen gut und er wollte zuversichtlich bleiben.
»Ich will nicht mehr gegen mich selbst ankämpfen«, erklärte Cohen ruhiger.
Bellzazar verzog die Lefze wie zu seinem berühmten, schiefen Lächeln. »Ich wünschte, du könntest jetzt sehen, was ich sehe.«
Cohen musste schmunzeln. Er spielte das Spiel mit. »Und was siehst du?«
Die Züge des Wolfes wurden bedeutungsschwer, seine Stimme ernst. Wahrhaftig. »Ein Feuer, das heller und heißer als die Sonne lodert.«
Cohen zuckte mit den Achseln und wandte verlegen den Blick an. »Vielleicht bin ich zu überschwänglich, in Anbetracht der Tatsache, was ich jetzt bin. Aber ich fühlte mich nie … stärker.«
»Weil du es bist. Die dämonische Kraft wird sich immer weiter in dir ausbreiten«, warnte Bellzazar ihn und stand auf, um sich mit dem Kopf an seine Brust zu schmiegen. Auf einmal hatte Cohen das Gefühl, als wäre er in seinem Bewusstsein nicht mehr allein, als wäre Bellzazar mit ihm verschmolzen und sandte lebendige Wärme in sein Herz. »Du musst aufpassen, dass dich kein Hochmut befällt, Coco. Kämpfe gegen deine dämonische Seite an, dann wirst du nicht zu dem, was du einst abgrundtief gehasst hast.«
Cohen geriet ins Grübeln. Er schlang den Arm um Bellzazars Hals und legte den Kopf auf seinen. Er horchte tief in sich hinein und spürte die Kräfte in seinem Inneren gegeneinander aufbegehren. Da war der Wille, alles gleichgültig werden zu lassen und nur noch an sich selbst zu denken, stärker und unbesiegbar zu werden, sich gar an jenen zu rächen, die ihm einst Leid zugefügt hatten – nicht, dass davon noch jemand lebte. Aber da war auch … Wärme und Liebe, die ihn ermahnte, sich vor dem Hass in Acht zu nehmen.
Es fiel ihm nicht schwer, die Liebe festzuhalten, er musste nur an eine gewisse Person denken.
»Du weißt, ich würde nie jemandem absichtlich Leid zufügen«, sagte er laut zu Bellzazar.
»Das nicht«, stimmte der Wolf zu, »wenn jemand dazu gemacht ist, seiner dunklen Seite zu widerstehen, dann du. Aber so leicht ist es nicht, Coco. Du musst niemandem wehtun, um deine dämonische Seite zu füttern, es genügt bereits, wenn du in die sterbliche Welt trittst und jemand in deiner Nähe Leid empfindet. Du wirst es aufsaugen wie trockene Erde einen Tropfen Regen.«
Cohen verspürte nun doch einen Anflug Nervosität. Er hob den Kopf und Bellzazar sah ihm ins Gesicht. »Dann kann ich gar nichts tun, um es zu verhindern? Es passiert einfach? Ich werde mich einfach an dem Leid anderer laben, bis ich kalt und unberechenbar werde?«
»Doch, du kannst etwas tun, ich werde dich lehren, das Leid auszuschließen oder es zumindest in dir einzuschließen, statt dich daran zu weiden.« Seine Wolfsaugen begannen tiefblau zu schimmern und erweckten eine Anziehungskraft, die stärker war als jedes warme Leuchten in tiefster, kalter Dunkelheit. »Ich werde mich um dich kümmern.«
Und Cohen hegte keinen Zweifel daran. Nicht seit … Sein Blick fiel auf die Narbe, die sich über die Brust des Wolfes schlängelte. Es wuchs kein Fell dort, weil die Narbe zu frisch war.
Auch Cohen konnte seine Narbe noch spüren, sie spannte und erinnerte immer wieder an das, was geschehen war.
Als könnte er es je vergessen, dachte er bei sich.
»Zazar!« Der panische Ruf durchhallte das gesamte Traumreich. Cohen riss den Kopf hoch, die wunderschöne Stimme schien von überall und nirgendwo herzukommen. Als würde sie über ihnen schweben, wie ein Gott, der aus dem Himmelsreich zu ihnen hinab rief. So fern lag er mit seinem Vergleich nicht, denn er kannte die Stimme.
Bellzazar bog den Kopf, als würde er lauschen.
»Zazar!«, brüllte Korah erneut.
Cohen stand auf und sah sich im Gebirge um, doch es war leer, nicht einmal ein Tier war in den bewaldeten Berghängen auszumachen.
»Korah«, sagte Bellzazar zu ihm, »er ist in unser Zimmer gestürmt.« Dann lauschte er wieder und blickte gen Himmel, als könnte er Korah beobachten, doch als Cohen den Kopf in den Nacken legte sah er nur weiße, flauschige Wolken.
»Bellzazar! Vater!« sie lauschten der angespannten Pause. »Cohen!« Cohen war es, als rüttelte ihn jemand, wobei das Gefühl seltsam … fern war. Wie ein Windhauch unter der Kleidung. »Ihr müsst aufwachen«, rief Korah aufgebracht. »Zazar, du musst sofort kommen, es ist etwas Schlimmes passiert!«
Cohen sah nervös zu Bellzazar. Der Wolf schloss die Augen und gab ein tierisches Murren von sich.
»Ich glaube, es ist an der Zeit, aufzuwachen.«
Kapitel 3
Der nächste Donner ließ ihn zusammenzucken. Das Zimmer war stockdunkel, aber draußen tobte ein wütender Sturm, laut und bedrohlich, wie ein Ungeheuer, das über die Burg gekommen war und alles unter sich zermalmen wollte.
Mit großen angstgeweiteten Augen zog der Junge im Bett die purpurne Samtdecke über die Nase und rutschte tiefer in die vielen Kissen. Er konnte den Blick nicht von dem Fenster nehmen, durch das trotz der schweren Vorhänge das Licht der Blitze durchzuckte. Es warf grässliche Schatten durch einen Schlitz in dem zugezogenen Stoff, die Drachenstatuen und knorrigen Bäume aus dem Garten zeichneten immer wieder kurzweilen Monster auf die Wände in seinem Gemach. Große Monster mit Klauen und Reißzähnen, die sich über dem Bett aufbäumten und sich auf ihn werfen wollten.
Der Junge hatte schreckliche Angst und kroch beim nächsten Blitz, der einen dämonischen Schatten in sein Zimmer warf, mit einem panischen Laut aus seinem übergroßen Bett.
Er versteckte sich unter der Matratze, doch das brachte nichts, seine Angst hatte so beharrlich wie ein Monster die Krallen in ihn geschlagen. Ihm ging es nicht gut, ihm war übel und er hatte bereits seit dem Einschlafen schlimme Alpträume. Aber er hatte nicht gewagt, nach seinem Vater zu rufen. Der tobende Sturm jagte ihn jedoch solche Furcht ein, dass er keinen Augenblick länger glaubte, allein sein zu können, ohne panisch los zu kreischen.
Die Angst übermannte ihn und ließ ihn mit Tränen in den Augen aus dem großen, leeren, beängstigen Gemach flüchten. Doch als er die Tür zum hell erleuchteten Gang öffnete, drehte er sich noch einmal um, rannte auf nackten Sohlen zum Bett und schnappte sich ein Kissen – als Waffe oder nur zum Trost – und rannte dann hinaus, dem warmen Licht der Fackeln entgegen, die die ganze Nacht in den Fluren der Festung brannten.
Im Licht beruhigte sich sein rasender Herzschlag etwas, aber noch immer fürchtete er sich. Der Donner grollte über die nackten Wände, der Berg, auf dem die Festung stand, schien zu beben, es krachte und splitterte bei beinahe jedem Blitz, mal nah, mal fern. Die Wachhunde bellten und der Regen setzte überlaut ein, wie unheilvolle Trommeln, die immer schneller schlugen.
Er wollte nicht allein sein, seine kindliche Angst saß zu tief und er sehnte sich nach dem Schutz und der Wärme seiner Eltern.
Er rannte natürlich zuerst den Flur entlang zur Turmtreppe und hinauf zur Tür seiner Mutter. Natürlich eilte er zu seiner Mutter, wie es vermutlich jeder Junge getan hätte. Mit dem Kissen an der Brust, das fast so groß war wie er, blieb er jedoch unschlüssig stehen, statt zu klopfen. Er drehte langsam den Kopf über die winzige Schulter und blinzelte. Im Turm des Hexenzirkels war es finster, kalt und grabesstill, sodass der Donner noch lauter hallte als in seinen Gemächern. Die Blitze stachen durch die Buntglasfenster, als wollten sie dem Ungeheuer, das über die Festung gekommen war, den Standort des Jungen preisgeben.
Panisch wollte er in das Zimmer seiner Mutter stürmen, doch wie immer rannte er nur gegen eine verschlossene, schwere Tür. Sie öffnete auch nicht, als er mit einer Hand aufgebracht gegen die Tür schlug und nach ihr rief. Tränen rannen über seine zarten Wangen, aber seine Mutter erhörte seinen Ruf nicht.
Das hatte sie nie, sie brauchte Ruhe, um ihre Kräfte aufzufüllen, deshalb durfte er niemals nachts zu ihr ins Bett kriechen. Er sei ein Junge und müsse lernen, seine Angst zu besiegen. Trotzdem führte sein kindliches Herz ihn immer wieder zuerst zu ihr.
Der Turm wirkte bedrohlich, verlassen, der Junge kam sich unerwünscht vor, einsam. Wieder ließ ihn die Angst rennen, dabei stolperte er beinahe die Treppe des Turms hinab. Als er dieses Mal in das Licht der Flurfackeln tauchte, beruhigte er sich nicht. Aus irgendeinem unbestimmten Grund hatte er plötzlich Angst, ganz allein zu sein. Dass ihn seine Familie verlassen hätte. Dass seine Mutter vielleicht gar nicht in ihrem Zimmer war, sondern verschwunden, und sie deshalb nicht öffnete. Vielleicht waren sie vor dem Unwetter geflohen und hatten ihn vergessen. Furcht ließ ihn weinen und schneller laufen. Es war still, zu still, und die Festung wirkte bei Nacht noch riesiger und verwirrender als je zuvor. Er war drauf und dran, sich unter einer Fackel zusammen zu kauern und nach einer Wache zu rufen, die nachts die Treppenaufgänge bewachten.
Doch bevor seine Furcht ihn gänzlich übermannte, schafften es seine zitternden Beine, ihn zu der Tür seiner Väter zu tragen.
Sie war geschlossen, das wunderte ihn, sie war niemals geschlossen, sondern immer nur angelehnt. Aber eine Flut anheimelnden Lichts sickerte durch den Türspalt hervor. Er atmete erleichtert auf, er war nicht allein, seine Familie hatte ihn nicht einfach mitten in der Nacht verlassen.
Mit tränennassen Wangen stampfte er in kindlicher Manier auf die Tür zu und drehte den Knauf ohne zu klopfen.
»Vater…?«, begann er mit leiser, heller Stimme und spähte in den Raum hinein.
Das Kaminfeuer brannte wie frisch entzündet, überall standen Kerzen und fluteten den Raum, und die Samtvorhänge waren fest verschlossen. Natürlich waren sie das, seine Väter schlossen die Vorhänge immer richtig, es war die Frau, die ihm das Leben geschenkt hatte, die sie immer nur nachlässig zuzog, sodass das Mondlicht Schattenmonster an die Wände malen konnte, vor denen er sich jede Nacht vor dem Einschlafen fürchtete.
»Vater?«, hakte er nach, dabei bebte sein Stimmchen. Er öffnete die Tür noch weiter und suchte mit tränenverschleiertem Blick den Raum ab.
Sie waren im Bett. Zusammen. Aber sie schliefen nicht und sie bemerkten ihn auch nicht. Ihr amüsiertes Gelächter auf den Decken und ihr nacktes Gerangel übertönte den Sturm.
Der Junge erschrak sich und zog den Kopf zurück, mit hochroten Wangen zog er schnell die Tür zu. Er wusste nicht ganz genau, was sie taten, aber natürlich hatte er eine Ahnung, dass es nicht für seine Augen bestimmt war. Und dass sie gerade keinen Platz für ihn hatten.
Schon einmal hatte er sie gestört, als sie unbekleidet gekämpft hatten – so hatten sie es genannt. Doch damals hatten sie ihn bemerkt und zu sich geholt, doch irgendwie wollte er sie nicht noch einmal stören. Es war ihm peinlich, was er gesehen hatte. Unsagbar peinlich.
Aber immerhin waren sie da und ihr gedämpftes Gelächter war durch die Tür zu vernehmen, sodass er sich davor kauerte und das Kissen umarmte. Müdigkeit überkam ihn, als sich sein Herz etwas beruhigte. Falls die Monster zurückkämen, waren seine Väter jetzt zumindest ganz nah.
»Hast du Angst?«
Erschrocken sah er auf, als sich ein kleiner Schatten aus einer Nische löste. Sein Bruder trat hinter einer mannshohen Vase hervor und setzte sich neben ihn.
Riath nickte nur und grub die Nase in sein Kissen, weil er sich für seine Furcht schämte. Angst machte einen Mann schwach, sagte seine Mutter immer.
»Ich auch«, gestand Xaith und schürzte die Lippen. »Mutter sagt, ich solle es aussitzen.«
Riath sah ihn an. »Meine Mutter hat die Tür verschlossen.«
Xaith nickte. Er fummelte nervös an seinen Fingern, weil er kein Kissen hatte, an das er sich klammern konnte.
Eine Weile saßen sie so da, während der Sturm wütete und es im Zimmer ihrer Väter stiller wurde. Sie hatten sich selten etwas zu sagen, waren sich aber in diesem Moment seltsam nahe. May und Sarsar schliefen vermutlich bei ihren Müttern, Vaaks bekam vermutlich nicht einmal etwas von dem Sturm mit, denn nichts brachte ihn aus der Ruhe.
Aber sie… sie waren allein, wenn die Tür ihrer Väter geschlossen war.
Seltsamerweise war die Nähe zu seinem stillen Bruder tröstend. Riath wurde schläfrig, er musste gähnen. Und als aus dem Gemach hinter ihnen ein seltsames Klopfen ertönte, sah Xaith ihn an.
»Willst du in mein Bett kommen?«, fragte er und seine Drachenaugen leuchteten im Schein der Fackeln wärmer und anheimelnder als es jedes Kaminfeuer vermocht hätte.
Riath hätte vor Erleichterung beinahe eine Träne verloren, doch er nickte nur steif.
Sein Bruder nahm ihn an der Hand und zog ihn hoch, gemeinsam schlurften sie zu ihrem Flur zurück.
»Ich lasse einfach die Tür auf«, sagte Xaith, »dann vertreibt das Licht aus dem Flur die Schattenmonster.«
Normalerweise machten Riath und Xaith sich über die Ängste des anderen lustig, aber nicht in jener Nacht. Riath nickte nur stumm und drückte sein Kissen an sich. Xaiths Zimmer war kleiner und wirkte dadurch nicht so bedrohlich, weil man alles erkennen konnte. Es gab weniger finstere Ecken, in denen etwas Böses lauern konnte.
Zusätzlich zündete Xaith für Riath noch eine Kerze im Raum an, obwohl ihre Väter ihnen verboten hatten, Licht brennen zu lassen, wenn sie schlafen gingen, aus Furcht, etwas konnte Feuer fangen.
Erst als Xaith um ihn herum ging, krabbelte Riath auf das Bett und schlüpfte unter die warme Decke. Xaith legte sich zu ihm und sie rückten nahe zueinander. Riath zitterte trotzdem, als es lautstark donnerte.
»Hab keine Angst, Riri, gemeinsam sind wir stark. Kein Monster kann uns holen, wenn wir zusammen sind«, beruhigte Xaith ihn und strich ihm über den Kopf.
Selbstverständlich schmiegte Riath die Wange an die schmale Schulter seines Bruders und legte einen Arm um ihn, sowie Xaith einen um ihn legte.
»Schlaf«, sagte Xaith, »ich passe auf dich auf.«
Und Riath glaubte ihm, denn obwohl sie gleichalt waren, hatte Xaith immer auf ihn aufgepasst.
Sie schliefen wieder ein, während der Sturm seinen Höhepunkt erreichte, doch er konnte ihnen keine Furcht mehr einjagen. Jetzt nicht mehr.
Fortan rannte Riath nicht mehr zuerst in den Turm, wenn er sich nachts fürchtete, er rannte immer wieder zu seinem Bruder, dessen Tür immer offenstand. Bis sie beide zu alt waren, um sich noch vor Schattenmonstern und Donner zu fürchten…
Er schlug die Augen auf, als im Nebenraum eine Tür knallte, ansonsten blieb er unbewegt. Noch immer herrschte eine hörbare Aufregung in der Villa und auch in der ganzen Stadt, Wachen trabten umher, Ratgeber rannten von Zimmer zu Zimmer, Drachenjäger wurden gerufen.
Die Bestie war zwar fort, aber auch der König von Nohva.
Allmählich machte sich der Schlafmangel bemerkbar, in seinem Kopf fühlte sich alles seltsam dumpf an und er spürte ein stetig stärker werdendes Hämmern unter der Schädeldecke, seine Augenlider waren schwer und gereizt, selbst das Atmen war ein Kraftakt.
Riath bewegte sich ein wenig auf seinem Stuhl hin und her, um seinen steifen Rücken zu lockern, doch das brachte nichts. Er war hundemüde, wie man zu sagen pflegte, doch an Schlaf war nicht zu denken. Nicht nachdem … nachdem er zugesehen hatte, wie sein Vater im Maul des Drachen verschwand, und nichts dagegen unternommen hatte.
Er war wie gelähmt gewesen. Er und Xaith. Sie hatten nichts getan, einfach nur mit offenen Mündern zugesehen, unfähig, sich zu bewegen. Sie schämten sich, Riath wusste, dass Xaith sich genauso schlecht und schwach fühlte wie er, er sah es in dessen aschgrauen Gesicht.
Es war schrecklich gewesen, diese lähmende Fassungslosigkeit, die Angststarre und das Gefühl, des Unglaubens, das alles wie in einem Alptraum wirken ließ.
Riath stand noch unter Schock, er konnte und wollte nicht glauben, was geschehen war. Und als er sich in dem Raum umsah, in dem sie beisammensaßen, erblickte er die gleiche Starre in den Gesichtern seiner Geschwister.
»Es geht ihm gut!« Wexmell versuchte, ihnen seine Furcht nicht zu zeigen, aber sie konnten sie spüren. Sie kannten Wexmell immerhin ihr ganzes Leben, und er war nie aufgebracht im Zimmer auf und ab gegangen und hatte mit Tränen gekämpft. Aber für sie wollte er stark sein. »Ich wüsste es, wenn es nicht so wäre!«
Riath beobachtete ihn, wie er in seinem Gemach ruhelos auf und ab ging und sich die Brust rieb, als krampfte sein Herz.
Sie hatten sich alle auf das Zimmer ihrer Väter zurückgezogen, als der Drache auf und davon war. Wexmell hatte ihm nacheilen wollen, aber seine Pflicht ihnen gegenüber hatte ihn hiergehalten. So hatte Kaiser Eagle Späher und Drachenjäger ausgesendet, die dem Drachen gefolgt waren.
Sie warteten nun auf eine Nachricht von diesen.
Riath hoffte, es wäre nicht die Nachricht, dass ihr Vater nicht wieder kommen würde…
Der Gedanke schmerzte so sehr in seiner Brust, dass er sie sich ebenfalls rieb und sich auf seinem gepolsterten Stuhl, der neben der Tür stand, nach vorne lehnte.
May und Sarsar saßen steif auf der Bettkante, Sarsar war ein Grauen ins Gesicht geschrieben, wie Riath es bei seinem Bruder noch nie gesehen hatte. Sarsar war immer … eine Spur gleichgültig. Nicht aber an jenem schicksalshaften Morgen, als die Dämmerung am Horizont einen Lichtstrahl zeigte, und sie annahmen, ihr Vater, der König, wäre für immer von ihnen gegangen.
Sie hatten es nicht kommen sehen, sich nie vorstellen können, einer ihrer Väter könnte von jetzt auf gleich von dieser Welt scheiden.