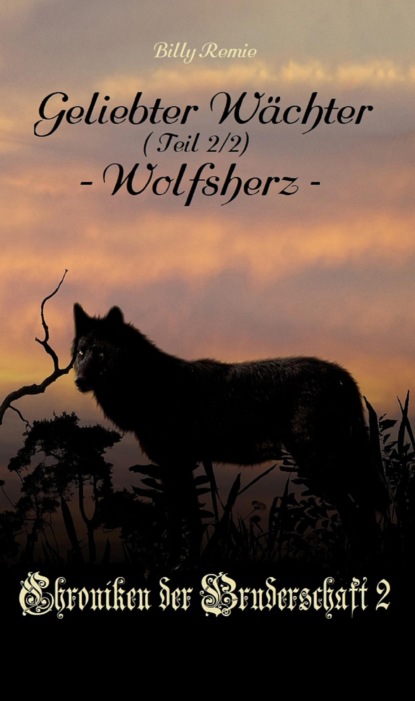- -
- 100%
- +
Der einzige, der wie immer recht gefasst wirkte, war Vaaks. Natürlich Vaaks. Der ruhige Riese, dachte Riath bei sich und mahlte mit den Kiefern. Mit durchbohrenden Augen starrte er hinüber zum Fenster, wo Xaith noch immer wie eine Statue des Grauens vor sich hinstarrte, genau wie an jenem Tag, als er seine Mutter getötet hatte, nur dass ihm jetzt kein Blut im Gesicht klebte. Er saß auf der Fensterbank und seine Schultern hingen tief. Vaaks setzte sich neben ihn – dicht neben ihn, zu dicht – nachdem er eine Weile aus dem Fenster gesehen hatte, und fuhr mit seinen kräftigen Fingern zwischen Xaiths schlankere, beinahe filigrane Finger, um sie festzuhalten, und drückte aufmunternd zu.
Wie selbstverständlich lehnte Xaith sich an Vaaks` starke Schulter und rieb die Wange daran, um eine stille Träne fortzuwischen, genau wie Riath es damals in dieser stürmischen Nacht bei ihm getan hatte.
Er hasste es, die beiden so eng zusammen zu sehen, er hasste es abgrundtief. Und er hasste den Umstand, dass er nicht einfach aufstehen und Xaith in den Arm nehmen konnte, um in dessen Wärme und Geruch zu versinken und die Angst um ihren Vater zu teilen, wie sie früher immer die Angst vor der Dunkelheit geteilt hatten.
Er fühlte sich allein, regelrecht im Stich gelassen.
Riath hasste die Kluft zwischen ihnen so sehr, aber noch mehr hasste er es, wenn jemand anderes Xaith tröstete, wenn er sich tief im Inneren nach Xaiths Trost sehnte.
Aber er konnte niemandem außer sich selbst die Schuld darangeben, dass Xaith ihm ferner war als alle anderen in diesem Raum. Er hasste sich selbst für das, was aus ihm geworden war.
Wexmell ging noch immer nervös im Zimmer auf und ab, jeder Augenblick, in dem sie keine Neuigkeiten erfuhren, zog sich quälend langsam dahin. Die Zeit war wie Sand, der sich durch eine winzige Öffnung drängte und träge hinabrieselte. Jetzt brach der Morgen an, aber die Nacht hatte sich angefühlt wie drei ganze Tage Dunkelheit und Ungewissheit.
»Er kommt zurück«, Wexmell nickte, als redete er es sich selbst ein, »es geht ihm gut, ich weiß, dass es ihm gut geht, ich …«
May stand plötzlich auf und stellte sich ihm in den Weg. »Ganz bestimmt«, sagte sie, obwohl in ihren Augen die gleiche Hoffnungslosigkeit wie in allen anderen stand. Sie rieb beruhigend Wexmells Arm, als dieser sie ansah, als würde er sie nicht erkennen, er blinzelte verwundert.
»Du solltest zu Kaiser Eagle gehen, Vater«, schlug sie vor, »er wird von seinen Spähern doch sicher zuerst über Neuigkeiten unterrichtet.«
Wexmell verzog zweifelnd das Gesicht und sah alle im Raum nacheinander an. »Aber ich kann euch doch jetzt nicht …«
»Geh!«, forderte Vaaks ihn auf und nickte ihm zu. »Wir kommen zurecht.« Dann sah er Xaith an und legte einen Arm um ihn, denn er hatte die Augen geschlossen.
Riath musste ein tiefes Knurren unterdrücken. Zwischen denen beiden war etwas passiert, er konnte es geradezu riechen. Sie waren sich nähergekommen, ihre ganze Körpersprache schrie es heraus. Wie nahe sie sich waren, wie selbstverständlich sie sich berührten und anlehnten. Es war offensichtlich, dass sie sich auf eine Weise nähergekommen waren, die ihm unter gar keinen Umständen gefiel.
Wexmell zögerte noch, doch dann siegte seine eigene Unruhe. »In Ordnung, aber bleibt hier«, er ging bereits zur Tür, »der Orden bewacht den Gang.«
Es war unsinnig, aber sie nickten nur noch. Als ob es der Drache nur darauf abgesehen hätte, zurück zu kommen, um auch noch sie zu verspeisen, und dann auch noch durch die Tür kommen würde…
Aber keiner wollte Wexmell jetzt widersprechen, ihr Vater war schon aufgebracht genug.
Als sich die Tür hinter ihm schloss, ging May zu Vaters Tisch und schenkte ihnen allen Wein ein. Ohne ein Wort ging sie reihum und verteilte Kelche. Vaaks und Sarsar nahmen einen, aber Riath lehnte ab, und Xaith öffnete nicht einmal die Augen, obwohl er wach zu sein schien, denn seine Atmung ging schnell.
Riath wollte jetzt nicht trinken, der Wein machte ihn gleichgültig und unberechenbar, außerdem fühlte sich sein Magen flau an. Er hatte auf dem Fest schon zu viel getrunken, hatte mit May einen Saufwettbewerb veranstaltet und war von ihr unter den Tisch gesoffen worden. Doch als er die schimmernden Schuppen gesehen hatte, war er schlagartig wieder nüchtern gewesen. Aber nicht die Schuppen des Drachen, sondern jene auf einem schmalen, schwungvollen Rücken...
May stellte sich wieder an den Tisch, hob den Kelch und raunte: »Auf Vater!«
»Auf Vater«, stimmte Vaaks rau mit ein – und sie tranken.
Sarsar jedoch streckte den Arm aus und kippte den Kelch, ein Schluck Wein tröpfelte zu Boden und er sagte leise: »Für die Alten Götter.« Dann stellte er den Kelch auf den Boden, ohne davon getrunken zu haben und kniete sich neben die kleine, rote Pfütze. Verwundert beobachteten sie ihn, als er sich darüber beugte und in tiefe Konzentration verfiel.
»Was machst du?«, fragte May.
Aber Sarsar hob nur eine Hand, um ihr zu bedeuten, dass sie schweigen sollte.
May sah Riath an, und sie zuckten beide mit den Schultern. Sie hatten jetzt keine Geduld, um sich mit ihrem wunderlichen Bruder rumzuschlagen. Magie war ohnehin nicht ihr Metier, und Sarsar würde sie ohnehin nicht einweihen, das tat er nie. Der Einzige, mit dem er über Magie sprach, war Xaith, aber dieser kümmerte sich gerade nicht um das, was Sarsar tat.
Riaths grüner Blick wanderte wie von selbst wieder zu dem frischen Liebespaar auf der Fensterbank, man konnte förmlich riechen, wie sich die zarte Blüte der Liebe zwischen ihnen entfaltete. Die Angst um ihren Vater brachte sie näher zusammen, als Riath lieb war.
Er lehnte sich wieder zurück, verschränkte die Arme vor der massigen Brust, sodass die helle Seide spannte, und schloss die Augen. Kaum waren seine Lider zugefallen, sah er wieder dieses grüne Schimmern vor sich. Diesen ansehnlichen, hübschen Rücken mit dem anmutigen Schwung, in der Taille fast so schmal wie ein Weib, aber die Schulterblätter eines Mannes. Und natürlich diese dunkelgrünen Schuppen, die wie mit Diamantstaub bestäubt glitzerten. Und dann diese großen Augen, die ihn befürchtend über die Schulter hinweg angesehen hatten, leuchtend, frostblau, im silbrigen Licht des Mondes…
Allein die Erinnerung an diesen Burschen ließ sein Innerstes vibrieren und war eine hervorragende Ablenkung von allem anderen. Von Xaiths und Vaaks` offensichtlicher Zuneigung, und von der Angst um seinen Vater. Nur ein Gedanke an diese schimmernde Rückseite, und er konnte nur noch daran denken, wie sie sich wohl anfühlen würde.
»Ich weiß, wo er ist«, sagte Sarsar plötzlich mit ernster Miene. »Ich weiß, was geschehen ist.«
Riath öffnete die Augen und schnaubte. »Und das hat dir eine Weinpfütze gesagt, ja?«
Mit einem schneidenden Blick sah Sarsar ihn an. »Einem Troll kann man nicht erklären, wieso der Regen fällt.«
Riath runzelte zugleich verwirrt und wütend die Stirn. Verdammt, er hasste es, wenn Sarsar solche Sachen sagte, er verstand sie einfach nicht.
»Und warum hast du das erst jetzt gemacht, Lord Schlauberger?«
»Weil ich nicht wusste, ob die Alten Götter mich erhören und ich Wexmell keine falschen Hoffnungen machen wollte«, konterte Sarsar schnippisch. Er wandte sich an Xaith, der ihn neugierig beobachtete, und verkündete erleichtert: »Es geht ihm gut! Vater lebt!«
Kapitel 4
Es war der Geruch, der ihn letztlich aus der tiefen Schwärze zog. Ein Geruch, der ihm eigentlich fremd war und doch eine zutiefst vertraute Note transportierte, die in seine Nase stieg, um all seine Sinne zu wecken. Das erste, was er fühlte, war Sehnsucht und Traurigkeit, die ihn so heftig wie ein Wirbelsturm überkam und ihn stöhnen ließ. Für einen Moment kam er sich wie in der Zeit zurückversetzt vor. Dieser Geruch… er war so vertraut und löste das höchste allen Sehnens in ihm aus. Sein Herz war hin- und hergerissen zwischen freudiger Aufregung und schmerzhaftem Zerreißen.
Er spürte, wie sich sein Körper von selbst auf den Rücken drehte, der Boden war hart und seine Kleidung fühlte sich nass und klebrig an. Blinzelnd versuchte er, die Augen zu öffnen, warmer Sonnenschein stach ihm in die Pupillen und seine schwarzen Wimpern waren verklebt. Etwas lief ihm in die Augen und er schloss sie wieder schmerzvoll. Stöhnend rieb er mit Daumen und Zeigefinger die brennende Flüssigkeit von seinen Lidern.
Als nächstes nahm er neben dem Geruch auch Geräusche wahr. Ein pfeifender Wind, wie er nur auf einem Berggipfel wütend zischen konnte, und leises Stimmengewirr, das nach und nach immer lauter wurde, weil er immer mehr Bewusstsein erlangte.
Ein Schatten fiel über ihn und er zwang die Augen auf, während er in seinem langsam erwachenden Verstand nach Erinnerungen wühlte.
Das Gesicht, das über ihm schwebte, klärte sich nach einigem Blinzeln. Und es war ihm nicht fremd, ganz und gar nicht. Der andere legte den Kopf schief und lächelte zurückhaltend, als sei er ein verängstigtes Kind, das er nicht verschrecken wollte.
»Ich muss tot sein«, sagte Desiderius rau und streckte seine Hand nach dem Gesicht aus, um es sanft zu berühren. Beinahe wäre er zusammengezuckt, als er die lebendige Haut unter seinen Fingerspitzen spüren konnte. Fassungslos strich er über die Wange zu dem warmen Mund, über den lebendiger Atem floss. Das konnte nicht wirklich sein!
»Du bist nicht tot«, antwortete Cohen, der quick lebendig über ihm hockte und das Gesicht unter einem schwarzen Umhang vor dem hellen Tageslicht schützte. Nun strich er ihm mit zwei Fingern das nasse, klebrige Haar aus der Stirn. »Aber du wurdest gerade buchstäblich ausgekotzt und bist etwas … vollgesabbert. Kein Wunder, dass du durcheinander bist.«
Desiderius hörte nicht die Worte aus Cohens Mund, er starrte ihn einfach an und versuchte zu begreifen, dass er nicht nur einen sehr intensiven Traum hatte.
Das Letzte, woran er sich erinnerte, war das Maul des Drachen, danach war es sehr schwarz geworden und durch den schwefelhaltigen Atem im Mund des Tieres hatte er schnell das Bewusstsein verloren.
Und im nächsten Moment öffnete er die Augen und sah Cohens Gesicht über sich schweben. So, wie er es kannte, eine verboten süße Mischung aus Jugend und markanter Männlichkeit.
»Du … du … lebst?«, raunte er und sperrte den Mund auf.
Cohens Mimik nahm etwas Bedauerndes an. »Nicht ganz. Aber das ist eine lange Geschichte, ich …«
Weiter kam er nicht, Desiderius hatte bereits sein Gesicht gepackt und ihn zu seinem Mund herabgezogen. Ihre Lippen lagen übereinander und Desiderius saugte intensiv an Cohens bittersüßem Mund, Tränen brannten in seinen Augen, Tränen der ungläubigen Freude, ebenso wurde ihm der Hals verräterisch eng.
Nur am Rande bekam er mit, dass Cohens Kuss nur zurückhaltend war, regelrecht notgedrungen. Seine Lippen waren hart und wollten sich nicht so recht verführen lassen. Doch das war Desiderius im Moment gänzlich gleich. Er küsste Cohen voller Inbrunst und konnte ein überschwängliches Lachen nicht zurückhalten, wobei sein Verstand noch immer nicht begreifen konnte, wie verflucht noch mal Cohen hier sein konnte. Bei ihm. Warm und lebendig und …
Verdammt, er würde sicher gleich aufwachen und feststellen, dass er nur geträumt hatte. Deshalb hielt er Cohens Mund umso entschlossener fest auf seinem.
Es war kein Kuss der Leidenschaft, sondern ein Kuss der puren, fassungslosen Freude, die ihm auch letztlich ein paar Tränen bescherte.
Er wollte nie wieder aus diesem schönen Traum aufwachen. Nie wieder.
Doch da legte ihm Cohen eine Hand auf die Brust und drückte ihn ziemlich nachdrücklich auf den Boden, um sich von ihm lösen zu können. Er keuchte, als hätte ihn eine heftige Erregung ergriffen und atmete daraufhin schwer. »Langsam, ich muss vorsichtig mit … sterblichem Kontakt umgehen.«
Verwirrt blinzelte Desiderius zu ihm auf, doch als Cohens Gesicht nicht wie ein Traumgebilde einfach verschwand, konnte nichts seine Freude trüben.
»Es ist kein Traum«, flüsterte er rau und lachte dann ziemlich dümmlich auf, sodass Cohen über ihn schmunzeln musste. Verdammt, dieses schöne, schüchterne Schmunzeln, das er so sehr vermisst hatte. »Du lebst! Das ist kein Traum, du bist wirklich hier!« Desiderius wollte Cohens Umhang lüften, aber dieser hinderte ihn sofort daran und drückte ihm die Hände auf die Brust. Desiderius machte sich frei und griff stattdessen wieder nach Cohens Gesicht, musste es in seine Finger nehmen, es fühlen, es begutachten und streicheln. Cohen ließ ihn mit einem nachsichtigen Blick gewähren.
Da fiel es ihm auf und seine Mimik verzog sich zu einem tiefen Grübeln. »Was ist damit passiert?«, fragte er und tippte unter Cohens verbliebenes Auge. Er hatte dieses große, rehbraune Auge so sehr geliebt, dass es ihm jetzt regelrecht einen Stich versetzte, weil es blutrot schimmerte.
Etwas stimmte hier nicht. Und zwar gewaltig.
Cohen senkte den Blick und legte eine Hand um Desiderius` Arm, um sich aus dessen Griff zu befreien. »Eine lange, nicht ganz so amüsante Geschichte.«
Desiderius brauchte keine Erklärung, er wusste, was dieses Auge bedeutete, und als es ihm klar wurde, konnte er es auch spüren. Sein göttlicher Sinn verriet ihm alles, was er wissen musste.
Mit steinharter Miene presste er durch die Lippen: »Du bist ein Dämon!«
Cohen sah ihn nicht an, sein Mund war ein schmaler, zusammengepetzter Strich, während er lediglich bejahend nickte.
Desiderius schlug die Faust in den Boden und versuchte, sich aufzurichten. »Wo ist er?« Er hatte nur noch einen Gedanken. »Wo ist der Mistkerl, ich bring ihn um! Ich bring ihn um, das schwöre ich, dieses Mal bring ich ihn um!«
Etwas stieß ihm hart gegen die Brust und katapultierte ihn wieder auf den Rücken. Verwundert blinzelte er, als Cohen ihn entschlossen ansah.
»Das wirst du nicht!«, knurrte sein einstmals Geliebter.
Desiderius schnaubte. »Ich kann mir denken, wem du dieses Dasein verdankst…«
»Ich wäre jetzt nicht mehr hier, wäre ich kein Dämon«, verkündete Cohen sehr ernst und brachte Desiderius damit zum Schweigen. »Ich wäre nirgendwo mehr. Es ist nicht das, was ich mir nach meinem Tod vorgestellt hätte, aber es ist bestimmt nicht so, wie du denkst. Keine Folter machte mich zum Dämon, sondern ein großes Opfer, für das ich sehr dankbar bin. Bilde dir kein vorschnelles Urteil, Desiderius M`Shier, das war schon immer deine größte Schwäche.«
Noch immer argwöhnisch betrachtete er Cohens Gesicht, doch er zügelte sein Temperament, denn er konnte im Moment ohnehin noch nicht so recht begreifen, wie das alles möglich sein konnte.
Cohen war ja nicht erst seit gestern fort, er war sehr, sehr lange tot gewesen, und sie hatten viele Jahre gehabt, um sich damit abzufinden. Doch jetzt, nach all der Zeit, saß er wieder vor ihm und starrte ganz lebendig auf ihn herab. Zwar als Dämon, aber dennoch war er Cohen. Sein Cohen.
Er war nur erleichtert, dass dessen Seele nicht Jahre lang gefoltert worden war, um dann als geschwärztes, dunkles Wesen wiedergeboren zu werden. Er hätte es nicht ertragen, zu wissen, dass Cohen all die Jahre gelitten hatte, während er die Zeit voller Liebe und Frieden genossen hatte.
Ein Räuspern erklang hinter Cohen, der sich sofort über die Schulter sah. Und da war er, der Übeltäter, dem Cohen sein neues Leben verdankte, dachte Desiderius zynisch, während er zwischen den beiden hin und her sah.
»Ich trübe die Wiedersehensfreude nur ungern, aber…«
»Leck mich.«
Bellzazar grinste kühl. »Ich liebe dich auch, Bruder. Aber können wir die Feier dieser Wiedergeburt und euer unverhofftes Wiedersehen auf einen anderen Zeitpunkt verlegen?«, fragte er regelrecht vor Sarkasmus triefend. »Sagen wir, sobald wir dringendere Probleme, wie den drohenden Weltuntergang, besprochen haben, und an einem weniger gefährlichen Ort sind, vorzugsweise in der netten Stadt da unten mit den hohen Mauern und bemannten Türmen, die dein Sprössling so vortrefflich verwüstet hat, ja?« Er deutete mit dem Daumen hinter sich und knirschte mit den Zähnen. »Du solltest dir besser anhören, was wir alle zu erzählen haben, Bruder, denn ob es dir gefällt oder nicht, wir stecken alle bis zum Hals in Scheiße. Und in keiner normalen, braunen Scheiße, sondern in grüner, warmer Neugeborenenkacke.« Er ließ den Arm fallen und sah Cohen ins Gesicht, während er matt anfügte: »Danach könnt ihr zwei euch immer noch euer Leid klagen und euch heulend in die Arme fallen, um euch abzulecken.«
Desiderius stutzte, er hatte seinen Bruder ja schon in allen möglichen Momenten erlebt, aber er war immer aalglatt gewesen, doch nun schlich sich so etwas wie Verbitterung in seine Züge und Worte, die ihm ganz gewiss nicht eigen waren. Argwöhnisch verengte er die Augen und durchbohrte Bellzazar mit Blicken. Ein ganz schlechtes Gefühl überkam ihn. Ganz, ganz schlecht.
Er konnte aber nicht weiter darüber nachdenken, denn als Cohen aufstand und an Bellzazars Seite trat – sie sahen sich ins Gesicht, und Desiderius konnte den Blick seines Bruders nicht recht deuten – da schlug ihm plötzlich der Wind ins Gesicht und mit ihm der Geruch, der ihm zugleich fremd und vertraut vorkam.
Mit einem Ruck saß er aufrecht und durchlebte einen Sturm der Gefühle. Alles andere war vergessen. Da fiel es ihm wieder ein. Dieser Geruch, das war nicht Cohen gewesen, es war ein Geruch, den er viel länger nicht wahrgenommen hatte. Männlich, würzig, herb – Freiheit und unbändige Liebe.
Er blinzelte zu der Gruppe Männer, die sich an einer alten Wachturmruine tummelte. Es waren viele, aber er beachtete nur das eine Paar Augen, das genauso intensiv und gefangen zu ihm herüberblickte, wie er zur Ruine starrte.
Ich weiß, wer du bist, sagte sein Blick. Natürlich wusste er es. Sein Herz wusste es sofort, als er ihn in Menschengestalt erblickte, obwohl er sein Antlitz unter einem Umhang und einer weißen Halbmaske verbarg. Er wusste, wer er war, ohne seinen Namen zu kennen. Sie kannten sich, ohne sich je begegnet zu sein.
Wie in Trance kam Desiderius auf die Beine, war sich überhaupt nicht richtig bewusst, dass er sich bewegte, auf einmal machte sich sein Körper selbstständig und war wie befreit von irdischer Schwere. Auch der andere rührte sich, setzte sich von den anderen ab, und als ob sie sich ein Zeichen gegeben hätten, gingen sie in den Wald, der vertraute Fremde mit den honigfarbenen Augen lief voran, Desiderius starrte auf dessen breiten, seltsam vertrauten Rücken, während sie die Gruppe verließen.
»Ich weiß, wer du bist«, raunte Desiderius, als sie vom lichten Bergwald am Rande der Ruine verschluckt wurden.
Der Fremde drehte sich nicht um, blieb aber ebenfalls zwischen zwei Bäumen stehen, das Sonnenlicht malte helle Punkte und Streifen auf seinen Umhang und Schultern. »Und ich weiß, wer Ihr seid«, erwiderte er mit einer Stimme, die Desiderius eine Gänsehaut eintrug.
Es war Rahffs dunkle, melodische Stimme.
Desiderius schüttelte ungläubig den Kopf. »Wie … kann das sein? Ich meine, ich weiß, dass es wahr ist und wie … es dazu kam. Aber … wie … wie kann es wahr sein? All die Jahre… dachte ich …«
»Suto wäre mit Eurem Drachenei auf See ertrunken?« Nun drehte der Fremde sich doch um, es lag keinerlei Groll noch Vorwurf in seiner dunklen Stimme. Er zuckte mit den Schultern. »Ja, ich weiß. Der alte Vogel hat mir alles erzählt. Ich weiß, dass einer meiner Väter nichts von mir wusste … weil sich niemand sicher war, wie dieser damit umgeht.« Geradezu forschend betrachtete er ihn, eine gewisse Vorsicht lag in seinen ungewöhnlichen Augen.
Desiderius war es, als würde der Boden unter seinen Füßen wegbrechen. Er schwankte etwas und stützte einen Arm gegen einen Baum. »Ich war nie sicher, ob er wirklich ein Ei … und ich war jung und …« Er geriet bei seiner Erklärung ins Stocken, denn er wusste, dass sie fadenscheinig wirken würde, auch wenn sie der Wahrheit entsprach. Manchmal war jedes Wort, das falsche Wort. Er sah auf und den Fremden an, und alles, was er in diesem Moment noch wusste, war: »Du bist ein Teil von mir.«
Der Fremde sah ihn einfach an, ruhig und unbewegt, vollkommen im Reinen mit sich und der Welt.
Desiderius schaute ihn durchdringend an. »Lüfte deine Maske.«
Für einen Moment rührte sich nichts, nicht einmal ein Muskel in ihren Zügen oder der Wind in ihrem Haar. Doch dann atmete der Fremde vernehmbar aus, senkte den Kopf und hob seine Hände. Erst zog er die Kapuze ab, dann löste er die Maske.
Desiderius atmete bebend aus, als er das gewellte, schulterlange Haar erblickte, das kantige Kinn und den dichten Bartschatten. Er schüttelte den Kopf und musste blinzeln. »Du siehst wie dein Vater aus.«
Das war nicht gelogen, er war Rahffs Ebenbild, von Kopf bis Fuß. Desiderius schmerzte das Herz in der Brust so sehr, dass er beinahe in die Knie gegangen wäre. Er holte vernehmbar Luft, doch ihm war, als füllte sie nicht seine Lungen.
Ein trauriges Lächeln geisterte über die Lippen des Fremden, dann sah er Desiderius wieder an. »Ich hatte nicht nur einen Vater«, erwiderte er bestimmt und sah Desiderius bedeutsam an.
*~*~*~*
»Sollten wir ihnen nicht nachgehen?« Cohen stützte die Schulter an den Baum, an dem Bellzazar mit dem Rücken lehnte, und starrte auf das kleine Waldpfädchen, auf dem Desiderius und dieser Fremde verschwunden waren. Er machte sich Sorgen.
Doch Bellzazar schüttelte den Kopf. »Gib ihnen etwas Zeit.«
Cohen hob den Blick und betrachtete Bellzazars angespanntes Profil. Irgendetwas in seinem Inneren wollte die Hand heben und es berühren, aber er hielt sich zurück. »Warum hast du nie etwas gesagt?«, fragte er stattdessen. »Über diesen Fremden. Über …«
»Ich wusste es bis vor Kurzem nicht«, gestand Bellzazar, was ihm sichtlich unbehaglich war. »Er wurde von Mächten geschützt, die älter sind als ich. Von Waldgeistern, die schon lange vor mir existierten. Ich wusste von diesem Vogel, diesem Hermaphroditen, dem Desiderius und Rahff begegnet waren, aber ich dachte, genau wie sie, er sei samt Ei auf hoher See ertrunken, als er versuchte, in seine Heimat zu fliehen.« Er drehte den Kopf und sah Cohen an, wobei seine schwarzen Iriden blau zu schimmern anfingen. »Korah hat ihn entdeckt, als er sich unerlaubt auf Expedition in die sterbliche Welt begab.«
Cohen dachte einen Moment darüber nach und sah wieder hinüber zu dem Wald, wo Desiderius gerade vor eine weitere schockierende Neuigkeit gestellt wurde. Erst Cohens mehr oder weniger Wiederauferstehung, dann ein verloren geglaubter Sohn, der aus einem Ei geschlüpft war. Wäre Desiderius nicht selbst ein Halbgott und hätte sich nicht einst in einen Drachen verwandelt, wäre das alles gewiss zu viel für seinen Verstand gewesen. Zu viel auf einmal, um es wirklich zu begreifen. Für Cohen war es fast zu viel, dabei betraf es ihn nicht.
Und es warteten noch weitere schicksalshafte Botschaften auf die Herrscher des Westens. Cohens Blick wanderte hinüber zur Ruine, wo ein großer, drahtiger Mann mit dunkler Haut, angespitzten Ohren und buttergelben, mandelförmigen Augen stand, an dessen Arm sich ein verunsicherter Bursche klammerte, der Wexmells unehelicher Sohn hätte sein können. Nur einige Schritte entfernt saßen Levi und zu seinen Füßen der gefesselte Wächter Place gemeinsam mit Korah – Bellzazars Schöpfung und irgendwie somit Desiderius` unverhoffter Neffe – der sich erhob, sobald er Cohens Blick bemerkte, und langsam auf sie zukam.
Die Welt war ein einziges Chaos, dachte er und schüttelte den Kopf, ein Scherbenhaufen, den kaum jemand vermochte, so zusammenzusetzen, dass er einen klaren Sinn ergab.
Es geschah zu viel auf einmal, dachte er. Und doch schien es richtig, hier zu sein. Dass sie alle hier waren, genau jetzt, hier und heute zu diesem Zeitpunkt. Alles lief hier zusammen, alle losen Fäden schienen endlich zu einem Punkt verknotet. Doch … wohin würde das alles führen?
Zwei Finger legten sich um Cohens Kinn und zogen ihn zu Bellzazars Gesicht herum. Sie waren sich so nahe, dass sich fast ihre Lippen berührten, was Cohen beinahe einen wohligen Seufzer entlockte, doch er hielt sich zurück.
»He«, Bellzazar lächelte schief, »nicht wieder so viel nachdenken. Wir lassen einfach alles auf uns zukommen. Derius wird’s schon verkraften.« Doch in seinen Augen stand Zweifel.