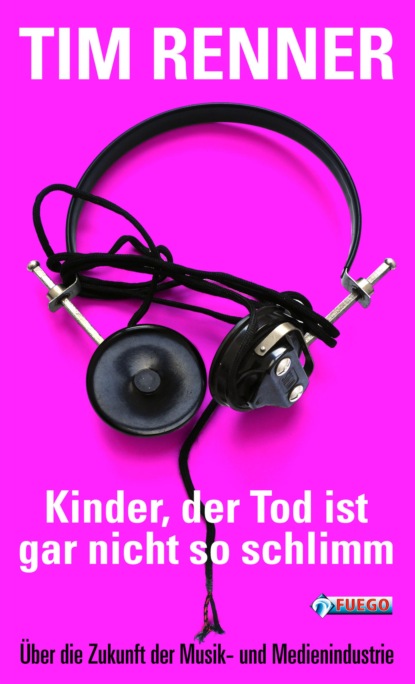- -
- 100%
- +
Den souveränen Künstler schert das nicht. Ihm ist wichtiger, dass er überhaupt in irgendeiner Weise Gehör findet, Fläche bekommt, um sich und sein Werk zu projizieren. Er drückt seine Befindlichkeit, die er im Alltag nicht vermitteln kann, durch Musik, Bild, geschriebenes Wort oder Darstellung aus. Er sehnt sich nach Ruhm und Anerkennung und das zugestandenermaßen umso mehr, je lauter sein Magen knurrt. Natürlich ist er bereit, sein Tun in den Dienst einer anderen Sache zu stellen, solange zumindest, wie sie diesem Tun nicht widerspricht – zumindest nicht zu offensichtlich.
An Pop fasziniert mich, dass diese Kultur am souveränsten mit der Beziehung zum Kapital umgeht. Klar, die Geschichte der Kunst ist immer auch eine Geschichte von finanziellen Abhängigkeiten. Aber Pop heißt, darüber nicht zu jammern. Die Kunst der Popkultur besteht darin, das Kapital nicht verschämt zu verneinen, keine unbefleckte Empfängnis des Werks vorzugaukeln, sondern sich des Kapitals zu bedienen, mit ihm zu spielen, es sogar ab und an zu verhöhnen. Da Geld keine Seele hat, ist ihm das übrigens völlig egal. Ich brauchte selbst einige Zeit, das zu begreifen.
»You fucked up your life, why don’t you smile?«, sangen Element of Crime, die erste Band, die ich als Mitarbeiter der großen Plattenfirma Polydor unter Vertrag genommen hatte – 1986 im Westwerk in Hamburg. Ich drückte meine damalige Freundin und heutige Mutter unserer Kinder fest an mich, denn statt eines Lächelns waren Tränen auf meinem Gesicht. Ich fühlte mich ertappt: als derjenige, der sein Leben damit verschwendete, einem Konzern zu dienen, der keinen Inhalt hat. Das wäre vielleicht das Einzige gewesen, was ich – auf Wallraffs Spuren – noch hätte entlarven können. Aber nun, da ich diese netten Kreuzberger Jungs genötigt hatte, bei meiner Firma zu unterschreiben, war ich natürlich Teil des Systems. Doch das System ließ sich benutzen und beschwerte sich nicht einmal. Mit seinem Geld wurde die Legende John Cale, der John Lennon von Velvet Underground, überzeugt, die Band zu produzieren. Wir sparten ansonsten jeden Pfennig. Die Band wohnte zu viert in einem Zimmer in Swiss Cottage, einem Stadtteil Londons, der nur irreführenderweise nach Alpenromantik klingt. Wollte man heizen, musste man alle zehn Minuten Münzen nachwerfen, doch dafür hatten wir Fotos von Derek Ridgers, einem der gefragtesten Fotografen des damals angesagtesten Musikmagazins NME (New Musical Express).
Pop braucht Kapital, aber noch mehr braucht es Massenmedien, die natürlich wiederum nur aufgrund von Kapitaleinsatz existieren und gemäß Kapitallogik funktionieren. Die Medien bekamen wir für Element of Crime, zumindest was die Presse anging, – weil John Cale und Derek Ridgers nach großer, weiter Welt rochen und die Platte »Try To Be Mensch« dennoch so schön nach nebenan klang. Die Inszenierung für die Medien ist im Pop fester Bestandteil des Werks. Massenmedien sind sein Transportmittel direkt in den Alltag des Betrachters, Lesers, Hörers hinein. Am besten geschieht das ohne Vorwarnung. Als Song im Taxi, Text in der Tageszeitung oder Bild im TV, das dich kalt erwischt und bewegt. Nicht selten wird das Medium dabei selbst zum Pop. Pop funktioniert dann perfekt, wenn durch das Alltägliche der Alltag beeinflusst wird. Pop misst seinen Erfolg daran, in welcher Tiefe, welcher Breite dies gelingt. Das hat maßgeblich mit der Häufigkeit und Intensität zu tun, mit der das Werk den Konsumenten erreicht.
Das offensive und ehrliche Verhältnis zu Massenmedien und Kapital macht Pop aber auch so furchtbar verletzlich, wenn auf der anderen Seite die Verantwortung des Künstlers und der ihn umgebenden Managementstrukturen nicht mehr wahrgenommen wird. Management bedeutet im besten Sinne Moderation, bedeutet, im Interesse beider Seiten anzubremsen, wenn Inhalt durch Kapital und/oder Medium bedroht wird. Denn Inhaltsleere zerstört auf Dauer nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch das Geschäft. Wie soll man einen Konsumenten dazu bringen, für etwas Geld auszugeben, wenn es doch scheinbar um nichts mehr geht? Wenn die Wertschöpfung allein schon der Wert ist, darf sich niemand wundern, wenn die Charts nur noch eine Karaoke-Bar sind. Gute Karaoke-Sänger sind sicher nette Nachbarn oder Arbeitskollegen, aber eben keine Popstars. Innovation gehört nicht zum Programm von Casting-Shows. Doch eine Kultur, die sich nicht erneuert, nivelliert sich irgendwann. Pop führt somit gerade eindrucksvoll vor, wie man sich selbst abschaffen kann, wenn auf Dauer die Inhalte fehlen.
Nach genau diesen Inhalten jedoch sucht der Konsument, um sich selbst zu definieren. Er steht nicht mehr auf der vierten Stufe der berühmten »Bedürfnispyramide«, die Verhaltensforscher Abraham Maslow vor mehr als 60 Jahren publizierte. Auf das Bedürfnis nach Nahrung, nach Fortpflanzung und nach Sicherheit folgt dort das nach Gruppenzugehörigkeit. Auf Stufe fünf winkt in sehr entwickelten Gesellschaften die Individualisierung. Man will nicht mehr nur Teil der wärmenden Masse sein, man wendet sich eher vom klassischen Mainstream ab und versucht, Eigenständigkeit zu demonstrieren. Das gelingt in den meisten Fällen nur bedingt. Es führt aber dazu, dass nicht mehr der »ideale« Schwiegersohn oder die tumbe, blonde Sexbombe den neuen Mainstream ausmachen, sondern durchaus eigenwillige Typen, die die Spitzen der jeweiligen Szenen darstellen. Der Konsument dokumentiert seine vermeintliche Eigenständigkeit, indem er sich musikalische Bouquets zusammenstellt: Norah Jones und U2, Shania Twain und Eminem – und natürlich Robbie Williams. Das bedeutet: Jazz und Alternative Rock, Country, Hip-Hop und natürlich Pop; Künstler aus unterschiedlichen Genres, die sich als Stilrichtungen eigentlich widersprechen. Zusammen bilden sie nun eine Plattensammlung, die vor Jahren noch schizoid erschienen wäre, die ich so aber schon oft vorgefunden habe. Alle genannten Interpreten haben ein eigenständiges Profil, kommen authentisch aus ihren jeweiligen Szenen und sie stehen, jeweils auf ihre Art, für Inhalte. Nebenbei bemerkt, sind sie die weltweit erfolgreichsten Pop-Künstler ...
Die Musikwirtschaft ignorierte lange, dass sich der Konsument in seinem Drang nach Individualität längst selbst einen neuen Mainstream zusammengestellt hat. Gemeint ist damit jedoch nicht mehr die einheitliche Soße, die man klassisch unter Mainstream verstand. Die neue Mischung besteht vielmehr aus den Spitzen der jeweiligen Szenen. Statt aus diesen Szenen die neuen Ikonen aufzubauen, wurde das eigene Bild von Mainstream dagegengesetzt: TV makes the superstar und Bravo-Compilations. Ignoriert die Musikwirtschaft aber dieses Bedürfnis und bringt obendrein der nächste Digitalisierungsschub einen Formatwechsel (wie von der CD zum Internet) mit sich, der auf extreme Weise die Individualität des Konsumenten fördert, dann habe ich ein richtig handfestes Problem. Eines, das die Musikindustrie zu ersticken droht und das in ähnlicher Weise zumindest auf Film und Fernsehen zurollt. Die Musikwirtschaft hat hier die Rolle der Avantgarde, weil ein Popsong die Kunst der kleinen Datenmenge repräsentiert. Doch je mehr sich Datenkompression und Übertragungsgeschwindigkeiten entwickeln, desto eher holt dieses Problem auch andere Medien ein. Diese können aus der Geschichte der Musikindustrie lernen und sollten nicht denselben Fehler begehen und die Warnsignale überhören.
Auf der ersten internationalen Managementtagung der PolyGram, an der ich als frisch gebackener Geschäftsführer von Motor Music 1994 teilnehmen durfte, gönnte man sich Nicholas Negroponte als Gastredner, den Gründer und Leiter des legendären Media Laboratory des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Der Visionär Negroponte, Mitgründer des Magazins Wired, erklärte, wie Datenkompression und Peer-to-Peer-Netzwerke funktionieren würden. Er prognostizierte, dass in zehn Jahren schon die Hälfte aller Musiktitel über das Netz kommen würde. Der Geschäftsführer von A&M Records schlief während des Vortrags ein, andere begannen zu plaudern und in der Pause stand Negroponte ganz alleine da. Als er gegangen war, entschuldigte sich der Chairman bei seinen Mitarbeitern. Das sei natürlich alles Quatsch, der Mensch sei haptisch veranlagt, ein Download würde niemals als Besitz begriffen werden. Zur selben Zeit kauften sich bereits Tausende von Kids Computer-Games für über 100 Mark, schmissen deren Verpackungen weg und nannten einen Game-Icon auf dem Bildschirm ihr Eigen.
Sowohl Negroponte als auch der PolyGram-Chairman hatten unrecht: Schon sieben Jahre später kamen mehr Titel aus dem Netz, als über die Ladentheke gingen. Das Dumme daran war, dass dies fast ausschließlich über illegale Quellen geschah. Der Konsument hatte eine perfekte Entschuldigung: Die Industrie ließ ihn allein, zu häufig hatte er erleben müssen, dass ihre Inhalte nicht mehr als Blendwerk waren, ein legales Angebot gab es nicht, also konnte er zum Dieb mit gutem Gewissen werden. Als Möchtegern-Robin-Hood streift er durchs Netz, nimmt von den vermeintlich Dummen und Reichen und gibt – sich selbst.
Und nun stelle man sich vor, wie der gleiche Konsument in naher Zukunft mit Film im Netz, mit Internet- und Handy-Radio, mit TV, über digitale Videorekorder mitgeschnitten, von Werbung befreit und zeitversetzt konsumiert, und selbst mit Büchern bei einer anderen Art von Bildschirmen umgehen wird. Die Konsumenten-Demokratie wird zur Konsumenten-Anarchie, zu einem kurzfristigen, selbstzerstörerischen Bad im kulturellen Überfluss, wenn die Anbieter nicht in Führung gehen, indem sie glaubwürdige Inhalte und legale Strukturen schaffen. Das und vieles mehr kann man von der Geschichte der Musikindustrie lernen. Und wenn man es weiß und sich darauf einstellt, ist der Tod der alten Strukturen und Geschäftsmodelle plötzlich gar nicht mehr so schlimm.
TEIL EINS:
Das Alte Testament
Das Paradies
Das Paradies – gerettet von Herbert von Karajan und Jan Timmer
Mein erster Tag am 1. August 1986 bei Polydor als Junior Artist & Repertoire Manager begann damit, dass mir mein zukünftiger Chef mitteilte, heute sei sein letzter. Was für eine sprunghafte Branche, dachte ich, als ich ihm viel Glück auf seinen Wegen wünschte. Ich ging nicht zu Unrecht davon aus, nun ein bisschen unbeobachteter recherchieren zu können. Noch immer wollte ich die schmutzigen Geheimnisse des Musikbusiness aufdecken, indem ich als verdeckter Ermittler arbeitete. Wäre ich aufmerksam genug gewesen, hätte mir auffallen müssen, dass mir schon kurz darauf der Stoff für eine viel gewaltigere Story in den Schoß fiel: Die Geschichte vom Anfang des Endes der Musikindustrie, wie wir sie kannten. Und ich war live dabei.
Ein dicker Mann mit Halbglatze, der mich stark an den damaligen südafrikanischen Staatspräsidenten Piet Botha erinnerte, stand im Ostseebad Timmendorf auf der Bühne des Golf & Sporthotels. Mir und den meisten anderen Anwesenden ging es schlecht. Der Tag war noch jung und der Abend zuvor ein unglaubliches Kräftemessen mit Schnäpsen und Bier zwischen uns, den Produktmanagern, und dem Außendienst gewesen, welches Letzterer nach Punkten klar für sich entschieden hatte. Auf den nächsten Vertriebstagungen, das schwor ich mir, würde ich, was das Trinken angeht, besser vorbereitet sein. Jetzt sah ich nur Kreise. Sie hatten alle ein Loch in der Mitte und wurden per Overhead-Folien an die Leinwand projiziert. Der große, korpulente Herr, der sich als Jan Timmer, Weltchef der PolyGram, vorgestellt hatte, gab den Dingern Namen. Das eine war eine Daten-CD, die auf Computer-Bildschirmen lustige Bilder zeigen konnte: die spätere CD-ROM. Das andere war eine bespielbare CD, die Daten aufnehmen konnte – die spätere CD-R. Nicht nur der Kater ließ den Vortrag reichlich abstrakt erscheinen. Bei der ganzen Polydor stand ein einziger Computer und den durfte nur bedienen, wer dafür eine spezielle Ausbildung nachweisen konnte. Mein Ferienjob als Datentypist bei der Albingia Versicherung hatte mich jedenfalls noch nicht qualifiziert.
Bespielbar – das klang in der Tat nicht gut, wenn ich an unsere Rechte dachte. Aber die Kassette war genauso bespielbar und sie hatte die Branche schließlich auch nicht umgebracht. Ich erinnerte mich schmunzelnd an die hilflose »Hometaping is killing Music«-Kampagne der Industrie. Keiner sprach mehr davon, seit die CD ansetzte, das schwächelnde Vinyl zu ersetzen. Die hatte Timmer gegen den anfänglichen Widerstand der restlichen Musikwirtschaft durchgeboxt. Konnte er es dabei nicht bewenden lassen? Wir hatten Kopfschmerzen und wollten heute alles, nur eins nicht: den nächsten Formatwechsel. Denn endlich ging es der Branche wieder gut, der Schrecken von 1979, als der Markt erstmals deutlich einbrach, steckte ihr allerdings noch tief in den Knochen.
Bei PolyGram hatte man ein Jahr zuvor auf spektakuläre Weise die Korken knallen lassen. Saturday Night Fever und andere Platten der ausklingenden Discowelle bescherten 1978 traumhafte Gewinne. Das musste gefeiert werden. Bei der Jahrestagung in Florida ließ man den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger als Gastredner antreten, per Firmenjet eingeflogene Flamingos staksten durch einen künstlichen, für diesen Abend angelegten See und man gönnte sich Kaviar satt. Ein Jahr später fehlten die Hits, die die Absatzschwäche des Formats Vinyl hätten überdecken können, es drohte die Pleite.
Ich war leider nicht dabei, kenne dieses Fest aber aus der eindringlichen Schilderung des ernst dreinblickenden Personalchefs auf einem Mitarbeiterseminar in Noordweik. Damals, 1990, schüttelten wir nur die Köpfe bei der Betrachtung dieser »Case Study«. Diese Idioten – das dachten und sagten wir. Jedes Kind, das ein Marketing-Proseminar von innen gesehen hat, weiß doch, dass es so etwas wie einen Produktlebenszyklus gibt. Erst kommt die Einführungsphase, dann die Wachstumsphase, die Reifephase, die Sättigungsphase und schlussendlich die Degenerationsphase. Dafür gibt es sogar mathematische Formeln, das ist vorhersehbar. Das Ende des Vinyls war also keine Überraschung, die Naivität unserer Vorgänger hingegen schon.
Jan Timmer und sein Vortrag kamen mir dabei nicht in den Sinn. Nichts anderes war damals schon seine Botschaft gewesen. Und diese galt eben genauso für die nächste Generation von Tonträgern, für die edle CD, die uns gerade ungeahnte Renditen deutlich über 20 Prozent bescherte. Er stellte uns noch keine Prototypen der CD-R vor, zeigte aber, was die logischen und technisch möglichen Schritte seien, an denen der CD-Patentinhaber, unsere holländische Mutterfirma Philips, selbstredend arbeiten würde. Der Tag würde kommen und somit der Anfang vom Ende der CD und des Geschäfts mit ihr, wie wir es kannten.
1990 übernahm Jan Timmer für sechs Jahre den obersten Chefposten des gesamten Philips-Konzerns. Und obwohl er bei dem schwer angeschlagenen holländischen Elektrogiganten ein hartes Sanierungsprogramm namens »Centurio« fuhr, dem mehr als 50.000 Kollegen aus der Hardware-Sparte zum Opfer fielen – das brachte Timmer den Beinamen »der Schlächter von Eindhoven« ein –, wurden die Interessen der Software immer gewahrt, solange er an der Spitze stand. Sein Interesse galt der Neuerfindung von Philips als Medienkonzern mit starker vertikaler Integration – ab einer bestimmten Größenordnung der Firma, der Territorien und der zu vermarktenden Themen ist es immer weniger sinnvoll, Profitmaximierung durch Kostenreduzierung zu suchen. Das geschieht vielmehr durch Absorption von Kosten im Konzern. Wenn eine Firma viele Phasen der Wertschöpfung kontrolliert, kehren viele Kosten als Einnahmen in anderen Bereichen zurück.
Das Zentrum von Timmers Strategie war das Musiksegment PolyGram; damit kannte er sich aus und er sah in Inhalten wie Musik die größten Entwicklungschancen. Sein Ziel: Content mit Hardware-Interessen zu verknüpfen und sich gegenseitig treiben zu lassen. Die Einführung der CD war ein perfektes Beispiel für diese Strategie.
Die Geschichte der CD begann 1969, als der holländische Physiker Klaas Compaan die Idee einer laserabgetasteten Platte hatte. Ein Jahr später arbeitete er zusammen mit seinem Kollegen Piet Kramer am Prototypen. Mitte der siebziger Jahre setzte sich dann das Kapital in Bewegung – Lou Ottens, damaliger Direktor von Philips, vertrat die Meinung, dass kompakte Abmessungen Grundbedingung für eine erfolgreiche Vermarktung seien. Er nannte das Projekt »Compact Disc« und wurde so zum Namensgeber. 1979 stellte Philips den Prototyp des CD-Players vor und ging mit Sony eine strategische Partnerschaft ein. Die Kooperation sollte sich als brillanter Doppelschlag herausstellen. Einerseits technologisch, denn Sonys Know-how bei der Digitalumwandlung ergänzte sich mit Philips CD-Entwicklung ideal. Andererseits besaß Sony bereits Anteile an CBS und konnte so dabei helfen, die ursprüngliche Ablehnung sämtlicher Plattenfirmen gegenüber dem neuen Format zumindest bei einem der großen Player zu durchbrechen. Philips hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Millionen US-Dollar in die Entwicklung der CD gesteckt und teilte das auf unmissverständliche Weise der Konzern-Tochter PolyGram mit – her mit dem Repertoire, hieß die Devise. Am 17. August 1982 präsentierte Philips dann gemeinsam mit PolyGram der Öffentlichkeit den ersten Player samt CD: Walzer von Frédéric Chopin, in einer Einspielung des Pianisten Claudio Arrau. Kurze Zeit später erschien das erste Popalbum: The Visitors von ABBA.
Die Entwicklung der CD und des dazugehörigen Players zeigt beispielhaft, wie entscheidend Bequemlichkeit und Emotionalität für den Konsumenten und damit für den Erfolg einer Markteinführung sind: Gerade weil sich in der einfachen äußeren Benutzbarkeit des CD-Systems die zugrunde liegende technische Komplexität nicht spiegelte, gelang die extrem schnelle Markteinführung mit gewaltigen Verkaufserfolgen. Im ersten Jahr produzierte PolyGram 376.000 CDs – dann explodierte die Nachfrage. 950 Millionen CD-Player und Milliarden bespielter CDs wurden bis heute verkauft.
Das Phänomen Digitalisierung erreichte durch die CD zum ersten Mal massiv den Massenmarkt; aber nicht als Furcht einflößender Datenmoloch, sondern als hörbarer, spürbarer Qualitätssprung für den Nutzer. Die CD war unempfindlicher als Vinyl, die Titel ließen sich einfach anwählen – eigentlich konnte man kaum noch etwas falsch machen. Die CD war zwar eine technische Innovation, eine »kalte« Entwicklung, eigentlich nur die Umwandlung von Musik in zahllose Nullen und Einsen, aber sie wurde »warm«, also emotional verkauft. Ihr Inhalt – Musik – war dabei entscheidend. Und die Künstler: Herbert von Karajan gab auf zweifache Weise den Standard vor. Bereits im Frühjahr 1981 hatte der Dirigent der Berliner Philharmoniker als erster Künstler eine CD-Demonstration erhalten. Er liebte das neue Format. Und er erzählte bereitwillig jedem von seiner jungen Liebe. »Eine technologische Errungenschaft«, schwärmte von Karajan, »vergleichbar dem Übergang von der Gaslampe zu elektrischem Licht.«
Gleichzeitig gab es zwischen Philips und Sony Diskussionen über die Größe der CD. Ursprünglich war der Disc-Durchmesser von Philips auf 115 Millimeter festgelegt worden – das entsprach einer Spielzeit von 66 Minuten. Doch auf Betreiben von Sony wurde er auf 120 Millimeter und 78 Minuten Maximalspielzeit nach oben korrigiert. Der Grund: Sony-Präsident Norio Ahga, ein ehemaliger Opernsänger und Klassikfanatiker, verlangte, dass Beethovens Neunte, seine Lieblingssymphonie, in der Einspielung von Karajan auf der CD Platz finden müsse. Und diese Einspielung dauerte nun mal 72 Minuten. Die Auswirkungen waren dramatisch: Sony-Mitarbeiter hatten bisher ihre Demo-CDs bei Vorführungen locker aus der Brusttasche gezogen, um die praktischen Ausmaße der neuen Schallplatte zu verdeutlichen. Die vergrößerte CD passte nun aber nicht mehr in normale Brusttaschen. Also erhielten alle Sony-Mitarbeiter Hemden mit größeren Brusttaschen. Und dieses neue Maß wurde dann wiederum als Herrenhemden-Standard in Japan eingeführt.
Nur die Plattenfirmen weigerten sich, die CD als neues Speichermedium für Musik zu akzeptieren und als Chance zu begreifen. Und das, obwohl ihnen bereits das Wasser bis zum Hals stand, weil die Umsätze mit Vinyl wegbrachen. PolyGram-Chef Jan Timmer reagierte, übernahm die Führung und kündigte ein 500-Tage-Programm an, innerhalb dessen er für sämtliche Territorien CD-Fabriken bauen ließ und damit den Markt vor sich hertrieb.
Gleichzeitig entwickelte der damalige Chef von Philips, Cor van der Klugt, gemeinsam mit Sony-Präsident Akio Morita eine bauernschlaue Verhandlungstaktik: Auf einem US-Meeting mit den Chefs der großen Musikfirmen, denen 3 US-Cent Lizenz pro CD zu hoch erschienen und die einen Boykott planten, sollte das weitere Vorgehen besprochen werden. Als alle Manager zusammensaßen, erklärte van der Klugt: »PolyGram hat zwei Anwälte mitgebracht. Jeder, der einen CD-Boykott zum Thema macht, erhält umgehend eine gerichtliche Vorladung und wird verhaftet, sobald er diesen Raum verlässt. Denn es ist in den USA illegal, einen Boykott auszusprechen.« Die Musikchefs waren überrumpelt, der Schachzug gelang, es kam nie zu einem Boykott.
Kurz darauf sah Philips davon ab, den Plattenfirmen Lizenzen für die Nutzung des CD-Patentes zu berechnen. Stattdessen wurden von allen Presswerken (die meist den Muttergesellschaften gehörten und diese Gebühr als Bestandteil der Fertigungspreise einfach aufschlugen) 3 US-Cent pro Disc eingeholt. Gleichzeitig pendelte sich der Preis für eine CD fast 100 Prozent über dem einer LP ein. Nun begann die Skepsis der Musikmanager zu weichen.
Während die CD rasend schnell vom Spielzeug für Klassik-Snobs zum Spielzeug für Rock-Snobs, also zum Musikalltag von Millionen wurde, begann die Musikindustrie mit wachsender Begeisterung, ihre zuvor ängstlich geschützten Master in digitaler Form ans Volk zu verteilen.
Das Paradies – erschaffen durch Emile Berliner und Fred Gaisberg
Ich kam gerade rechtzeitig zum 100. Geburtstag der Schallplatte in den PolyGram-Konzern. 1987 wurden Emil Berliner und seine Erfindung gefeiert. Wir bekamen einen Ersttagsbrief mit den Jubiläumsbriefmarken der Deutschen Bundespost und eine Festschrift geschenkt. In der konnten wir nachlesen, dass Emil mit 14 die Schule abgebrochen hatte, um dann mit 19 Jahren vor dem preußischen Wehrdienst nach Amerika zu fliehen. Die Lektüre eines physikalischen und meteorologischen Lehrbuchs des Freiburger Professors Johannes Müller brachte Emile – um amerikanischer zu erscheinen, hatte er mittlerweile ein »e« an seinen Vornamen gehängt – dazu, sich mit elektronischen und akustischen Phänomenen zu beschäftigen. Die Begeisterung dürfte durch Nachbarstochter Cora gesteigert worden sein. Berliner, der seine Brötchen eigentlich als Buchhalter verdiente, musste für seine akustischen Experimente nach Feierabend auch Strippen durch die Zimmer ihrer Familie ziehen. Die geduldigen Adlers von nebenan ließen ihn gewähren und schließlich ihre Tochter heiraten. Ergebnis der hormongetriebenen Forschung war die Erfindung des Telefonmikrofons. Das Patent verkaufte er Alexander Graham Bell und ermöglichte diesem die Massenproduktion des Telefonapparats. Seinen Brüdern Joseph und Jacob baute er daheim in Hannover eine eigene Fabrik. Mit Telekommunikation verdienten die Berliners 20.000 Mark Startkapital, um im Jahr 1892 die Grammophon Gesellschaft zu gründen.
Thomas Alva Edison hatte derweil den Phonographen erfunden, um Stimmen aufzuzeichnen. Einige Hundert Exemplare tourten ab 1877 über die amerikanischen Jahrmärkte und versetzten das Volk in Staunen. Edison selbst hatte längst das Interesse verloren und wendete sich der Erfindung der Glühbirne zu. Emil Berliner hingegen setzte statt auf das Büro und die Tonaufzeichnung fürs Diktat lieber auf den Hausgebrauch. Sein 1887 zum Patent angemeldetes Grammophon verwendete anstelle von Walzen leicht austauschbare Platten und war deutlich billiger zu produzieren.
Das »Vaterunser«, gesprochen vom Straßenhändler John O’Terrel, hieß der erste Bestseller. Dieser Hit war geplant, die Technik hingegen noch nicht ganz ausgereift und Berliners Kalkül, dass das Vaterunser jedermann mitsprechen könne und deshalb die Aussetzer auf der Platte nicht so sehr stören würden, ging auf. Die Software diente lediglich als Mittel zum Verkauf der Ware Grammophon. Das Niveau der ersten Schallplatten war deshalb eher niedrig und das Image der Hardware litt darunter. Im Volksmund hieß das Grammophon plötzlich »des Spießers Wunderhorn«. Um das zu ändern, brauchte es den ersten künstlerischen Leiter, also den Urvater aller späteren Artist & Repertoire Manager, den die junge Grammophone-Gesellschaft sich leistete.