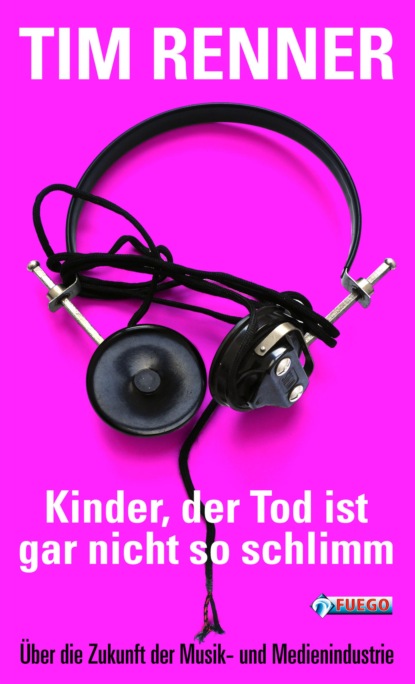- -
- 100%
- +
Das alles klingt relativ schwammig und wenig zuverlässig, entscheidet aber halbjährlich über Gedeih und Verderb ganzer Stationen, ihrer Programmchefs und Chefredakteure. Selbst die beeindruckende Summe von 50.000 Befragten relativiert sich, wenn man bedenkt, dass, in Relation gesetzt, die amtlichen Messergebnisse beispielsweise eines Senders aus dem Raum München auf weniger als 1.000 Anrufen basieren. Es erklärt aber, warum die Sender ihren Musiktests vertrauen. Denn es sind dieselben Menschen, die sich an Research und Media Analyse beteiligen: Leute, die sich freuen, mal mit einbezogen, mal gefragt zu werden. Alle anderen haben keine Zeit für die penetranten Anrufe aus dem Call-Center. Wenn aber Marktforschungsteilnehmer über den Erfolg oder Misserfolg eines Radioprogramms entscheiden, dann muss das Programm folgerichtig auch maßgeschneidert für Marktforschungteilnehmer sein. Und so sind die Verfahren von Media Analyse und Sender-Research konsequent aufeinander eingestellt.
Zu Anfang pilgerten fast alle Verantwortlichen der Sender zu Ad Roland, um von ihm zu lernen, wie das geht. Der in die Jahre gekommene DJ aus Holland war einer der wenigen, der sich schon lange mit den Modalitäten des Privatfunks auskannte. Noch unter dem Monopol des Staatsfunks hatten die so genannten Seesender von internationalen Hoheitsgewässern aus in Richtung England und Benelux ihre Programme ausgestrahlt. Ad Roland war mit Radio Mi Amigo dabei, so lange bis der Frachter Magdalene, der als Basis diente, 1979 strandete und von den niederländischen Behörden aufgebracht wurde. Als Radio-Consultant ging es ihm aber deutlich besser als auf hoher See. Er brachte privaten und auch öffentlich-rechtlichen Mitarbeitern bei, wie man die Musikarchive drastisch zusammenstreicht (teilweise auf bis zu 500 Titeln, also 5 Prozent dessen, was auf einen gewöhnlichen Apple iPod passt), um das Format des Senders klar herauszuarbeiten, wie man mit Jingles umgeht, damit der Claim des Senders einem jeden geläufig und die Station bei der nächsten Media Analyse bekannt genug ist, damit der Befragte meint, sie gehört zu haben. Er brachte den Moderatoren die ewig gute Laune bei und schulte sie darin, ein Tonstudio komplett selbstständig zu bedienen.
Letzteres war sicher ein Segen. Ich musste dereinst noch dem Tontechniker ein Zeichen geben, »abwinken«, bevor der nächste Titel kam. Beim letzten Satz hieß es: Arm hoch. Wenn einem dann doch noch etwas einfiel, saß man blöd hinter der Scheibe, mit ausgestrecktem Arm, der sich erst senken durfte, wenn das letzte Wort gesprochen war.
Derselbe Lehrer, dieselbe Zielgruppe, identische Erhebungstechniken – aus der medialen Vielfalt wurde in der Breite Einfalt. Die meisten Sender klangen einfach gleich und tun das bis heute. Der Radioberater und die Auswirkungen seiner Ratschläge auf das Programm war nicht allein ein deutsches Phänomen. In Amerika dankten es die Rapper von Public Enemy dieser Berufsgruppe 1992 mit dem Song How To Kill a Radio Consultant.
Das Paradies – Gefilmt von Peter Rüchel und Andreas Thiesmeyer
In den sechziger Jahren begann der lange Marsch des Fernsehens ins Herz der deutschen Familie. Während 1954 noch mickrige 88278 Fernseher angemeldet waren, gab es 1964 bereits 10 Millionen Geräte. Anfang der siebziger Jahre war das Fernsehen praktisch in jedem deutschen Haushalt präsent. Es hatte stillschweigend das Radio als Zentrum des Familienverbandes ersetzt – aus dem Prinzip Volksempfänger war das elektronische Lagerfeuer geworden. Die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten teilten sich den Kuchen auf: hier die föderal strukturierte ARD mit ihren unterschiedlich mächtigen Regionalsendern, dort das ZDF als zentralisierter Riesenapparat. Popmusik tröpfelte ganz langsam ins Programm. Einzelne streitbare Redakteure in den jeweiligen Funkhäusern erkämpften sich die Flächen.
»Nun ist es endlich so weit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im Deutschen Fernsehen, die nur für Euch gemacht ist. Und Sie, meine Damen und Herren, die Sie Beatmusik nicht so mögen, bitten wir um Ihr Verständnis.« Mit diesen Worten kündigte der spätere Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben den ersten Beat Club am 25. September 1965 an. Michael »Mike« Leckebusch hieß der ambitionierte Unterhaltungsredakteur bei Radio Bremen, der das neue Format bei den Senderverantwortlichen durchgesetzt hatte; Uschi Nerke war seine Moderatorin. Anfangs tastete man sich mit lokalen Stars wie den Rattles oder den Lords ans Publikum heran, später kamen dann Bands wie Steppenwolf, Jethro Tull oder Status Quo, aber auch die Beach Boys, The Doors oder Kraftwerk dazu. Die Auftritte waren selbstverständlich live, eine Hand voll überdrehter Studiogäste feierte jede Band. Die Jugendlichen waren begeistert, die Eltern empört, die Medien ratlos. Zum ersten Mal öffnete sich das deutsche Fernsehen für die musikalischen Innovatoren aus den USA und aus England.
Schnell sprach sich das TV-Ereignis herum und wurde für jeden halbwegs angesagten Jugendlichen unverzichtbar. Da es noch keinen eigenen Fernseher im Kinderzimmer gab, kam es am Samstagnachmittag in zahllosen Familien zum Generationenkonflikt. Die Eltern schimpften auf »Negermusik« und »langhaarige Gammler«, deren Darbietungen keinen schlechten Einfluss auf den Sohn oder die Tochter ausüben sollten. Die Kinder moderierten, übersetzten, erklärten – ständig darum bemüht, keine Sekunde der kostbaren Sendung zu verpassen. Von Empörung und Ablehnung bis zu Annäherung und gemeinsamer Begeisterung: Popmusik und Fernsehen waren die Grundlage eines großen Identitätsdiskurses im Wohnzimmer.
Bis 1972 produzierte Leckebusch 86 Sendungen vom Beat Club. »Zum Schluss hatte ich nur noch die Kiffer vor der Röhre«, klagte er, und tauschte das Auslaufmodell gegen ein neues Format aus – den Musikladen. Psychedelische Farbspielereien, poppige Überblendungen, Go-Go-Tänzerinnen ohne Hemd, aber noch mit Höschen, und kreischende Bildverfremdungen waren Zeichen einer neuen Zeit. Das bewährte Team wurde ab 1973 mit dem präpotenten Co-Moderator Manfred Sexauer aufgefrischt. Und wieder prägte Leckebusch die deutsche Pop-Geschichte: Ein Auftritt in seiner Sendung galt unter Künstlern und Plattenfirmen als Garant für den Einstieg in die Charts. Leckebusch war das Nadelöhr, sein Geschmack entschied, bei ihm standen die Promoter Schlange. Um einen Auftritt im Musikladen und im Nachfolger Musikladen Eurotops wurde mit allen Mitteln gekämpft. Leckebusch hatte beim Sender irgendwann durchgesetzt, dass die Sendung ohne störendes Publikum produziert werden konnte, und kurzerhand das Studio zu sich nach Hause verlegt. Etwas schaurig war die Anreise schon, denn sein Anwesen lag mitten im Wald, nah der Autobahn nach Bremerhaven. Im Stil typischer »Ich-hab-es-geschafft«-Architektur der siebziger Jahre wirkte es wie ein reichlich aufgepumptes Reihenhaus. Das Studio befand sich im Anbau – auf 50 Quadratmetern. Hierhin reisten also die Pop-Legenden, drängelten sich zwischen Kabeln und Kameras auf die Bühne und erfreuten sich an der clubartigen Atmosphäre und den ebenso freundlichen wie hübschen Praktikantinnen. Newcomer, von denen Leckebusch noch nicht völlig überzeugt war, konnten sich bei ihm für 10.000 Mark einen Blue-Screen-Auftritt für spätere Promotionzwecke erkaufen. Der wurde dann mit für den Musikladen typischen Psychedelic-Effekten hinterlegt. So entwickelte Leckebusch die frühe deutsche Variante des Musikvideos.
Ohne ihn lief gar nichts, er war Regisseur, Produzent und Redakteur in einer Person. In den siebziger Jahren galt er als mächtigster Mann der Branche. Und er nutzte diese Macht für höchst individuelle Entscheidungen – spielte Tina Turner, als niemand sonst das tat, boxte Roxy Music in die Charts und brachte Boney M. unglaubliche 15-mal, bis auch der letzte Zuschauer Rivers of Babylon mitsingen konnte. 1984 endete der Musikladen nach 90 Ausgaben mit Do They Know It’s Christmas Time.
Andere Musikformate waren dazugekommen und hatten Leckebuschs Sendung das Monopol streitig gemacht – die WDR Plattenküche mit Helga Feddersen und Frank Zander, Bananas und Känguruh mit Hape Kerkeling. Hier war Erfinder und Redakteur Rolf Spinnrads höchst individuell um die Musik bemüht. Was ihm gefiel, bekam volle Unterstützung. Und sei es die völlig unbekannte Deutschrockband Düsenberg, die so oft in seiner Plattenküche angekündigt wurde, ohne dort zu erscheinen, dass ihr allein der Auftritt in der letzten Folge den ersten und einzigen Hit einbrachte. Es gab Disco mit Ilja Richter und dem damals schon entscheidungsstarken, aber nicht immer geschmackssicheren Redakteur und späteren Musikmanager Thomas Stein. Es gab die Music Box im Kabel mit den Redakteuren Jörg Hoppe und Christoph Post, die später als Mitgründer von VIVA das deutsche Musikfernsehen erheblich prägen sollten.
Das Musikvideo wurde im deutschen Fernsehen von Formel Eins entdeckt. Andreas Thiesmeyer, ehemaliger Polydor-Außendienstmitarbeiter und späterer Produktmanager von James Last und der Kelly Family, überzeugte die ARD-Sendeverantwortlichen, ihm für das ungewöhnliche Konzept in den dritten Programmen eine Versuchsfläche einzuräumen. Internationale Künstler hatten 1983, als Formel Eins im April zu senden begann, in der Regel ein Video; bei lokalen Künstlern war es die absolute Ausnahme. Thiesmeyer löste das Problem, indem er einfach selbst Videos produzierte. Über seinen Geschmack mag man streiten, aber alle deutschen Bands, die in die Charts wollten, standen irgendwann auf dem Bavariagelände zwischen Oldtimer-Wracks und brennenden Mülltonnen vor den Kameras seines Teams. Ein unglaublicher Aufwand wurde betrieben. Mehr noch als zuvor im Musikladen konnte ein Auftritt in Formel Eins über die Karriere eines Künstlers entscheiden. Thiesmeyer war sich dessen bewusst, stellte sich zusammen mit Redakteur Roman Colm manch scharfer Diskussion mit Künstlern und Plattenfirmen. Der Erfolg wurde ab Januar 1988 mit einem Sendeplatz im ersten Programm am Samstag um 15 Uhr belohnt. Vorher lief Formel Eins am Abend. Mit der neuen Uhrzeit entfernte sich das Format von der Musik und seiner eigentlichen Zielgruppe – um 15 Uhr schauten Kinder oder Rentner zu, aber immer weniger Fans. Mit Reisereportagen versuchte man vergeblich, den Verfall der Sendung zu stoppen. Ab 1990 übernahm konsequenterweise der Disney Club.
Im Rockpalast konnte sich sogar der gehobene Fan wiederfinden. Peter Rüchel, der engagierte Chef des WDR-Jugendfernsehens hatte eine Sendung mit Livemusik durchgesetzt, die im hauseigenen Studio vor 80 Gästen aufgezeichnet wurde. Die Idee flog nicht, Versuchskaninchen wie die Band Procul Harum waren reichlich frustriert. Zum einen kann man Rockkonzerte nicht auf 30 Minuten begrenzen, zum anderen kam im kleinen Rahmen keine rechte Stimmung auf. Rüchel gab nicht auf, sondern dachte groß. Er brauchte eine richtige Halle, er brauchte eine ganze Nacht. Besessen von der Idee, aber ohne Beleg dafür, dass es klappen könnte, überzeugte er dennoch seine Vorgesetzten, ihm pro Rockpalast-Nacht fünf bis sechs Stunden Sendezeit einzuräumen. Und er gewann auch andere für seine Idee: Von Anfang an machten sieben Nationen von Italien bis Norwegen mit.
»Learning by doing – europaweit live! Denn im technischen Sinne hatten wir damals keine Ahnung«, erinnert sich Rüchel. »Als Produzent mittendrin stehend, habe ich gedacht: ›Die lassen uns nie wieder auf den Sender!‹ Die Umbaupause von Rory Gallagher auf Little Feat dauerte 45 Minuten, den Moderatoren ging der Stoff zum Moderieren aus – es war einfach ganz furchtbar.« Rüchel hat das Unmögliche gewagt und deshalb gewonnen. Die lange Nacht des Rockpalast wurde im ersten Programm zur Institution. Man traf sich bei Freunden, drehte den Ton des Fernsehers ab und das Radio aus Vaters Anlage auf volle Lautstärke (alle ARD-Radiostationen übertrugen das Ereignis parallel) und genoss am späten Samstagabend stundenlang die Crème der Rockmusik im HiFi-Stereosound: The Who, Van Morrison, The Police bis zu Einstürzende Neubauten, live und ungekürzt aus der Grugahalle in Essen oder der Philipshalle in Düsseldorf, unterbrochen von Interviews in den Umbaupausen und eingestimmt von Albrecht Metzger: »German Television prrroudly prrresents ...«
Es gab verschiedene Plattformen, die sich unterschiedlich definierten. Es ging um Schlager oder Rock, Single-Stars oder Album-Acts, Live oder Playback, und immer standen dahinter klare Entscheider. Es gab Fernsehpersönlichkeiten, die für ihre Inhalte kämpften und sich dann auch dafür verantwortlich fühlten. Niemand verschanzte sich hinter einer Redaktionskonferenz oder einer Abhör-Jury wie später die Videokanäle. Es gab den Redakteur, den man anrufen konnte, der für weibliche Überredungskünste anfällig war oder sich gerne mal zum Essen einladen ließ. Das war niemals gerecht oder objektiv, das konnte hoch korrupt sein, war aber in jedem Fall individuell und vom Ergebnis her emotional und spannend. In den öffentlich-rechtlichen Sendern gab es für aktive Redakteure Spielräume, Quotenangst spürte man dank fehlender Konkurrenz noch nicht. Dass Musik kein leichter Sendeinhalt ist, war bekannt: Zwischen den bundesdeutschen Wasserwerken und dem ZDF bestand die Absprache, die Wasserwerke vorzuwarnen, bevor in der Sendung Wetten, dass ..? die musikalischen Pausen kämen. Nur so hätten sie die Chance, für die Pinkelpause die Kapazitäten rechtzeitig hochzufahren ... Dass dies dem Harndrang von mindestens zwölf Millionen Menschen geschuldet war, wusste man schon damals.
Messungen von Reichweiten und Zuschauerzahlen wurden schon länger vorgenommen, doch wirklich wichtig waren die Analysen erst ab 1988, als sich die öffentlich-rechtlichen Sender mit den großen Privaten zur Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung zusammentaten und die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) mit der sekundengenauen Erschließung des Programms beauftragten.
Schritt für Schritt begannen die privaten Anbieter, ihre Logik der Quantität, der Reichweite, der Zielgruppenpräsenz auf die gesamte Fernsehlandschaft zu übertragen. Auf welche Weise die Zuschauer mit dem umgehen, was sie sehen, ob und wie Fernsehen sie bewegt hat, wird immer weniger wichtig – das Einzige, was in den Sendern zählt, wenn am Morgen nach der Ausstrahlung die Quoten herumgereicht werden, ist die schlichte Zahl. Und bei den Analysten in den Sendern ist Musik zunehmend verpönt, denn sie führt zu Dellen in der Quotenkurve, zu den verhassten »Umschaltern«. Der Grund ist einfach: Alles, was emotional ist, führt auch zu Ablehnung. Je emotionaler, umso heftiger. Je heftiger, umso schneller wird umgeschaltet. Da sich die Qualität von Musik und ihrer Darbietung aber nun mal danach bemisst, so emotional wie möglich zu sein, widerspricht das zutiefst einem Fernsehideal, das auf stabilen Quoten, auf purer Quantität beruht.
Parallel zum Start des Privatfernsehens und den diversen neuen Kanälen kam ein weiteres Phänomen hinzu: Die Zahl der Zweitgeräte wuchs. Ende der achtziger Jahre besaß bereits jeder dritte Haushalt eines. Meist stand es im Kinderzimmer. Resultat: Der Familienverbund vor dem Fernseher wurde gesprengt. Immer seltener kam es zu TV-Ereignissen, die generationsübergreifend erlebt wurden – samt Geschmackskollisionen und Identitätsreibung. Popmusik wurde zur Privatangelegenheit. Bald regierten die Musiksender MTV und VIVA im Kinderzimmer. Und die Eltern waren froh, in Ruhe den Tatort sehen zu können. Die dringend notwendige Erneuerung des Mainstreams, der Moment, da die Jüngeren den Älteren erklären, worum es der neuen Band geht, die gerade in der Abendshow spielt, blieb dadurch aus.
Das Paradies – Beschrieben von Frank Bielmeier und Andreas Banaski
Gegen Ende der siebziger Jahre schoss an fast jeder Ecke einer Studentenstadt oder eines Univiertels ein Copyshop aus dem Boden. Die Firma Xerox hatte den Fotokopierer zwar schon 1949 erfunden, aber erst jetzt war das Gerät so günstig geworden, dass man eine Kopie für 10 Pfennige anbieten konnte. Keine Schriftsetzer, keine Filme, keine Druckkosten, eine ungeahnte Freiheit für jeden, der etwas mitteilen wollte und es sich zuvor nicht leisten konnte. Es wurde wie im Rausch kopiert, und das nicht nur vom AStA, den Atomkraftgegnern und studentischen Dritte-Welt-Gruppen, auch die Punks standen hinter den modernen Maschinen. In so genannten »Fanzines« (kurz für Fan-Magazines) schrieben sie über ihre eigene Bewegung, emanzipierten sich von der bürgerlichen Presse, die sie nicht verstand und von der sie nicht verstanden werden wollten.
Die ersten Fanzines tauchten 1976 in London auf, hießen Sniffin’ Glue, Ripped and Torn oder London Outrage. Die Bilder klebten krumm und schief, die Texte waren mit mechanischen Schreibmaschinen oder gar mit der Hand geschrieben, Korrekturen blieben einfach im Text stehen, Grammatik und Orthografie interessierten nicht und die Überschriften klebte man aus einzelnen ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben zusammen. Sie sahen aus wie Erpresserbriefe. Der Wille zum eigenen Medium schaffte einen eigenen Stil, der sich radikal von allen Hochglanzmagazinen abhob. Man war schneller, günstiger, direkter und dreckiger als sie. Die Auflagen waren meist gering, überschritten kaum 100 Exemplare und wurden im Bekanntenkreis oder über den örtlichen Schallplattenladen vertrieben. Meist kamen sie über ihre Region nicht hinaus. Da man Fanzines weiterreichte, ein Exemplar viele Leser hatte, schafften sie ein dichtes lokales Informationsnetz. Die Punks hatten ein steinzeitliches Internet aus Papier erfunden.
Jeder war plötzlich Journalist, und alle schrieben es so auf, wie sie es erlebten. Sie hatten es nicht anders gelernt, und es entsprach genau dem eigenen Anspruch an Wahrhaftigkeit. Thema waren die eigenen Bands oder die von nebenan. Das System sah in Deutschland nicht anders aus als anderswo. Sein Epizentrum befand sich 1977 noch rund um Düsseldorf, wo auch unweit, in Grevenbroich, The Ostrich von Frank Bielmeier erschien. Bezeichnenderweise lag in Neuss, auf halber Strecke zwischen beiden Städten, die Zentrale des Kopiererherstellers Xerox. In der ersten Ausgabe des selbst kopierten Hefts heißt es vom Herausgeber: »Suche Typen, die Lust haben, eine Punk-Band zu machen! Brauche Bassist und Schlagzeuger.« In der zweiten Ausgabe fragt er schon: »Wer interessiert sich für Kassetten von Charley’s Girls???«
Gemeldet hatte sich ein gewisser Peter Hein. Man nahm ihn in die Gruppe auf, sie wurde zur Keimzelle für Mittagspause, aus denen wiederum mit Fehlfarben die wohl wichtigste Band der Neuen Deutschen Welle hervorging. Deren Sänger Peter Hein stand zu der Zeit bei Xerox in Lohn und Brot: »Innerhalb kürzester Zeit begann ein Spiel mit Formen und Inhalten, es wurde Kunst der zwanziger Jahre, Propaganda und Pop-Art in die Gestaltung der Zeitung und der Zettel eingebracht, geschrieben, wie man gerade las, hardboiled, surreal, Stream-of-consciousness, was man will«, begeistert Hein sich noch heute. »Und wer beim Kopierhersteller arbeitet, wird ja unfreiwillig bestens gesponsert, so konnten herrliche, endlos vergrößerte Detailausschnitte und Mehrfachbelichtungen zu unerkennbaren Konzertankündigungen und Plattencovern werden.«5
Weil die Szene bewusst und spielerisch auf eine neue Technik zuging, verschaffte sie sich einen gewaltigen Vorsprung. Die Medienindustrie beschäftigte sich noch mit den Auswirkungen der epidemieartig auftauchenden Kopierer auf das Urheberrecht, stritt um den Kopiergroschen, während die Maschinen längst ein Fanzine nach dem anderen ausspuckten. Auch die Leerkassetten, vor denen die Musikwirtschaft so viel Angst hatte, trugen zur Freiheit der Punks bei. Eine Mark-II-Kassette aus Taiwan, die ich auch für mein Fanzine Festival der guten Taten verwendete, kostete nur noch 90 Pfennig im Handel. Der kleine HiFi-Händler ums Eck in Hamburg-Poppenbüttel wunderte sich, dass ich und andere merkwürdige Gestalten sie immer gleich kistenweise kauften.
Die Musik wurde über kleine Kassettenlabels zum Selbstkostenpreis ausgetauscht. Nur scheinbar eroberte die Neue Deutsche Welle die Republik später im Sturm. Als die Massenmedien entdeckten, dass Punk und die Neue Welle weit mehr waren als der Mut zur Hässlichkeit (»Schocken ist schick« schrieb die Cosmopolitan Ende der Siebziger), hat sich jenseits des Mainstreams schon längst eine unabhängige, gefestigte Kultur entwickelt. Das Medienestablishment hatte unterschätzt, wie selbstständig der Underground mithilfe von neuer Technik werden konnte. Ratlose Artdirektoren saßen Anfang der achtziger Jahre über Fanzines wie Willkürakt, Bauernblatt oder Arschtritt und versuchten, deren ästhetische Codes, die plötzlich so gefragt waren, zu entschlüsseln. Die Anzeigen von Musikkonzernen sahen nun wie die von Independents aus. Die Bertelsmann-Tochter Ariola verteilte quietschgelbe Buttons, die wie Badges der Punks wirken sollten, auf denen in roten, zusammengewürfelten Buchstaben »Keine Angst vor den Achtzigern« stand, während dem Management die Knie schlotterten, weil sie glaubten, den Trend verschlafen zu haben. Auch in der Bravo waren auf einmal die Schriften schief und krumm. »Wir dachten schon, das ist der Sieg«, sangen Peter Hein und die Fehlfarben.
Wenn mein Nachbar eine Zeitung machen kann, wieso soll ich dann einem Journalisten glauben, den ich doch gar nicht kenne? Eine berechtigte Frage. Die klassische Musikpresse kam durch die Fanzines enorm unter Druck. Man versuchte, Musik zu objektivieren, schrieb seitenlang über Keyboardflächen, Gitarrenarbeit und Live-Qualität eines Sängers oder versuchte, jeden Ton in einen gesellschaftspolitischen Kontext zu zwängen. Über den Schreiber erfuhren die Leser in der Regel nichts. Das Private im Politischen gab es nicht. Das Feuilleton schrieb über Emotionen, doch die eigenen blieben außen vor? Unglaubwürdig.
Als Erstes ließen die Mitarbeiter des Sounds die Maske fallen und wurden dadurch zum Zentralorgan der Neuen Deutschen Welle. Allen voran Andreas Banaski alias Kid P. Seine Artikel handelten fast ausschließlich von seinen Befindlichkeiten, die Musik wurde so beschrieben, wie sie in seinem Leben vorkam. Der Leser tauchte in Banaskis Tagesablauf ein, begann zu verstehen, warum dieser das eine mochte und das andere strikt ablehnte, ohne mit ihm einer Meinung sein zu müssen. Journalisten waren plötzlich angehalten, ihr Innerstes nach außen zu kehren. In ihrer Subjektivität wurden sie so angreifbar wie die Musik, die sie rezensierten. Objektivität war natürlich einfacher, aber nicht ehrlicher und schon gar nicht fairer.
Offenheit wird belohnt. Ich erfuhr das durch einen Artikel über Tears For Fears, den ich unter Tränen schrieb. Der fünf Jahre ältere Bob hatte alles, was man braucht, um Erfolg bei den Frauen zu haben: reiche Eltern, gutes Aussehen, einen Honda Civic und jede Menge Charme. Aber er war furchtbar schüchtern. Mit einer Mitschülerin, die ich ihm vorgestellt hatte, war es schon wieder vorbei. Er bat abermals um meine Hilfe als Kuppler. Im Visier hatte er diesmal Ute, ein 23-jähriges Mädchen aus der Independent-Szene, auf deren Freundschaft ich als 17-Jähriger mächtig stolz war. Bob mit der extrem coolen Ute zu verkuppeln war nicht leicht, und es nervte mich sowieso, ständig für ihn die Mädchen klarzumachen. Ich verlangte für den Erfolgsfall 1.000 Mark Honorar. Kein Problem für Bob.
Also spannte ich beide in die Dreharbeiten meines Abschlussfilms für den Kunstkurs meiner Schule ein. Film und Beziehung waren fast im Kasten, als wir alle am Abend des 30. April 1982 in Bobs Auto saßen; ich hinten, Ute fuhr. An einer Kreuzung wurde der Wagen von links mit voller Wucht gerammt. Jemand hatte die rote Ampel übersehen. Ich sprang nach vorne und riss Ute aus dem Wrack. Aufgeregt führte ich die Sanitäter, die kurz darauf eintrafen, zur geschockten Fahrerin. Ihr und Bob ging es gut, nur aus meinem Bein floß reichlich Blut.
Auf dem Weg ins Krankenhaus begriff ich es endlich: Ich hatte mich schon lange in Ute verliebt. Sechs Jahre Altersunterschied, aus meiner damaligen Perspektive eine gewaltige Spanne, waren plötzlich egal. Ich hatte mich vorher nur nicht getraut, mir diese Liebe einzugestehen. Ich kratzte so lange in meinem Pass herum, bis 1964, mein Geburtsjahr, wie 1954 ausah. Ich hätte noch viel mehr getan, um mit Ute zusammen zu sein.
Als ich wieder entlassen wurde, war die Sache mit ihr und Bob längst gelaufen, die beiden waren ein Paar. Voller Bitternis und Hass auf mich selbst verlangte ich von ihm die vereinbarten 1.000 Mark. Ich wollte Ute damit zu einer Reise nach Paris einladen, aber Bob verwehrte mir den üblen Lohn. Ich fuhr sofort zu ihr, gestand meine Liebe, erzählte alles. Zu spät. Es war früher Nachmittag, und sie tröstete mich auf dem Balkon ihrer kleinen Wohnung mit viel Aufmerksamkeit und noch mehr Wein.