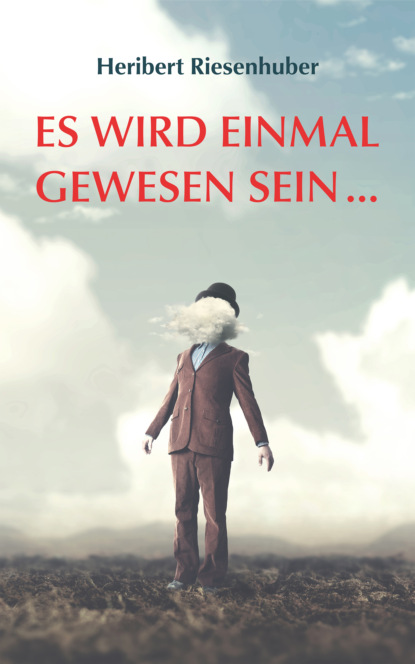- -
- 100%
- +

Heribert Riesenhuber
Es wird einmal gewesen sein …
Inhaltsverzeichnis
Es wird einmal gewesen sein ...
Impressum
Eine Reise in den Süden
Das Talent des Malers
Heinz
Bonjour Danielle
Lächerliche Geschichten
Sommer
Joseph Leon Odysseus
Das Löwengebrüll
Eine ziemlich unwahrscheinliche Geschichte
Anders
Johannas Geheimnis
Der Schuster und das Mädchen
Beziehungen
Nachwort
© 2020 Heribert Riesenhuber
© dieser Ausgabe 2020 Morisken Verlag München
Alle Rechte vorbehalten.
Korrektorat: Theresia Riesenhuber
Cover: Peter Sommersgutter
Bild: fran_kie/Adobe Stock
Satz: Jürgen Eglseer
ISBN: 978-3-944596-25-9
www.morisken-verlag.de
Zuerst erschienen als:
Heribert Riesenhuber: »Es wird einmal gewesen sein …«, mit Zeichnungen von Elisabeth Kaiser, herausgegeben von Guntram Gattner, Murnau 2020, ISBN 978-3-9822488-0-6 (Edition Stories Nr. 1)
https://buchhandlung-gattner.buchhandlung.de
Eine Reise in den Süden
Nein, diesmal würde er nicht den Flieger nach Mailand nehmen, fuhr Guido di Monaco seine Sekretärin unbeherrscht an. Es war aber auch schon das dritte Mal, dass sie diese Frage gestellt hatte. Ein Trillern des Handys gab ihm die Gelegenheit, die Besprechung im Atelier zu beenden, und ein Taxi holte den Münchener Modeschöpfer ab. Beata, ein junges Fotomodell, hatte sie im Café eingesammelt und nun verschwand die Stadt leuchtend im Rückspiegel. Alles war gut geplant. Die Mannequins würden am Abend abfliegen und die Dekoration war bereits auf drei großen Tiefladern unterwegs.
Für Guido di Monaco stand noch ein kurzer Besuch in der Villa auf dem Terminplan. Kaffeetrinken mit seiner Frau, die die einzige war, die ihn noch immer Gerhard rief. Sie saßen auf der Terrasse und in der klaren Föhnluft waren die Berge nichts weiter als ein Steinwurf am Bildrand. Unterdessen wartete Beata im Restaurant der Autobahnraststätte.
Guido schlang sich den weißen Seidenschal um den Hals, löste den Zopf aus den Haaren, damit der Wind im offenen Wagen hindurchstreichen konnte, und drückte das Gaspedal durch bis zum Anschlag. Pfeilschnell raste er über die Autobahn und vorbei an der Raststätte, wo Beata soeben die Bekanntschaft eines jungen Arztes machte. Vielleicht hatte sie genug davon gehabt, immer nur zu warten, vielleicht glaubte sie nicht an den Erfolg di Monacos. Auf jeden Fall: Sie war weg, als der Modedesigner nach einer Wende an der nächsten Ausfahrt endlich am Treffpunkt anlangte. Er vergeudete keine Zeit damit, nach ihr zu suchen. Trotzdem war Guido erst einmal sauer. Dann jedoch ließ er sich berauschen von der Geschwindigkeit und den näher rückenden Bergen. Er hatte Zeit, denn er würde erst in zwei Tagen zur Modemesse erwartet. Aus dem Autoradio dröhnte laute Popmusik.
War das jetzt die richtige Ausfahrt gewesen? Oder hätte er abbiegen müssen? Dort vorne kam noch ein Schild. Wie eine Schwalbe glitt das Auto in weiten Schwüngen den Berg hinauf. Die Abfahrt wird bestimmt kommen. Vielleicht schon hinter der nächsten Kurve. Doch schließlich musste Guido sich eingestehen, die Route zum Tunnel verpasst zu haben. Er befand sich auf einer alten Passstraße. Auch gut! Mit leisem Surren schloss sich das Verdeck des Wagens, als ein leichter Nieselregen einsetzte. Wind ließ die Tannen am Straßenrand sich wiegen, elegant wie Operndiven im Ballkleid.
Mit der Dämmerung fand Guido ein Gasthaus, in dem eine alte Frau ihm ein einfaches Essen servierte. Ob er übernachten wolle? Guido di Monaco lachte. Offensichtlich war er der einzige Gast und die alte Frau setzte sich schmunzelnd zu ihm an den Tisch. Ihr pralles Gesicht war zerfurcht und zerklüftet von Tausend kleinen Falten. Schroff ragte die Nase daraus hervor und nur der sanfte Mund milderte die harte Landschaft ihres von Wetter und Sonne gegerbten Gesichtes etwas. Eisgrau waren die dichten Haare, am Hinterkopf zu einem Knoten gebunden. Der Modeschöpfer betrachtete sie, kaum auf ihre Worte achtend. Die Farbe ihrer Augen, die leuchteten wie zwei blaue Saphire, faszinierte ihn. Plötzlich erwachte er aus seiner Betrachtung, sprang auf und stürzte zur Türe. Der Regen machte die Paar Schritte zum Auto zur Dusche. Sekundenlang perlte das Wasser noch von der Designerjacke, die er über den Kopf gezogen hatte, bis es endlich von jeder Faser aufgesogen wurde. Der Anzug klebte nun wie ein nasser Lappen an Guido. Er tropfte auf die Lederbezüge des Wagens und als er sich im Rückspiegel erblickte, musste er lachen. Nun gut. Er würde also die Nacht in dieser primitiven Hütte verbringen. Die Wirtin legte ein paar Holzscheite aufs Feuer, während Guido sich umkleidete.
Bis spät in die Nacht hinein saßen sie an dem schweren Tisch in der niedrigen Stube und wärmten sich an Tee und alten Geschichten, die von luftigen Geistern handelten, die es, allem Anschein nach, hier oben noch gab. Das kleine Volk, das vor Lärm und Abgasen geflohen war und noch immer seine Feste feierte, tanzend um eine achtlos weggeworfene Coladose. Aber man sah sie selten. Und überhaupt: Wer sollte das alles glauben?
Das Feuer war heruntergebrannt und die Alte verstummt. Reglos saß sie am Tisch, den schweren Kopf in die Arme gelegt, als Guido sich zurückzog. Im Einschlafen noch hörte er das Prasseln des Regens, das Gurgeln, Ächzen und Stöhnen des Gebälks wie in einem Schiff bei schwerer See.
Der nächste Morgen war grau. Wie Sand in einem Stundenglas perlte noch das Wasser vom Dach herab. Guido streckte sich und setzte dann seinen Weg fort. So rasch es eben möglich war, ohne unhöflich zu sein. Bald schon wurde die Straße eng, ein holpriger Feldweg mit tiefen, wassergefüllten Löchern, ein Eselspfad nur noch. Immerhin riss die Wolkendecke jetzt auf, blieb in Fetzten an den zur Pose erstarrten Bergkämmen hängen.
Schließlich musste Guido umkehren. Noch einmal vorbei an dem Gasthaus, bis ihm erneut der Weg versperrt war. Das Unwetter der vergangenen Nacht hatte den Grund aufgeweicht, bis er sich als Mure über die Straße gewälzt hatte. Der Modeschöpfer war gefangen wie eine Ratte in der Falle. Mehrmals fuhr er zwischen Schlammmassen und Fußpfad hin und her, dachte an Rettung mit dem Hubschrauber. Doch sein Handy hatte keinen Empfang.
Gegen Mittag hielt er zum zweiten Mal vor dem Gasthaus. Das Essen stand schon dampfend auf dem Tisch. Er kaufte Ansichtskarten und, umschwirrt von Schmetterlingen und Mücken, schrieb er Grüße an die Freunde. Als es dunkel wurde, saßen sie wieder am Schanktisch. Morgen sollte die Modemesse eröffnet werden und er lauschte den Geschichten von kühlen Frauen, die in dunklen Weihern und Tümpeln hockten, dort auf Männer warteten, um sie in ihr kaltes Reich zu locken.
Die Nacht war stürmisch. Der Wind ließ die Fenster klirren und zerrte an dem Haus, als wolle er einen alten Baum entwurzeln.
Auch am folgenden Tag sollte das Gebirge Guido di Monaco, wie er sich seit nunmehr dreizehn Jahren nannte, noch nicht freigeben. Heute weigerte sich sein Sportwagen anzuspringen. Guido fluchte. Und als das nichts half, machte er sich zu Fuß auf den Weg.
Die Landschaft zeigte sich prachtvoll: die Wiesen lagen wie ausgespannte, hellgrüne Seide zwischen den Höhen. Als dünne, milchweiße Bänder schlängelten sich Bäche hindurch, glucksten in den Gumpen wie Glocken. Dort, wo der Berg abgerutscht war, traf Guido auf Männer, die die Straße frei räumten. Einer von ihnen war der Mechaniker im Dorf. Er kratzte sich das wie aus Stein gehauene Gesicht und versprach, später vorbeizukommen. Auf dem Weg zurück zur Hütte ruinierte sich Guido dann vollends die teuren Schuhe. Die Berge standen hoch aufgereckt vor ihm und in schattigen Mulden lagen schmutzige Eisfelder, die auch im Sommer nicht ganz abschmolzen: Cocktailsauce auf ein anthrazitgraues Abendkleid gekleckert. Zu dieser Stunde sollte in Mailand eröffnet werden.
Was für eine Seltenheit, bewunderte am Abend der Mechaniker den Sportwagen. Guido lächelte über die Ahnungslosigkeit des Bergbewohners, der das neueste Sportcoupé mit einem Oldtimer verwechselte. Was dem Wagen fehlte, konnte der Mechaniker trotzdem rasch feststellen: Es war kein Benzin mehr im Tank. Morgen früh würde er zurück sein und welches bringen. Und so verbrachte Guido di Monaco einen weiteren Abend mit der Frau. Diesmal erzählte sie ihm eine Geschichte vom Riesen, der nachts mit Felsen um sich warf, solange, bis die Morgensonne ihn wieder zu Stein erstarren ließ.
Trotz allem war der Modemacher zufrieden wie selten, als er spät nachts in einen traumlosen Schlaf fiel. Nur einmal kurz schreckte ihn ein Kreischen wie von reißendem Stoff auf. Doch der Morgen war hell und klar. Die Berge lagen vor ihm wie eine dralle Frau im Sommerkleid. Guido hatte ein Faible für dralle Frauen, weil er in seinem Beruf eher mit flachbrüstigen, mageren Models zu tun hatte. Auf den Wiesen stand geil emporgeschossen das Knabenkraut. Die Teufelskralle krümmte ihre Blüten wie blaue Kunstfaser und in den feuchten Lagen wiegte sich das Greisenhaar im Wind. Namen vieler anderer Blumen hatte Guido längst vergessen.
Dann kam endlich der Mann mit dem Benzin und nach einem herzlichen Abschied, flitzte das Coupé fröhlich die Berge hinab. Im Spiegel sah der Modedesigner lange das Gebirgsmassiv abtauchen und in der Silhouette der Gipfel glaubte er fast, das Profil der alten Frau zu erkennen.
Die gesuchte Passstraße konnte er auch heute nicht finden und so fuhr er schließlich in einem Tunnel unter den Bergen hindurch, bis dieser ihn in eine helle Landschaft ausspuckte. Das Handy blieb immer noch stumm und als di Monaco am Nachmittag Mailand erreichte, war da keine Spur von der Modemesse. Auch im Hotel gab es keine Reservierung für ihn. Bald musste er feststellen, dass seit seiner Abreise dreißig Jahre vergangen waren. Doch letztendlich war auch das nicht weiter schlimm. Denn in der Modebranche konnte man auch einen dreißig Jahre alten Stil getrost als den neuesten Schrei verkaufen und das Gerücht von ewiger Jugend war dabei durchaus verkaufsfördernd.
Das Talent des Malers
Der Maler Johann Baptist Zimmerli lebte in einer blassen, undeutlichen Landschaft, einer Landschaft, in der man auch bei schönem Wetter immer das Gefühl hat, ein feiner Nebel läge vor den Dingen. Schon als Kind, in einem kleinen Dorf unweit der österreichischen Grenze, war Johann durch seine außerordentliche Begabung zum Zeichnen aufgefallen – was seine Eltern mit Stolz und heimlicher Furcht erfüllte. Mit dem Bleistift war er bereits in jungen Jahren so geschickt, dass er Gegenstände jeglicher Art und sogar Fotos mit größter Präzision abzeichnen konnte. Da Johann Baptist bei seinem Eintritt in die Schule fehlerfrei schrieb, hielt ihn die Lehrerin für intelligent. Allerdings nur so lange, bis sie bemerkte, dass er zwar die Worte schreiben konnte, von ihrer Bedeutung aber keine Ahnung hatte. Buchstaben malte er wie kleine Bilder. Das Lesen lernte er leidlich und mit dem Rechnen hatte er bis ins Alter hinein große Schwierigkeiten.
Als im Hause der Eltern eines Tages anstand, ein altes, hölzernes Buffet zu entfernen, dessen Oberfläche stumpf und unansehnlich geworden war, machte die Mutter eine seltsame Entdeckung: Auf der Wand, hinter dem Buffet, die – so sollte man jedenfalls annehmen – über Jahre hindurch von dem Möbel verdeckt gewesen war, befand sich eine exakte Zeichnung von eben diesem Buffet. Mit allen Einzelheiten, dem Porzellan und den Gläsern; ja, sogar ein Spinnennetz, das schon längst wieder verschwunden war, konnte man erkennen. Niemand gelang es, herauszufinden, wie es der schmächtige Johann, um dessen Werk es sich zweifellos handelte, geschafft hatte, das schwere Buffet von der Stelle zu rücken. Kurz darauf merkten die Eltern, dass sich Zeichnungen des Jungen hinter jedem Schrank in der Wohnung, hinter jedem Bild an der Wand, auch hinter den Betten befanden. Und sie wunderten sich.
Zu seinem achten Geburtstag schenkte ein Onkel Johann Baptist die ersten Buntstifte und einen Kasten mit wasservermalbaren Farben. Mit einem Bild – so wünschte es die Mutter – sollte der Junge sich beim Onkel für das Geschenk bedanken. Also setzte sich der Onkel eines Vormittags in aller Bequemlichkeit auf die kleine Bank vor dem Hause in die Sonne und der Junge fing an zu malen. Er hielt sich gar nicht erst mit irgendwelchen Vorzeichnungen auf, sondern trug gleich mit sicherem, leichtem Strich die Farbe aufs Papier. Doch bereits nach wenigen Minuten, als das Gesicht des Onkels gerade in seinen charakteristischen Zügen hervorzutreten begann, wurde der Onkel von heftigen Kopfschmerzen heimgesucht, sodass die Sitzung abgebrochen wurde und das Bild, zum Bedauern Johanns, unvollendet blieb.
Es dauerte nur ein paar Monate, bis der Junge sämtliche Gegenstände der ihm bekannten Welt und auch einige Tiere zu Papier gebracht hatte. Im ganzen Haus gab es kein Ding mehr, zu dem nicht auch die entsprechende Zeichnung existierte. Und manchmal machte Johann Baptist Zeichnungen von Zeichnungen.
Schnell hatte sich das Talent des Jungen herumgesprochen und nicht selten kamen Fremde an die Tür, um für ein paar Groschen Blätter zu erwerben oder das Wunderkind beim Malen zu beobachten. Johann nahm es gelassen und beinahe teilnahmslos hin.
Eines Tages, er war inzwischen dreizehn Jahre alt, machte Johann Baptist eine Entdeckung, die für ihn wie die Bestätigung einer lang gehegten Ahnung war. Aus Mangel an neuen Motiven hatte er damit begonnen, eine einzelne Tasse aus dem Küchenschrank wieder und immer wieder zu malen. Es war eine schlichte, schlanke Kaffeetasse aus weißem Porzellan, deren Rand etwas angeschlagen war und auf deren Grund ein brauner Kaffeerand sich nicht mehr entfernen ließ. Johann malte und zeichnete diese Tasse aus jeder nur denkbaren Perspektive. Er probierte den Lichteinfall von allen Seiten und zu jeder Stunde des Tages – so wie es einst der Maler Monet mit der Kathedrale von Rouen gemacht hatte. Nachdem er etwa fünfzig Zeichnungen fertiggestellt hatte, bemerkte Johann, dass sich etwas verändert hatte. Nach hundert Bildern konnte jeder sehen, dass die Tasse an Substanz verloren hatte. Es war, als ob der Maler mit seinem Blick dem Objekte etwas weggenommen hatte. Aber erst nachdem er sie rund fünfhundertfach gemalt hatte, war die Tasse verschwunden. Sie war gänzlich auf das Papier übergegangen. Johann Baptist Zimmerli war nicht erstaunt darüber. Seine Entdeckung behielt er für sich, denn es war nicht Zweck der Malerei, die Dinge verschwinden zu lassen. Trotzdem machte er, im Verborgenen, weitere Versuche mit dieser Technik. Schon bald brauchte er nicht mehr als hundert Zeichnungen von einem Gegenstand anzufertigen, um ihn derart mit den Augen abzunutzen, dass er verschwand. Manchmal ließ er Dinge verschwinden, die er nicht mochte, wie den grauen Hut, den die Mutter eine Zeit lang getragen hatte.
Sobald die Dinge verschwunden waren, gewannen seine Bilder eine besondere Bedeutung, denn sie konservierten die Erinnerung. Und manchmal wurde Johann Baptist natürlich verdächtigt, etwas, das er gemalt hatte, verloren zu haben. Der Vater vermutete zum Beispiel, der Sohn habe die Teekanne, die er so oft gezeichnet hatte, fallen gelassen und aus Angst vor der Entdeckung die Scherben beseitigt.
Als junger Mann wurde Johann Baptist Zimmerli ein beliebter Maler in der Schweiz. Vermögende Leute drängten sich darum, von ihm portraitiert zu werden. Und weil das fertige Werk immer etwas glanzvoller, strahlender und lebendiger aussah als die Portraitierten, deren Gesichter nach der Sitzung immer etwas blass und matt wirkten, war man mit seiner Arbeit äußerst zufrieden. Junge, ihm vollkommen unbekannte Frauen suchten ihn in seinem Atelier in der Stadt auf, um ihm nackt Modell zu stehen. Auf diese Weise entstanden sinnliche Bilder, die so vollkommen waren, dass sie, trotz ihrer ans Obszöne grenzenden Inhalte, stets respektvoll bewundert wurden. Seltsam bewegten sie ihre Betrachter. Die Kunstkritik allerdings schenkte seinen Werken wenig Beachtung.
Johann Baptist Zimmerli fuhr fort, Dinge so lange zu malen, bis sie verschwanden. Über drei Jahre hinweg beschäftigte er sich mit dem Matterhorn. Doch ein Gegenstand von solcher Größe und Komplexität nutzte sich durch Betrachtung nur sehr wenig ab. Sicher hatte sich der Berg in dieser Zeit verändert. Doch es war dem Maler lediglich gelungen, eine dünne äußere Schicht abzutragen, so wie den Staub von einer Vase.
Es folgte eine Zeit, in der sich der Maler Zimmerli für den Frieden engagierte. Er nahm teil an Demonstrationen und machte Zeichnungen von militärischen Einrichtungen, von Panzern und Raketenstützpunkten. Diese Bilder, wie auch die späteren Serien »Zivilisationsmüll« und »Ten most wanted«, brachten ihm endlich auch die Anerkennung der Kunstszene. In seinem eigentlichen Sinne, so wie er es sich gewünscht hatte, waren sie aber keine Erfolge.
Einmal machte er sogar den Versuch, seine Entdeckung über den Zusammenhang von Anblick und Stofflichkeit, über das Verschwinden der Dinge durch Betrachtung und Wiedergabe, an junge Maler weiterzugeben. Er hielt eine Vorlesung an der Akademie, aber die, die ihn hörten, hielten ihn für verrückt und man fing an, Witze über ihn zu machen.
Schließlich zog sich Johann Baptist Zimmerli in dieses abgelegene Gebirgstal zurück, wo er – unbeachtet von der Welt – weitermalte. Sein letztes und möglicherweise auch sein bedeutendstes Werk ist ein lebensgroßes Selbstbildnis. Übrigens das einzige, das er je gemalt hat.
Heinz
»Ah, der Student.« Frau Zachels sah ein wenig aus, wie die strenge Erzherzogin in den alten Sissi-Filmen, und so, wie sie das »Ah, der Student« aussprach, machte es den Eindruck, dass sie nicht viel auf Studenten gebe. Sie hob die Augenbrauen und betrachtete den jungen Mann, der vor ihr stand, kritisch. Heinz fühlte sich nicht besonders wohl. Das Zimmer, das über einen Aushang in der Mensa angeboten wurde, lag viel zu weit von der Uni entfernt und die Vermieterin schien alles andere als freundlich. Während sie ihn in das Zimmer führte, das im oberen Stock des kleinen Hauses lag, erklärte sie ihm die »Hausordnung«. Schuhe waren im Eingangsbereich auszuziehen, Damenbesuch nach 21 Uhr war nicht erwünscht, die Bettwäsche wurde jeweils am Freitag gewechselt und der Mietvertrag, wenn er denn überhaupt zustande käme, wäre zunächst auf die Dauer eines Studiensemesters befristet.
Mehr als ein halbes Jahr würde er es hier ohnehin nicht aushalten, dachte sich Heinz. Aber da das Zimmer möbliert und die Aussichten auf dem Wohnungsmarkt in der Stadt nicht günstig waren, schien es dann doch keine so schlechte Option zu sein. Seine anfängliche Befangenheit wich, als er mit Frau Zachels in ihrem Wohnzimmer Tee trank. Die Einrichtung erinnerte ihn an die seiner Großeltern, wobei das »Fremdenzimmer«, das er zu mieten gedachte, allerdings eine Ausnahme war und wohl eher mit alten Möbeln vom Sperrmüll ausgestattet war. Frau Zachels gab Heinz ein paar Informationen zur Nachbarschaft und Tipps, wo er seine Brötchen einzukaufen hatte. Ob er Sport betreibe, wollte sie noch wissen, und als er antwortete, »Bergsteigen«, war sie zufrieden. Berge gab es hier nicht und sie könne den Geruch verschwitzter Sportler in ihrem Hause nicht ertragen. Sein Studium, das in ein paar Wochen beginnen sollte, interessierte sie nicht besonders und nach einer halben Stunde unterzeichneten sie einen Mietvertrag, den Frau Zachels offensichtlich selbst verfasst und auf einer alten, mechanischen Schreibmaschine getippt hatte.
Das Studium konnte beginnen. Heinz war entgegen seiner Erwartungen ganz zufrieden in der neuen Bleibe. Die morgendliche Fahrt mit der Regionalbahn machte ihm wenig aus. Im Gegenteil, dabei konnte er sich sammeln und ein bisschen lesen. Mit einer eleganten Ledertasche, die er sich für seine Studienunterlagen besorgt hatte, war er jeden Morgen unterwegs.
Das Studentenleben gefiel ihm. Seminare wählte er danach aus, zu welcher Uhrzeit sie stattfanden. Lagen sie früh am Morgen, dann kamen sie für ihn nicht infrage, denn Heinz hatte keine Lust, zusammen mit den Pendlern in überfüllten Zügen zu sitzen.
Zum ersten Mal im Leben war er sein eigener Herr. Er fühlte sich glücklich, denn er konnte tun und lassen, was er wollte. Und auch seine Vermieterin war nicht unzufrieden mit ihrem Untermieter, der sich ruhig und höflich verhielt. Wenn sie auf der Straße einer Nachbarin begegnete, unterließ sie es niemals, darauf hinzuweisen, dass sie an einen Studenten vermietet hatte, und schwärmte von den Vorzügen der höheren Bildung.
Es dauerte nicht lang, bis Heinz andere Studenten kennenlernte, und er schloss oberflächliche Freundschaften mit ihnen. Manchmal trafen sie sich, um gemeinsam zu lernen und manchmal gingen sie zusammen ein Bier trinken. Natürlich waren auch einige Studentinnen darunter. Ab und zu ging er mit einer von ihnen aus. Da seine finanziellen Mittel begrenzt waren, suchte er sich einen Job in einer Bar, was ihm weitere Freundschaften aus der Studentenschaft eintrug. So verging das erste Studienjahr.
Die Verlängerung des Mietvertrags mit Frau Zachels war reine Formsache und nur einmal gab es einen Vorfall. Heinz hatte eine Kommilitonin eingeladen, mit ihm gemeinsam auf seiner Bude zu lernen. Natürlich hatten sie auch ein bisschen »rumgemacht«, aber es war nichts Ernstes, wie seine Mutter gesagt hätte. Nur hatten sie dabei leider die Zeit vergessen und so hatte Steffi aus Saarbrücken den letzten Zug zurück in die Stadt verpasst. Früh am nächsten Morgen verließ sie lautlos das Haus, aber Frau Zachels wusste natürlich genau Bescheid über alles, was da geschehen war. Kurz gesagt, Heinz stand »so knapp« davor, rausgeschmissen zu werden. Deshalb war er die nächsten Wochen über sehr bemüht, Frau Zachels alles recht zu machen. Er bot ihr sogar an, im Garten zu helfen, was Frau Zachels lachend ablehnte. Später ergab sich aber doch eine Gelegenheit, ein Loch für einen neuen Stock mit Kletterrosen auszuheben.
Die Semesterferien kamen und da Heinz noch eine Arbeit über das Motiv der Biene in der Frühmittelalterlichen Literatur zu schreiben hatte, blieb er in seinem Studentenzimmer und genoss die Ruhe in der Provinz. Manchmal ging er Wandern, bummelte durch die Fußgängerzone und setzte sich in eines der regelmäßigen Kurkonzerte.
Bei einer dieser Gelegenheiten lernte er den Redakteur vom lokalen Tageblatt kennen, der ihm von einem akuten Personalengpass erzählte. Kurz: Heinz bekam Gelegenheit, sein Talent unter Beweis zu stellen. Er sollte die Aufführung einer örtlichen Theatergruppe besuchen und anschließend einen Bericht darüber verfassen. Das machte er nicht schlecht und ehe er sich versah, war er ein offizieller Mitarbeiter der lokalen Presse. Im Schreibwarenladen an der Uferpromenade kaufte er sich einen eleganten Kugelschreiber und ein praktisches Klemmbrett, auf dem er von nun an seine Notizen festhielt.
War das ein Leben! Am Abend besuchte er Veranstaltungen, führte Interviews und ließ sich auf Vernissagen örtlicher Künstler blicken. Und am nächsten Morgen tippte er einen Bericht darüber in den Laptop. Den Rest des Tages nahm er sich frei, flanierte am Fluss entlang oder ließ sich in den Straßencafés die Sonne ins Gesicht scheinen.
Als das nächste Studiensemester begann, wählte Heinz nur noch Vorlesungen und Seminare, die am frühen Nachmittag abgehalten wurden. Aber auch die besuchte er nur unregelmäßig. Statt eine akademische Karriere anzustreben, wollte Heinz nun Journalist werden. Und da er das ja eigentlich längst war, war er von der Notwendigkeit eines geregelten Studiums nicht mehr überzeugt. Frau Zachels war erfüllt von Stolz auf ihren Untermieter, der mit der Zeit zu einer geschätzten Persönlichkeit im Ort wurde. Manchmal lud sie ihn ein, ihr bei Kaffee und Kuchen Gesellschaft zu leisten. Sie war begierig danach, die neuesten Nachrichten von ihm zu erfahren und mit ihm über das örtliche Kulturleben zu diskutieren. Heinz erhielt sogar das Privileg, sich in seiner freien Zeit im Garten aufzuhalten. Und Heinz hatte viel freie Zeit. Er war zufrieden, wenn er, mit einem Glas Limonade in der Hand, auf der kleinen Gartenbank saß und den Blick über den blühenden Rhododendronbusch schweifen ließ. Er konnte sich kein besseres Leben vorstellen. »Was ist Glück?«, fragte er sich. »Ein Leben frei von inneren Unruhen und äußerer Bedrängnis führen zu können«, war seine Antwort.