- -
- 100%
- +
»Morgen?«, wiederholte er, als ob es ihm immer noch völlig unsinnig vorkam, dass ich wirklich vorhatte, morgen wiederzukommen.
»Ja, morgen«, bestätigte ich und machte einen leichten Knicks. »Guten Abend.«
»Guten Abend, Miss Crumb«, wünschte er auch mir, die Verwirrung auf die Stirn geschrieben, und ich ging mit einem Lächeln. Denn diesmal hatte ich gewonnen.
Zu Hause angekommen, hatte ich eine ganz bestimmte Vorstellung davon gehabt, wie ich meinen Abend verbringen würde. Und zwar in meinem Sessel mit einem Buch.
Mein Kopf sehnte sich nach Zerstreuung, meine Seele nach einer guten Geschichte und mein Körper nach den ausgeleierten Sitzfedern meines Sessels, den Tante Lillian sogar im Salon duldete.
Doch meine Tante hatte bereits andere Pläne gemacht. Sie servierte mir einen späten Tee und etwas Gebäck, nur um mir dann ganz schwärmerisch von einer kleinen Soiree zu erzählen, zu der sie heute früh ganz kurzfristig eingeladen worden war, weil sie eine alte Freundin in der Stadt getroffen hatte. »Sie wusste nicht einmal, dass ich hier wohne. Ist das zu fassen? So lange hatten wir uns schon nicht mehr gesehen«, erzählte sie mit einem Lachen in der Stimme und einem glückseligen Blick. »Du wirst doch mitkommen, Ani, oder?«, meinte sie dann plötzlich und ich verschluckte mich beinahe an meinem Tee. Ein Husten unterdrückend, räusperte ich mich, um meine Überraschung zu überspielen.
»Ich denke nicht, dass es für mich nach diesem langen Tag ratsam ist, noch unter Leute zu gehen.«
»Papperlapapp«, machte meine Tante mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Das wird eine ganz kleine Veranstaltung. Nur ein wenig Essen, herumsitzen und Klaviermusik lauschen«, versuchte sie mich zu locken und sah mich dabei flehend an. »Bitte, Ani. Alfred hat sich noch einen Tag entschuldigen lassen, weil seine Geschäfte länger dauern, und ich will da auf keinen Fall allein aufschlagen«, bettelte sie und ich seufzte im Stillen.
Meiner Mutter hätte ich diesen Gefallen wahrscheinlich nicht getan. Aber bei Tante Lillian wurde ich schnell weich. Erstens, weil sie den flehenden Blick ausgezeichnet beherrschte, zweitens, weil ich mich ihr gegenüber schuldig fühlte, da ich in ihrem Haus wohnen durfte, und drittens, weil ich Klaviermusik wirklich sehr liebte.
Mein eigenes Spiel war mittelmäßig bis dürftig, wahrscheinlich, weil ich mehr über Klaviere gelesen hatte, als sie zu spielen, aber es gab für mich nichts Angenehmeres, als einem guten Stück zu lauschen, während ich in der Welt eines Buches versank.
Vielleicht hatte meine Tante ja auch recht und der Kreis an Leuten wäre so klein, dass man gemeinsam am Kamin saß, sich ein wenig austauschte, einen afternoon tea trank, während eine der Damen ihre Künste an den Tasten mit uns teilte. Und ich konnte dabei ein bisschen lesen. Was machte es schon, ob ich hier oder dort las.
»Na gut«, gab ich mich also geschlagen und das Gesicht meiner Tante hellte sich augenblicklich auf.
»Danke, Ani!«, rief sie freudestrahlend, während sie sich von ihrem Stuhl erhob, und grinste dann schelmisch. »Ich habe dir sogar schon ein Kleid rausgelegt«, teilte sie mir mit und eilte dann aus dem Zimmer.
Zwei Stunden später konnte ich kaum glauben, wie ich mich nur so hatte austricksen lassen können. Der große Raum war voller Leute, viel mehr als eine kleine oder auch nur eine mittlere Abendgesellschaft. Bei uns auf dem Land kam eine so große Anzahl Menschen nur zu einem Ball zusammen.
Aber wahrscheinlich war das mal wieder ein Unterschied zwischen hier und dort. Hier galt dies als ›kleine Abendgesellschaft‹ und ich wünschte mich weit, weit weg.
Gemeinsam hatten wir den Raum betreten, dessen Fülle an lauten Gesprächen mich beinahe erschlagen hatte, und nicht einmal fünf Minuten später stellte Tante Lillian mir auch schon ihre liebe, alte Freundin Mrs Glenwood vor, mit der sie dann nach zwei, drei gewechselten Sätzen in der Menge verschwand.
Und so stand ich nun hier, allein, zwischen einer Unzahl fremder Menschen und nahm mir ein Glas Sodawasser, damit ich etwas hatte, woran ich mich festhalten konnte.
Ich schlängelte mich mit dem hellgrünen Ungetüm, das ich trug, zwischen den herumstehenden Menschen hindurch und suchte mir einen ruhigen Platz am Kamin, wo mir der Sessel, den ich in Aussicht gehabt hatte, in just diesem Moment von einer älteren Dame mit grauer Hochsteckfrisur und violettem Seidenkleid weggeschnappt wurde.
Es war zum Schreien und meine Nerven waren die Tage nicht gerade in so guter Verfassung, als dass ich es mir nicht auch hätte gönnen können, diesen Abend zu meiner eigenen Verfügung zu haben.
Wo war die Übeltäterin eigentlich, die mir dies zumutete? Aber ich konnte Tante Lillian nirgends entdecken. Beleidigt schnaubend nahm ich mir ein Sandwich von einem Teller, der unweit von mir auf einem Tisch stand.
Zum Glück hatte meine Tante mich nicht so eng geschnürt, wie Mary-Ann es immer tat, und ich würde wenigstens ein paar davon essen können, ehe mir der Platz ausging.
»Oh, wo haben Sie denn den Sekt her?«, sprach mich plötzlich eine flötende Stimme von der Seite an.
Überrascht drehte ich den Kopf und sah in das schwammige Gesicht eines leicht untersetzten Mannes, der zu meinem Erschrecken kaum älter sein konnte als fünfundzwanzig. Das dunkelblonde Haar ging jedoch bereits zurück und entblößte höchst unvorteilhaft seine hohe Stirn, die ihn wie einen Eierkopf aussehen ließ. Unvermittelt musste ich an Alice’ Abenteuer im Wunderland denken.
»Es ist Sodawasser«, korrigierte ich ihn, lächelte höflich und hätte mich nur zu gern in Luft aufgelöst.
»Sodawasser?!«, entgegnete der Mann schockiert und riss seine kleinen Augen auf. Dann neigte er seinen Kopf verschwörerisch zu meinem, was mir mehr als unangenehm war, da ich nicht einmal genug Platz hatte, um ihm auszuweichen, ohne dass die Rüsche meines Rockes in Gefahr stand, am Kamin Feuer zu fangen. »Ich hörte letztens doch tatsächlich, dass Soda eine Säure sein soll«, sagte er mit solcher Empörung, als wäre es eine Zumutung, Menschen so etwas Schreckliches überhaupt anzubieten.
Innerlich verdrehte ich die Augen. Dieser Mann, der sich mir bislang nicht einmal vorgestellt hatte, schien sich wohl für außerordentlich intelligent zu halten, machte auf mich jedoch eher den Eindruck, ungelehrt und theatralisch veranlagt zu sein.
»Es ist eine alkalische Lösung«, verbesserte ich ihn daher und hörte sofort die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf, wie sie mich anwies, nicht immer jeden zu belehren.
Der Mann sah mich an, als wären mir plötzlich Fühler auf dem Kopf gewachsen. Er hatte mich nicht verstanden.
»Eine Lauge«, klärte ich ihn daher auf und schob ihn behutsam und wie zufällig ein Stück von mir weg, damit zwischen uns wieder ein Abstand geschaffen wurde, der mir Luft zum Atmen ließ. Denn leider zählte zu der unglaublichen Anzahl hervorstechender Eigenschaften meines ungebetenen Gesprächspartners, die mir unwillkommen waren, auch, zu unsensibel zu sein, um zu merken, wenn er eine Dame bedrängte.
Er jedoch nickte mit einem falschen Lächeln, das mir wohl symbolisieren sollte, dass er genau wusste, wovon ich sprach, obwohl er dumm wie ein Stück Holz war. »Wollen Sie nicht lieber dieses gefährliche Zeug wegstellen und ich hole Ihnen einen Punsch? Zufällig kenne ich die Herrin des Hauses persönlich und ihr Punsch ist wirklich außerordentlich vorzüglich«, sagte er so stolz, als hätte er den Punsch mit seinen eigenen Händen zusammengerührt. Ich klammerte mich nur fester an mein Glas.
»Das ist überaus nett«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Aber nein danke. Ich habe nicht das Privileg, morgen lange ausschlafen zu können.«
»Ach, nein?«, rief der Herr überrascht und ich hätte mich gerne selbst geohrfeigt, weil ich ihm doch tatsächlich Stoff für Unterhaltung bot, wo ich ihn doch so dringend loswerden wollte. »Was hat eine junge, hübsche Dame wie Sie denn am frühen Morgen zu tun?«, wollte er natürlich sofort wissen und ich entschied, die Taktik zu ändern.
Mit unterschwelliger Ablehnung wurde ich ihn nicht los, da er zu geistlos war, diese zu bemerken. Also würde ich es mit schonungsloser Ehrlichkeit versuchen.
Bei Mr Reed klappte das schließlich auch. Man musste sich nur seinen Verschleiß von vierundzwanzig Assistenten in vier Monaten ansehen.
»Ich arbeite.« Jetzt war es raus. Ich war eine Frau, die arbeitete!
Die Augen des Mannes weiteten sich sichtlich verblüfft. »Das … oh. Aber Miss …«, stammelte er und es schien ihm keine Erwiderung einzufallen.
Ich hoffte darauf, ihn so sehr in Verlegenheit gebracht zu haben, dass er sich verabschieden und weiterziehen würde. Aber ich hatte die Hartnäckigkeit der Männer unterschätzt, die nicht mit gottgegebener Schönheit und Eleganz gesegnet waren. Er holte tief Luft, fing sich wieder und setzte ein kleines schweinsgleiches Lächeln auf. »Wie unhöflich von mir. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist …«, begann er mit gefasster Stimme und ich wünschte mir sehnlichst, gerettet zu werden. Natürlich war ich eine selbstständige junge Frau, mit Witz und guter, manchmal messerscharfer Rhetorik, aber gegen Dreistigkeit war ich immer noch machtlos.
Mr Reed hatte mich anfangs damit überrumpelt und auch der Herr vor mir zerrte so sehr an meinen Nerven, dass mir vor lauter schwirrenden Gedanken nichts einfallen wollte, um ihn auf die Schnelle loszuwerden.
»Nicht von Belang, da ich diese junge Dame jetzt entführen werde.« Der Mann mit dem Eierkopf wurde jäh unterbrochen, ehe er sich vorstellen konnte, und ein schlanker Arm schob sich unter meinem durch.
»Oh«, machte der Herr überrascht und ich war es nicht minder, als ich den Kopf zu meinem Retter hob.
Es war eine Frau, unwesentlich älter als ich. Ihr Haar war dunkelbraun, ihre Haut blass und sie überragte mich etwa um einen halben Kopf, obwohl ich schon zu den größeren Damen zählte. Auffällig war ihre spindeldürre Figur, das Gesicht oval, die Nase spitz wie bei einer Maus. Ihre Augen sahen belustigt zu dem Herrn, den sie gerade vor den Kopf gestoßen hatte, und ein freches Lächeln lag auf ihren schmalen Lippen.
Sie zog mich rasch mit sich, sodass mein Sodawasser beinahe überschwappte, und der Herr kam uns noch zwei Schritte hinterher.
»Darf ich die Damen begleiten«, redete er gegen den Lärmpegel des Raumes an und die junge Frau an meiner Seite schwang wie betrunken den Kopf herum.
»Großer Gott, nein!«, rief sie schockiert und verdrehte belustigt die Augen in meine Richtung, während wir davonstolzierten.
Ich wehrte mich nicht und sie brachte mich in einen angrenzenden Raum, in dem sich weniger Leute aufhielten, weil ein Fenster geöffnet worden war und die winterliche Luft hereinströmte.
»Viel besser, findest du nicht auch?« Ihre eisblauen Augen trafen mich wie ein Eimer kaltes Wasser.
Sie ergatterte für uns zwei dunkelrot gepolsterte Stühle. Erleichtert setzte ich mich und streckte meine Füße unauffällig aus, was man wegen des Reifrocks sowieso nicht sehen konnte. Ich hatte heute wahrlich genug gestanden.
»Das war wirklich …«, begann ich einen Satz und wurde von der Frau neben mir unterbrochen, die mich mit verschmitztem Grinsen musterte.
»Unglaublich? Fantastisch? Atemberaubend?«, gab sie mir eine Reihe an Adjektiven vor und ihre Selbstsicherheit brachte mich zum Lachen.
»Scheußlich, wollte ich eigentlich sagen«, stellte ich klar und die junge Frau lächelte mich so zuckersüß an, als ob ich ihr ein Kompliment gemacht hätte.
»Ooooh«, machte sie. »Gern geschehen.«
Und ich musste wieder lachen. Obwohl sie unhöflich, unanständig und fies war, gab es da doch etwas hinter der boshaften Fassade, was mich ansprach und sie liebenswert machte.
Meine Mutter würde sie hassen. Und das gab mir noch mehr Anlass, diese Dame zu mögen.
»Elisa Hemmilton. Stets zu Diensten, wenn eine Jungfrau in Not von einem fetten, glatzköpfigen Junggesellen umworben wird«, eröffnete sie mir und ich hielt mir erschrocken den Mund zu, als ob ich es selbst gesagt hätte.
»Schau nicht so schockiert, Herzchen. Sie alle denken es. Ich bin nur die Einzige, die es ausspricht«, warf sie mir vor und ich nickte. Denn auch meine Gedanken waren zweifelsohne in diese Richtung gegangen.
»Animant Crumb«, stellte ich mich also vor, um nicht darauf eingehen zu müssen, und Elisa Hemmilton griff freudig nach der Hand, die kein Glas hielt, um sie zu schütteln. Mein Sandwich musste ich bei unserer Flucht irgendwo verloren haben.
»Was für ein außergewöhnlicher Name. Ich bin begeistert«, gestand sie mir und trieb mir damit doch wirklich die Röte ins Gesicht. Sie ließ meine Hand wieder los und strich sich sehr unelegant eine Haarsträhne hinters Ohr. »Ich muss gestehen, ich habe dich nicht ganz uneigennützig vor Mr Schweinegesicht gerettet«, erzählte sie mir und ich blinzelte überrascht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was sie wohl von mir wollte. »Ich stand nahe bei dir, als du sagtest, dass du arbeiten würdest. Und das war mit Abstand das Interessanteste, was jemand an diesem Abend, bei diesem Haufen lackaffiger reicher Schnösel hätte sagen können«, endete sie und ich musste aufpassen, dass ich jetzt nicht wegen ihrer derben Ausdrucksweise errötete.
»Danke«, kam es aus meinem Mund, und es klang gefasster, als ich mich fühlte.
»Arbeitest du, um dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen?«, fragte Elisa Hemmilton mich aus und ich hob skeptisch die Augenbrauen.
»Nein«, gestand ich ihr und obwohl ich erwartete, dass sie enttäuscht sein würde, schien das Leuchten ihrer eisblauen Augen nur stärker zu werden.
»Dein Vater besitzt also Vermögen.« Es war eine Feststellung, keine Frage. Und in mir wurde die Vermutung laut, dass es sich bei Elisa nicht so verhielt. Ihr Vater hatte wahrscheinlich kein Vermögen. Fragte sich jetzt nur, wie sie es dann geschafft hatte, auf diese Soiree eingeladen worden zu sein.
»Und welchen Grund hast du dann, um zu arbeiten?«, wollte sie wissen und ich spürte, dass dies der Drehpunkt in dieser Unterhaltung war, das Geheimnis, das sich Elisa Hemmilton vorgenommen hatte zu lüften.
»Damit meine Mutter mich nicht verheiratet«, sagte ich, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben, und Elisas Augen wurden beinahe doppelt so groß, bevor sie schallend zu lachen begann.
Einige Gentlemen und drei Ladys sahen sich pikiert nach uns um und ich war nur froh, dass mich hier niemand kannte.
»Ich hab es gewusst. Wir sind uns ähnlich«, meinte Elisa und strich sich mit spitzen Fingern eine Lachträne aus dem Augenwinkel.
»Du arbeitest auch?«, erkundigte ich mich und benutzte ebenso wie sie eine vertrautere Art der Ansprache, die sie mir zwar nicht angeboten hatte, aber selbstverständlich zu nehmen schien.
»Nein«, antwortete sie und grinste. »Ich studiere.«
Das überraschte mich sehr. Ich war noch keiner studierenden Frau begegnet, aber wahrscheinlich musste sie genau so selbstbewusst sein, wie Elisa es war.
Die Universität für Frauen war erst wenige Jahre alt und kämpfte immer noch um die vollständige staatliche Anerkennung. Ihre Mittel waren begrenzt, die Studienfächer von dürftiger Anzahl und allein der Ruf, der einer studierenden Frau anhaftete, hätte schon dafür gereicht, um mich abzuschrecken.
»Das ist jetzt wirklich unglaublich«, entfuhr es mir und ich empfand Bewunderung für sie und ihren Mut.
»Nicht wirklich«, winkte Elisa ab und tat so, als sei es nichts Besonderes. Doch das winzige Lächeln in ihren Mundwinkeln verriet sie. »Die Universität ist klein und wenn ich einmal fertig bin, ist nicht einmal sicher, ob ich einen echten Abschluss bekomme.«
»Warum tust du es dann?«, war es nun an mir zu fragen und Elisa lachte heiter.
»Aus dem gleichen Grund wie du. Um nicht die Frau des Fischhändlersohns zu werden«, gab sie zurück und ich fühlte mich in meiner Vermutung bestätigt, dass ihre Eltern wohl kein großes Vermögen hatten. Meine Mutter würde mich nie mit einem Fischhändlersohn verheiraten. Zumindest nicht, solange sie die Wahl hatte oder ich ihn ihr nicht als Liebe meines Lebens vorstellte.
Ich lächelte und Elisa war redefreudig genug, mir mehr zu erzählen, ohne dass ich so impertinent sein musste, zu fragen.
»Ich habe das große Glück, eine Gönnerin zu haben, die mir das Studium finanziell ermöglicht«, erzählte sie und ich nickte. »Doch leider besteht sie darauf, dass ich sie auf diese spießigen Veranstaltungen begleite. Ich tu es, aber ich hasse es. Vor allem diesen Schmuck.« Sie zupfte leicht an dem kleinen Hut, den man ihr an der Hochsteckfrisur befestigt hatte, und schnippte gegen die langen, bunt gefärbten Federn. »Was soll das darstellen? Bin ich ein Papagei?«, fragte sie gespielt schockiert und wir fingen beide gleichzeitig zu lachen an, weil es einfach absurd klang.
»Ich weiß es nicht. Ich weigere mich, so etwas zu tragen. Wenn meine Tante mich nicht überredet hätte, wäre ich gar nicht hier«, erzählte ich freimütiger, als ich es von mir gewohnt war, aber Elisa schien es nichts auszumachen.
Sie grinste und beugte sich interessiert zu mir vor. »Und was würdest du jetzt tun, wenn du die Wahl hättest?«, wollte sie wissen und ich brauchte nicht lange zu überlegen.
»Ich würde in meinem Sessel sitzen und lesen«, sagte ich.
»So eine bist du also: eine Stubenhockerin«, gab sie zurück und obwohl es direkt war, empfand ich es nicht als Beleidigung.
»Und was würdest du machen?«, wollte ich daher wissen und sie legte sich den Zeigefinger auf die Lippen, um kurz darüber nachzudenken.
»Hm. Wahrscheinlich würde ich in einem Pub sitzen und mir von meinen Cousins erzählen lassen, wie undamenhaft ich doch bin und ich so niemals einen Ehemann bekomme«, erzählte sie.
»So eine bist du also: eine Saufnase«, kommentierte ich mit einem versteckten Lächeln und Elisa kicherte.
»Touché«, gab sie zu und machte ein albernes Gesicht. »Ich glaube, ich hab’ mich spontan in dich verliebt, Animant«, sagte sie mit einem charmanten Augenaufschlag, den sie selbst nicht wirklich ernst nahm, und plötzlich war ich froh, nicht allein zu Hause geblieben zu sein.
Das Siebte oder das, in dem ich in die Welt der Maschine eintauchte.
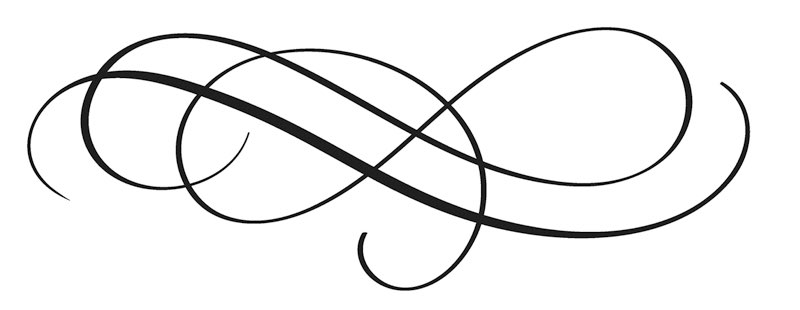
Als ich an diesem Morgen vor der Bibliothek stand, wunderte sich Mr Reed nicht mehr darüber. Und wenn doch, verbarg er es zumindest besser als am Morgen zuvor. Er grüßte undeutlich, sah mir nicht ins Gesicht und schien auch so sehr schlecht gelaunt zu sein.
Aber das war mir heute gleichgültig, da ich nicht besonders viel geschlafen hatte und schon seit dem Aufwachen von leichten Kopfschmerzen geplagt wurde. Ich konnte es in diesem Moment nicht gebrauchen, von Mr Reed irgendeinen Kommentar darüber zu hören.
Still folgte ich ihm die Treppen auf den Rundgang hinauf und sah ihn ohne ein weiteres Wort in seinem Büro verschwinden, dessen Tür er mit mehr Nachdruck schloss, als nötig gewesen wäre.
Ich legte meinen Mantel in dem kleinen Räumchen nebenan ab, fragte mich, was wohl vorgefallen war und ob es etwas mit dem Gentleman von gestern zu tun haben konnte. War er womöglich deshalb immer noch so verstimmt?
Ich begann mit den Zeitungen im Foyer, holte sie aus den Verspannungen, immer die Angst vor dem finsteren Archiv in der Magengrube. Doch diesmal wusste ich ja, was mich dort unten erwartete. Es würde also viel schneller gehen. Hoffte ich zumindest.
Der Junge mit der Zeitung war nicht mehr so verschreckt wie gestern, hielt aber Abstand und blieb übertrieben höflich. Ich gab ihm zwei Schilling und er verriet mir, dass sein Name Phillip Tams war.
Kurz spielte ich mit dem Gedanken, ihm noch mehr Geld zu geben, damit er für mich ins Archiv runterging. Doch das wäre ein zu großes Eingeständnis meiner Schwäche gewesen und so ließ ich Phillip wieder ziehen, machte meine Arbeit und stellte mich meinen Ängsten.
Jedenfalls redete ich mir das ein, denn meine Furcht vor diesem schummrigen Ort mit dem immerwährenden Luftzug, der nach meinem Nacken griff und mich immer wieder vor jedem Schatten zusammenzucken ließ, wurde nicht weniger.
Wieder rannte ich die Treppen nach oben und blieb mit klopfendem Herzen zwischen den Bücherregalen im Seitentrakt der Bibliothek stehen, an dessen Wand sich der Abgang zum Archiv befand.
Einunddreißig Tage in einem Monat, weniger zwei Tage, die bereits vergangen waren, weniger die vier Sonntage, die ich nicht arbeiten musste, ergab fünfundzwanzig mal hinunter ins grausige Archiv, rechnete ich im Kopf und bekam eine unangenehme Gänsehaut. Noch fünfundzwanzigmal musste ich in dort runter, und das kam mir im Moment wie eine viel zu große Anzahl vor.
Ich war froh, Cody zu begegnen, als ich zurück in den Lesesaal kam. Besser, als sich nach dem Schreck völlig allein in den großen Räumen aufzuhalten. Er sah mich erst verängstigt an, zog sich dann aber eilig die Mütze vom Kopf und verbeugte sich leicht zum Gruß. Immer noch, ohne ein Wort gesprochen zu haben.
Eigentlich hatte ich ihn noch nie sprechen hören.
»Guten Morgen, Cody«, erwiderte ich seine Verbeugung verbal und half ihm anschließend, die Bücher, die im Lesesaal auf den Tischen liegen geblieben waren, zusammenzusammeln und thematisch zu ordnen, damit er sie anschließend wegräumen konnte.
Ich verzog mich in meine Kammer, als die ersten Studenten ins Foyer getingelt kamen und mich mit großen Augen wie eine Zirkusattraktion beglotzten.
»Sie ist die neue Bibliothekarsassistentin«, hörte ich jemanden zu seinem Kollegen flüstern, strich mir flüchtig die Bluse zurecht und suchte das Weite.
Es gab noch einen ganzen Stapel neuer Bücher ohne Etiketten, die darauf warteten, dass ich mich ihrer annahm.
Gegen halb zehn klopfte es an meiner Tür, was mich überraschte. Es hatte mich noch niemand in der Kammer aufgesucht.
»Herein«, rief ich gepresst, während ich mich gegen den Hebel des Gerätes stemmte, das die metallenen Etiketten auf die Buchrücken nietete.
»Miss Crumb«, sprach mich Mr Reed an und ich erkannte ihn nur an der Stimme, weil ich gerade keine Möglichkeit hatte, hinzusehen.
Drei schnelle Schritte erklangen dumpf auf dem getäfelten Boden und dann griff ein Arm über meine Schulter hinweg. Eine kräftige Hand umschloss den Hebel, drückte mit und das Gerät schnappte ein.
Ich hatte kaum etwas tun müssen. Mr Reed hatte den Mechanismus, für den ich mein ganzes Körpergewicht einsetzen musste, mit nur einem Arm betätigt.
Den Atem anhaltend, ließ ich sofort den Griff los und drehte erschrocken den Kopf zu dem Mann, der dicht an meinem Rücken stand. Seine Augen waren ebenholzbraun.
Erst als er meinen verschreckten Gesichtsausdruck sah, schien Mr Reed bewusst zu werden, wie heikel die Situation war, die er geschaffen hatte, und er trat augenblicklich von mir zurück.
»Entschuldigen Sie, Miss Crumb«, sagte er schnell, als fühlte er sich gezwungen, es zu sagen, und fing sich dann wieder. Er holte kurz Luft. »Kommen Sie, der Mechaniker ist da«, teilte er mir mit, wandte sich um und war schon fast wieder aus der Tür raus, noch bevor ich reagieren konnte.
In mir sträubte sich alles bei seinen Worten und doch überwand ich mich selbst und folgte ihm. Wieso musste er mich so herumkommandieren, als hätte ich keinen eigenen Willen? ›Hätten Sie die Güte, mich zu begleiten?‹‚›Würde es Ihnen passen, Ihre Arbeit für einen Moment ruhen zu lassen und mir zu folgen?‹ Wie schwer konnte es denn sein, so etwas zu sagen? War es ihm so unmöglich, höflich zu sein?
Mein Herz schlug schon wieder viel zu schnell. Von dem vorherigen Schreck und vor Wut. Dieser Bibliothekar schaffte es immer wieder, mich mit nur einem Satz so zu verärgern, dass ich ihm am liebsten mit einem Schürhaken eins überziehen wollte. Und ich war für gewöhnlich kein gewalttätiger Mensch.
Ich folgte Mr Reed zurück in den Lesesaal und die Treppe nach oben auf den Rundgang und war sogar zu erbost, um zu fragen, wofür eine Bibliothek einen Mechaniker benötigte und warum ich ihn treffen sollte.
Natürlich wäre ich selbst darauf gekommen, wenn ich mir bewusst gemacht hätte, dass Mr Reed am Anfang erwähnt hatte, dass es sich bei der Suchmaschine um eine wirkliche Maschine handelte. Aber meine Gedanken waren zu sehr damit beschäftigt, dem Bibliothekar wüste Beschimpfungen an den Kopf zu werfen, als dass ich eine klare Schlussfolgerung hätte ziehen können.


