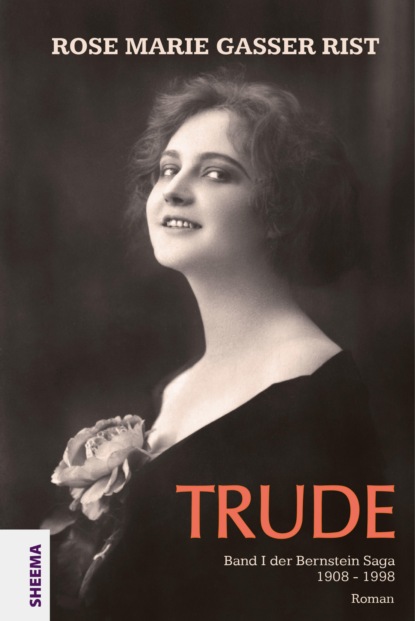- -
- 100%
- +
Valentin setzte sich erleichtert. Trude fiel erst jetzt auf, dass er völlig durchgefroren war. Offensichtlich hatte er lange in der Kälte auf sie gewartet. Die junge Frau goss ihm heißen Getreidekaffee ein und hielt ihm ein Stück Brot hin. Valentin tunkte das Brot und schlürfte das Getränk behutsam. Das Schmatzen füllte den Raum. Seltsamerweise entspannten Trude die Laute, sie empfand Zärtlichkeit für diese einfache, menschliche Geste. In dem Moment wusste sie, dass sie Valentin vergeben würde. Ihre Liebe für ihn war stärker als die Demütigung, als die vielen Fragen, als alle Wut und Bitterkeit.
„Danke, Trude!“, durchbrach Valentin das Schweigen. Er sprach, während Trude ihm ohne Unterbrechung zuhörte. Sie erfuhr, dass Valentins Vater ihn gezwungen hatte, den Kontakt zu seiner Verlobten sofort abzubrechen, wenn er die Unterstützung seiner Eltern nicht verlieren wollte. In ihren Augen entsprach Trude nicht dem Bild einer standesgemäßen Ehefrau. Sie setzten ihm das Messer an den Hals. Hätte er sich für Trude entschieden, hätte er sein ganzes Erbe, das Studium und die beruflichen Perspektiven verloren. In wenigen Augenblicken musste er in der verrauchten Stube in Berlin über sein und auch Trudes Schicksal befinden.
Valentin hatte beschlossen, ein allerletztes Mal seinem Vater zu gehorchen. Die Argumente lagen auf der Hand: Ohne finanzielle Unterstützung hätte er sein Studium nicht beenden können. Ohne Ausbildung hätte er den gewünschten Beruf nicht ausüben und ohne Mittel hätten er und Trude nicht die Welt bereisen können. Wissend, dass er fürs Handwerk nicht geschaffen war, sah er nur in seinem eingeschlagenen Berufsweg eine lukrative Zukunft. Für ihn – wie auch für seine zukünftige Frau. Er wog ab und nahm das Risiko, Trude zu verlieren, in Kauf. Als er sich von Trude verabschiedete, wusste er seinen Vater hinter der Gardine zuschauen. Zu diesem Zeitpunkt war er noch überzeugt gewesen, heimliche Weg zu Trude zu finden, um die Situation zu klären. Doch die Einhaltung von Vaters rigoroser Forderung wurde mit Argusaugen überwacht. Der Patriarch hatte seine Kanäle und Hintermänner. In den ersten Wochen nach Berlin hatte Valentin Briefe zu schreiben begonnen, hatte versucht, seine Situation in Worte zu fassen. Doch was hätte er ihr versprechen können? Valentin durfte Trude nicht wiedersehen und musste sein Studium in Leningrad weiterführen. Er hatte alle unvollendeten Briefe zerknüllt und resigniert ins Kaminfeuer geworfen. Valentins Vater beschlagnahmte seine Violine und verbat seinem Sohn zu musizieren. Dieses weibische Gehabe brächte ihn nur in schlechte Gesellschaft, befand die Autorität.
Valentins Vater war ein politischer Wendehals. Er hatte ein Gespür, zur richtigen Zeit die richtigen Verbindungen zu knüpfen. Nach dem Zerfall des Deutschen Kaiserreiches hatte er schnell herausgefunden, welche Geschäftspartner ihm dienlich waren, um bei der gesellschaftlichen Elite vorne mit dabei zu sein. Er war in engem Kontakt mit den Männern an den Schalthebeln der Macht. Es war die Zeit der Weimarer Republik und der Weltwirtschaftskrise. Während die dekadente Oberschicht Tanzpartys veranstaltete, trieben Hungersnöte und Arbeitslosigkeit die Menschen auf die Straße.
Valentins berufliche wie auch private Laufbahn war von Vaters langer Hand geplant und eingefädelt. Der Sohn war eine strategische Figur in seinem Gefüge. Der Patriarch war sich seiner Durchschnittlichkeit bewusst. Er anerkannte, dass Valentin ihn längst menschlich und geistig überflügelt hatte. So war der Sohn der Trumpf im Ärmel. Valentin war Vaters Stolz und ein Versprechen für seine Machtgelüste. Mit Scharfsinn durchschaute der Sohn die Pläne seines Vaters. Solange er wirtschaftlich abhängig war, spielte der Student mit. Er ließ sich auf Veranstaltungen präsentieren und loben. Valentin wusste, wann es galt, wem die Hand zu schütteln. Er lernte, den Damen der Gesellschaft wirkungsvoll Komplimente zu machen. Sein Vater plusterte sich im Hintergrund wie ein Pfau auf und war hochzufrieden mit der Entwicklung seiner Pläne.
Nach dem Studium nahm er eine Stelle als Ingenieur in einer russischen Marinewerft an. Der Moment der Unabhängigkeit war gekommen. Sein eigenes Einkommen erlaubte Valentin, sich abzuseilen. In Leningrad baute er sich jenseits der Einflüsse seines Vaters ein eigenes Beziehungsnetz auf. Die Abkehr beleidigte seine Eltern. Valentin war zum Feind übergelaufen. Für die russische Armee zu arbeiten, war noch schlimmer, als eine Frau zu heiraten, die unter ihrem Stand war. Valentin wurde nicht nur enterbt, sondern auch als Hochverräter verstoßen. Alle Brücken zur Heimatstadt Berlin waren eingestürzt. Dies wurde Valentins Freiheit.
Er war schon seit Tagen um den Hof geschlichen und hatte Trude in ihrem Tagwerk beobachtet. Valentin hatte mit sich gerungen, ob er das Risiko einer Abfuhr auf sich nehmen wollte, hatte geprüft, ob er sich selber sicher war, wollte herausfinden, ob Trude noch frei war, und hatte auf den richtigen Moment gewartet. Das gesicherte Einkommen, eine leise Hoffnung, dass Trude ihn immer noch liebte und sie in der Lage wäre, seinen Bruch irgendwann zu verstehen, gaben ihm Mut, sich seiner Verlobten zu stellen.
Als Valentin seine Schilderung abgeschlossen hatte, glitt er vom Stuhl und kniete sich vor Trude hin. Er fasste nach ihren Händen und sprach: „Trude, du bist die Frau, die ich liebe und begehre. Ich bitte dich um Verzeihung, dass ich dich verletzt habe. Doch ich hoffe, du kannst jetzt verstehen, dass es mir nicht anders möglich war. Ich möchte dich hier und jetzt noch einmal um deine Hand bitten! Wenn du mich nicht willst, werde ich für immer verschwinden.“
Trude hatte ihm die ganze Zeit schweigend zugehört. Sie konnte weder einen klaren Gedanken fassen, noch etwas sagen. Der Gefühlssturm nahm sie völlig in Beschlag und schnürte ihr die Kehle zu. Trude begehrte Valentin, sie war wütend auf ihn und zugleich fühlte sie sich zutiefst verletzt. Mitten im Sturm ruhte jedoch wie ein ruhiger See eine sanfte Instanz, die Valentin bereits verziehen hatte, ihn einfach liebte, nie aufgehört hatte, ihn zu lieben. Trude räumte sich einen Tag Bedenkzeit ein, um in Ruhe alle Gedanken und Gefühle ordnen zu können.
„Auf diesen Tag kommt es nun auch nicht mehr an“, sagte Trude mit belegter Stimme.
Sie verbrachte, von Olga beurlaubt, den Tag in Tartu am Fluss unter ihrer Weide. Stundenlang warf sie Kiesel in den Strom. Mit jedem Wurf wurden Trudes Gedanken klarer. Die lange zurückgehaltenen Tränen konnten sich endlich einen Weg bahnen und frei fließen. Trude seufzte tief und pausenlos, entließ alle Anspannung aus ihrem Körper. Bis es ruhig wurde in ihrer Mitte.
Am Abend erbat sich Valentin ein Nachtquartier. Olga bot ihm ein Lager im Stall an. Mitten in der Nacht schlich sich Trude an den schlafenden Frauen vorbei aus dem Haus. Sie legte sich zu Valentin ins Stroh, rückte eng an seinen Körper. Erst ruhten sie lange Zeit wortlos innig aneinandergeschmiegt. Als hielten sie sich fest, um sich nie mehr loszulassen. In der Morgendämmerung liebten sie sich zum ersten Mal.
Zwischen einer Kuh und einem Ochsen.
-----------------
Bis zur Hochzeit im Juli verstrichen fünf Monate. In der Wartezeit nähte Trude die Aussteuer. Sie war nie sonderlich geschickt in Handarbeit. Doch die Aussicht, mit ihrem Liebsten einen Hausstand zu gründen, beflügelte sie zu Höchstleistungen. Mit Bettwäsche und Tischtüchern kamen auch Strampler für ein erstes Kind zur Aussteuer. Der Weidekorb war bis zum Sommer prall mit bestickten Leinen und Wolltüchern gefüllt. Die Metalllaschen am geflochtenen Deckel ließen sich nur mit Einsatz des ganzen Körpergewichts an den Beschlägen festmachen.
Am vierten Juli heirateten Trude und Valentin auf Olgas Anwesen. Es war ein heißer Sommertag. Blumengirlanden, weiße lange Tafeln und herausgeputzte Menschen schmückten die Feier. Am meisten strahlte jedoch das Brautpaar. Neu erblüht sprühte Trude neben ihrem feschen Bräutigam voller Lebensfreude. Und sie freute sich zu tanzen.
Die Kummerjahre waren vorbei, abgehakt wie eine hartnäckige Grippe, die endlich überwunden war und um die jedes Wort zu viel vergeudet wäre. Das Paar knüpfte dort an, wo es vier Jahre zuvor aufgehört hatte. Die Freude allerseits war groß. Valentin wurde herzlich zurückgenommen.
Alle waren sie gekommen: die Tanzfreunde, die Musiker, Trudes Vater, alle Brüder, die ältesten mit Ehefrauen und einer Schar Nachkommen. Auch Lena kam. Sie führte an jeder Hand ein Kleinkind. Ein Drittes zeichnete sich deutlich unter dem Kleid ab. In Lenas Gesicht lag ein Ausdruck von müder Schicksalsergebenheit. Jeronim, Lenas Gemahl, den Trude an ihrer Hochzeit zum ersten Mal sah, trat großkotzig auf. Er war ihr auf Anhieb unsympathisch. Trude bemitleidete Lena, die sich jetzt genau in den Lebensumständen wiederfand, vor denen sie sich immer gefürchtet hatten – als dauerschwangerer Schatten eines Gecken. Wie um alles in der Welt war ihre intelligente Freundin an den geraten?
Ein Schleier legte sich über Trudes Festlaune. Sie fragte sich: „Wo werde ich in zehn Jahren stehen? Begehe ich nicht soeben denselben Fehler, mich mit meinem Jawort von Valentin abhängig zu machen? Als Frau werde ich außerhalb von Olgas Territorium nie meine Autonomie bewahren können!“
Trude führte ihre Gedanken weiter und erkannte, dass sie dank den unwirtlichen Umständen, unter denen sie aufgewachsen war, einen starken Durchhaltewillen entwickelt hatte. Und in der Folge wurde sie alles andere als eine geschmeidige, gefügige Frau. Darin lag der wesentliche Unterschied zwischen ihr und ihrer einmal so nahen Freundin. Lena hatte zeitlebens nie üben können, eigene Willenskräfte zu entwickeln, immer hatten andere für sie entschieden. Von Geburt an war sie erzogen worden, attraktiv und manierlich zu sein, mit dem einzigen Ziel, eine anpassungsfähige Ehefrau zu werden. Abgesehen von den kleinen Fluchten zur Weide oder zu Livonia stand sie immer unter der Kontrolle von Eltern oder Bruder. Und nun hatte Jeronim das Zepter über ihr Leben übernommen. In Lenas Augen funkelten einst ein Glanz von Zuversicht und Jugendlichkeit. Doch jetzt war ihr mit der bitteren Alltagsrealität alle Hoffnung auf Selbstbestimmung genommen worden. Es gab zu Lena kein Durchkommen mehr. Ihre Augen waren matt und distanziert.
„Warum ist der Wert einer Frau auf die Gebärfähigkeit reduziert? Wofür all das geistige Potenzial, der Lebensantrieb, die körperliche Kraft? Mir widerstrebt es zu akzeptieren, dass eine Frau ihre einzige Existenzberechtigung darin hat, für die Gesellschaft Nachkommen zu produzieren oder keusch einem autoritären Gott zu dienen. Es muss doch möglich sein, sowohl Kindern das Leben zu schenken als auch die eigene Souveränität zu bewahren. Mein Körper möchte empfangen und gebären. Das spüre ich instinktiv. Ich glaube, es ist die Erfüllung eines angelegten Plans. Doch auch der Geist will sich erfüllen. Er hat den Drang, sich weiterzuentwickeln und zu erweitern. Und die Seele will fühlen, will genährt werden, will in den Austausch mit anderen erwachsenen Menschen.“
Auf ihrer Hochzeit führte Trude philosophische Selbstgespräche. Sie begann zu erfassen, dass das Menschsein ein spannendes Zusammenspiel von körperlichen, geistigen und seelischen Bausteinen ist, die nicht voneinander getrennt werden können. Sie verspürte die Sehnsucht nach Herausforderungen, die ihren geistigen Horizont erweiterten. Auch als Frau. Widerspenstigkeit regte sich in ihr und noch vor der Trauungszeremonie gab sie sich selber das Versprechen, das Leben mit Valentin an der Seite in allen Zügen zu genießen, aber nie ihre Würde, Eigenständigkeit von ihm abhängig machen zu lassen. Und nie mehr würde sie sich brechen lassen, wenn er noch einmal gehen sollte.
„Na, eigensinniges Weib, komm, es ist Zeit zum Heiraten, nicht zum Grübeln!“ Valentin holte seine Liebste mit einem neckischen Zwicken in die Seite aus dem Sinnieren und führte sie danach zum Trauungsplatz. Seine Worte ließen Trudes Zweifel an der Vermählung verpuffen. Valentin war ein Glückstreffer. Einen Besseren hätte sie nicht abbekommen können. Kein anderer hätte sie mit ihren unbequemen Fragen durchs Leben begleiten können.
Die feierliche Handlung war kurz und schlicht. Unter dem rauschenden Blätterdach der Ulme nahm ein Freund dem Paar das Eheversprechen ab. Sie gelobten sich, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein, bis dass der Tod sie scheide.
LENINGRAD
1929 – 1938
1929 Das tägliche Brot
Wenige Tage nach der Hochzeit brachen die Neuvermählten nach Leningrad auf. Olga, die Mädchen und Freunde begleiteten das Paar zum Bahnhof. Auch Lena. Es war ein feierlicher Moment. Und gleichzeitig war es ein wehmütiger Abschied von den Menschen, die Trude durch all die Jahre getragen und begleitet hatten. Sie sah ihre Lieben dem wegfahrenden Zug mit Taschentüchern nachwinken, bis eine Kurve den Blickkontakt abbrach. Ihre Wangen glänzten tränennass.
So schwer es ihr fiel, Olgas sicheren Hafen zu verlassen, so sehr freute sie sich auf die neue Zukunft. Es war ihr einerlei, wo sie diese gestalten würden. Hauptsache Valentin und sie waren zusammen. Die beiden verband vom ersten Augenblick an ein entspanntes Wohlbefinden in der Gegenwart des andern, das nur durch den Bruch in Berlin erschüttert worden war. Wie Valentin sich am Ende gegen alle Konventionen und Autoritäten für sie entschieden hatte, zeigte seine Entschlossenheit. Einen größeren Liebesbeweis gab es für Trude nicht.
Mit großem Behagen an der Seite ihres frisch angetrauten Mannes machte sie sich auf nach Leningrad. Das Paar richtete sich die lange Fahrt auf den harten Holzbänken so bequem wie möglich ein. Die meiste Zeit saßen die beiden schweigend, die eine Hand entspannt in der des anderen ruhend. Mit Blick auf die vorbeifliegende Landschaft ließen sie sich von der russischen Eisenbahn in die Zukunft fahren.
Leningrad war Trude bis zu diesem Zeitpunkt nur eine Idee auf der Landkarte und würde nun zu ihrem Lebensmittelpunkt werden. Valentin an seinen Arbeitsort zu folgen bedeutete eine trittsichere Ausgangsposition für alle zukünftigen Schritte.
Trude trat ihren neuen Lebensabschnitt selbstbewusst an. Ihre russischen Sprachkenntnisse würden ihr helfen, Kontakte zu knüpfen. Sie würde die Wohnung ausstatten, die Valentin im Vorfeld gefunden hatte. Irgendwann würde sie einem Kind das Leben schenken – und in den folgenden Jahren eine weiterführende Schule besuchen, studieren und Arbeit finden. Trudes Kopf war voller Pläne, ihr Herz voller Zuversicht.
Nach Tartu und Berlin war Leningrad erst ihre dritte Stadt. Da sie an Berlin keine guten Erinnerungen knüpfte, war Trude einfach zu begeistern. Es war eine prächtige Metropole. Mit den imposanten Palästen und goldenen Kuppeln hatte Leningrad für sie etwas Märchenhaftes. Die Lage am Meer verlieh ihr wie allen Hafenstädten Weltoffenheit. Trude erforschte die Stadt zu Fuß und mit Straßenbahn. Ein in schwarzes Leinen gebundenes Tagebuch, mittlerweile schon das fünfte, war ihr ständiger Begleiter. In ihm hielt sie alle Eindrücke in Worten und Skizzen fest.
Die ersten Monate verflogen wie im Flug. Sie nahm alle neuen Eindrücke durch eine rosarote Brille wahr. Im Rausch der Begeisterung übersah sie die unschönen Flecken der Stadt großzügig. Trude vermied es zu Beginn, genauer hinzusehen. Erst nach und nach schärfte sich ihr Blick und sie konnte die Arbeitslosen, die sich in den Gassen an offenen Feuern die Finger wärmten, und die schmutzigen Kinder, die barfuß und in Lumpen gekleidet für ihre Familien bettelten, nicht mehr ignorieren.
Trude und Valentin standen auf der Sonnenseite des Lebens und brauchten sich keine existenziellen Sorgen zu machen. In den Häfen wurden emsig Schiffe gebaut, um Weltmeere und Überseeländer zu zivilen und militärischen Zwecken zu erobern. Valentin war als Schiffsingenieur ein gefragter und gut bezahlter Mann.
Tagsüber war Valentin weg, verschluckt von einer Arbeitswelt, zu der Trude keinen Zugang hatte. Die Werft lag dreißig Minuten mit der Straßenbahn von der Zweizimmerwohnung entfernt. Am Abend berichtete er, dass er gerade an einem Eisbrecher arbeitete. Trude hörte zu, viel mehr als die technischen Details interessierte sie, mit wem er seine Mittagspause verbrachte, worüber er mit seinen Kollegen sprach, was kulturell in der Stadt passierte, welche politischen Ereignisse die Menschen umtrieben. Valentin war Trudes Informationsbrücke zur Welt.
Ihre selbst auferlegte Aufgabe war, sich ihr neues Territorium zu erobern. Wo und in welchen Entfernungen waren Brot und andere Lebensmittel zu beschaffen? Trude hätte selber backen können, doch sie erachtete es als wichtig, sich mit dem täglichen Gang zum Bäcker eine Dosis Menschenkontakt zu sichern. So wurde Einkaufen zur Forschungsreise. Aus drei Möglichkeiten, die in Fußdistanz lagen, wählte sie die Bäckerei Schmitz für das tägliche Brot. Der Schriftzug über der Markise verriet deutsche Herkunft. Fast eine Bürgschaft für gute Qualität. Trude erfuhr, dass Bäckermeister Schmitz mit seiner Familie im Zug der antideutschen Hatz bereits im Ersten Weltkrieg vertrieben worden war. Nur der Name blieb auf der Markise. Ob aus Kalkül – auch Trude ließ sich ja vom Versprechen auf deutsches Backgut ködern – oder Achtlosigkeit, erfuhr Trude nie.
Hinter „Schmitz“ verbarg sich ein netter russischer Familienbetrieb. Richtig hießen die Leute Dowski. Es waren Vadim und Svetlana mit ihren fünf Kindern. Trude konnte sie nicht auseinanderhalten und machte sich deshalb auch nicht die Mühe, sich deren Namen zu merken. Allesamt waren sie gemütliche Menschen mit rundlichem Körperbau. Die Gesichtsbacken waren weich wie Semmeln und verrieten, dass kein Mangel herrschte.
Die Dowskis hielten nicht viel von der Politik. Vadim und Svetlana hatten für alle und jeden immer ein nettes Wort. Wozu politisieren? Wer satt ist, braucht nicht missgünstig zu sein. Ein zufriedener Mensch hat keine Feindbilder und keinen narzisstischen Ehrgeiz, sich öffentlich zu profilieren. Wer bei Schmitz eintrat, streifte die Gesinnung an der Fußmatte ab. Der Verkaufsraum war eine kleine heile Welt. So war schon beim ersten Besuch besiegelt, dass sich Trude die Mühe ersparen konnte, eine andere Bäckerei zu suchen. Sie blieb Schmitz alle Jahre treu.
In Leningrad lernte Trude, aus der Brotauslage den Wohlstand der Bevölkerung zu lesen. In den ersten Jahren von 1929 bis 1930 war die Vitrine dürftig mit wenigen Brotlaiben bestückt, welche von der Kundschaft im Nu leer gekauft war. Wie alle Großstädter in Europa hatten auch die Leningrader unter der Wirtschaftskrise Ende der Zwanzigerjahre zu leiden. Später kamen neue Brotsorten hinzu und nach und nach füllte sich das Schaufenster mit bunter Konditoreikunst. Zuckerzeug demonstrierte protzig: „Es geht uns gut!“
Manchmal ließ sich Trude von den süßen Leckereien verlocken, doch meist wählte sie Brot für sich und Valentin. Am Anfang gab es nur das eine dunkle Roggenbrot. Als die Auswahl größer wurde, kosteten sie sich durch das Sortiment. Doch allmählich kristallisierte sich ihr tägliches Brot heraus.
An den Abenden und Wochenenden zu zweit arbeiteten sie sich zum anderen durch. Da sie bis dahin kaum geteilte Zeit verbracht hatten, wurden sie sich nicht überdrüssig, aus ihrer Vergangenheit zu erzählen. Abendfüllend waren die Geschichten der Kindheit, von Freundschaften und von Entbehrungen. Valentin brachte seinen Bücherfundus mit in die Ehe, aus dem sie sich gegenseitig vorlasen.
Neugierig erforschten sie auch ihre Körper. Fern aller Konvention waren sie frei, sich ohne Scham kennenzulernen. Sie kannten keinen gültigen Maßstab, wie man sich als Mann und Frau sittlich zu verhalten hatte. Für sie war es das Natürlichste der Welt, sich gegenseitig bei der Morgentoilette zuzuschauen. Es wurde ihr allabendliches Ritual, sich gegenseitig die Kleider abzustreifen, herumzualbern und sich wie Welpen zu balgen. Sie jagten sich durch die Wohnung bis ins kalte Schlafzimmer, um sich dort unter der klammen Decke aneinander zu wärmen. Manchmal hatte das Spiel eine Fortsetzung und manchmal schliefen sie einfach geborgen ineinander verschlungen ein.
Jeder Abend an Valentins Seite war für Trude ein Heimkommen. Über alle Jahre. Wie sehr auch die Welt draußen tobte und sich ihnen Widrigkeiten in den Weg stellten, die Kindersorgen ihnen über den Kopf wuchsen oder sie sich heftig zankten. Beim Hinübergleiten vom Alltag in den Schlaf, wenn die Körper einander wärmten, wenn sich Gedanken langsam verflüchtigten und sich die Emotionen zur Ruhe legten, kam Trude an, bei sich, bei Valentin, beim stillen Glück.
Mit ihrer Ehe verhielt es sich so wie mit dem Gang zum Bäcker. Unerfahren kostete sich das Paar langsam durch die Auslagen des anderen. Es gab üppige und karge Zeiten. Sie ließen sich vom Zuckerguss des anderen verführen. Manchmal betrieben sie Völlerei. Und mit der Zeit wurde offenbar, was im Zusammenleben taugte und was nicht. Allmählich erkoren sie sich wie von selbst die Lieblinge: die Lieblingsmahlzeiten, der Lieblingsplatz am Tisch, die Lieblingsseife, die Lieblingsredewendungen und die Lieblingsliebesstellung.
1930 Die Kinder
Im Juli 1930 wurde Juri geboren. Ein pflegeleichtes Kind. Die Schwangerschaft verlief beschwerdefrei. Die Eheleute verfolgten die Veränderungen von Trudes Körper wie ein spannendes Forschungsprojekt. Die werdende Mutter war Objekt und Beobachtende gleichzeitig.
Eine unzimperliche Hebamme begleitete die Gebärende durch die Niederkunft. Männer waren im Kreissaal nicht erwünscht und so war Trude ohne Valentin dem Ereignis ausgeliefert. Ludmilla, eine unerschütterliche Matrone, die schon Tausende wimmernde, klagende, schreiende Frauen durch das Entbinden gelotst hatte, ging überhaupt nicht auf Trudes Ängste und Befindlichkeiten ein. Auf ihre Erfahrung und Souveränität war Verlass. Sie begleitete Trude durch alle Phasen der Wehen und spornte sie an, bis der kleine Junge aus ihrer weit gedehnten Öffnung herausflutschte.
Ludmilla legte ihr das schmierige, rosa Bündel in die Arme. Trude griff nach den winzigen Fingerchen, strich über das flaumige Köpfchen und als Juri die verklebten Lider aufschlug und seiner Mutter mit tiefblauen Augen zublinzelte, begann Trude zu schluchzen. Noch wund von der Entbindung, glückselig über das kleine Wunder in ihren Armen, erinnerte sie sich an ihre Mutter. Die vollbrachte Leistung, einem Kind trotz bestialischer Schmerzen ins Leben verholfen zu haben, schenkte Trude große Selbstachtung. Sie war unbeschreiblich stolz auf sich.
Wie gerne hätte Trude ihren Sohn Marthe gezeigt. In den Stunden nach der Entbindung fehlte ihr die Mutter wie nie zuvor. Selber Mutter geworden, wurde sie ihr ebenbürtig. Auf einmal konnte Trude nachempfinden, was sieben Kinder Marthes Leib abverlangt hatten. Wie wenn ein Hebel umgekippt wurde, betrachtete Trude Mutters Tod mit einem Mal mit anderen Augen. Der Körper hatte schlicht keine Kraft mehr gehabt. Die Schwangerschaften, das Stillen, die schwere körperliche Haus- und Feldarbeit hatten ihren Zoll gefordert. Nicht Trude war schuld an ihrem Tod! Sondern die harten Lebensbedingungen und die Geringschätzung der Frau in dieser patriarchalen Gesellschaft! Plötzlich verflüchtigte sich der schwere Schatten.
Die frischgebackene Mutter hatte keine Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Säuglingen. Doch Juri machte ihr den Einstieg in die Mutterschaft sehr leicht. Er trank gut, gönnte ihr nachts erholsamen Schlaf und gedieh prächtig. Es war schön, mit diesem zufriedenen Kind die Tage zu verbringen. Trude dachte sich, wenn Muttersein so ein Spaziergang ist, wäre es ein Leichtes, nebenher ein Dolmetscherdiplom zu erwerben. Sie schmiedete an ihrem Zukunftsplan. Wenn Juri schlief und später, wenn er zur Schule gehen würde, wollte sie als Übersetzerin arbeiten. Trude war überzeugt, dass ihre Sprachfertigkeiten ihr den Einstieg in die Berufswelt ebnen würden.
Im Mai 1931, kurz nachdem sie sich bei der staatlichen Sprachakademie für den Lehrgang eingeschrieben hatte, stellte Trude fest, dass sie erneut schwanger war. Dieses Mal waren die Zeichen nicht die ausbleibenden Tage, sondern die Morgenübelkeit, von der sie bisher nur vom Hörensagen wusste. Trude konnte keinen Bissen halten. Bestimmte Gerüche, wie zum Beispiel Kaffee, wurden ihr unerträglich. Valentin musste sich eine geruchsneutrale Seife zulegen, sonst hätte ihn Trude nur auf Distanz ertragen können. Während dreier Monate war Trudes Radius sehr beschränkt. Sie pendelte zwischen Bett, Küche und Kinderzimmer hin und her mit einem Emailbecken als ständiger Begleiter.