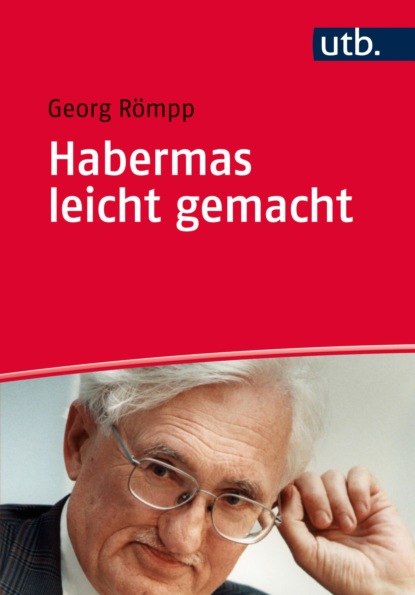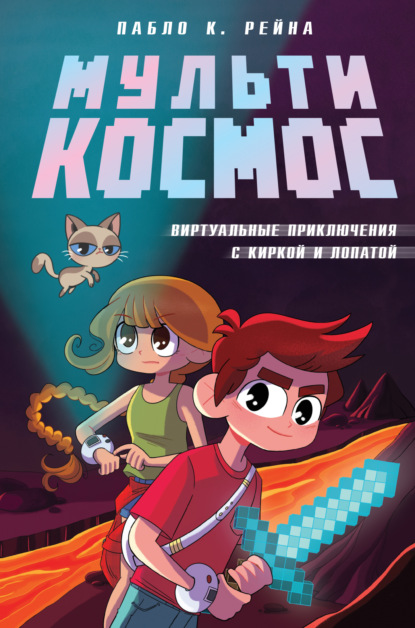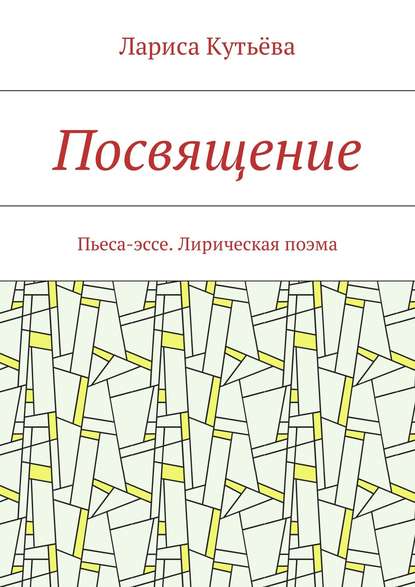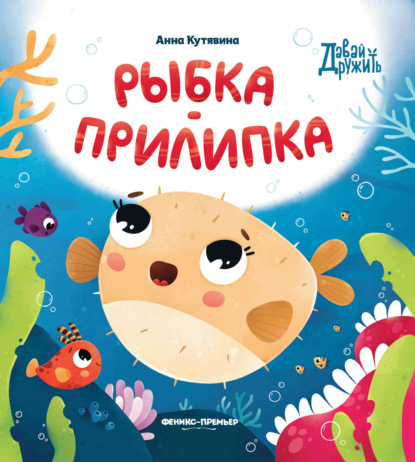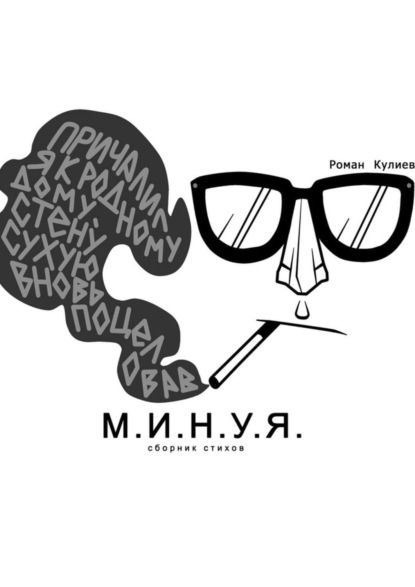- -
- 100%
- +
Aber zuvor müssen wir noch etwas tiefer in die spezifischen Gründe und vielleicht Abgründe des Denkens von Habermas vordringen. Das erreichen wir nur dadurch, dass wir uns im 4. Kapitel auf das Thema Handeln und Diskurs einlassen. Wir sind damit bei dem Thema, das jeder Philosoph irgendwann erreichen muss, nämlich bei der Frage nach der Wahrheit, und das gilt auch für einen Denker, der aus den Spezifika seiner Frage nach dem Handeln gleichursprünglich zum Philosophen wie zum Soziologen werden musste. Allerdings kann ein solcher Denker es nicht bei der Frage nach theoretischer Wahrheit (Erkenntniswahrheit) belassen, sondern muss aus Gründen seiner genuinen Fragestellung in das Problem der praktischen Wahrheit vordringen. Beide Probleme stehen bei Habermas unter dem Obertitel ‚Diskurs‘. Wir folgen diesem Weg im ersten und im zweiten Unterkapitel, ausgehend vom Zusammenhang zwischen Diskurs und Wahrheit (4.1), in die spezifisch Habermas’sche Konzeption einer Diskursethik (4.2).
Es könnte scheinen, als würde das dritte Unterkapitel (4.3) diesem Weg nicht geradewegs weiter folgen. Das ist insofern richtig, als wir es nun mit einer evolutionären Begründung des Zentrums des Habermas’schen Denkens zu tun haben, das wir bereits [<<14] in der Notwendigkeit von theoretischen und praktischen Begründungen im Diskurs behandelt haben. Aber auch ein solches Zentrum des Denkens ist nur ganz verstanden zusammen mit den Begründungen, die der Denker dafür anführt. Die Unterkapitel 3.2 und 3.3 aus dem Kapitel 3 hatten dafür schon wichtige Grundlagen gelegt. Für die Diskursethik finden sich bei Habermas aber noch einige evolutionäre Argumente, die nicht ganz in die zuvor dargelegten Begründungen zu passen scheinen. Deshalb beschäftigen wir uns erst im dritten Unterkapitel des 5. Kapitels damit.
Jedem an Politik interessierten Zeitgenossen ist bekannt, dass Habermas nicht nur ein Denker im Elfenbeinturm des reinen Erkennens ist, sondern sich intensiv in Fragen des gesellschaftlichen und vor allem des politisch geregelten Zusammenlebens eingemischt hat. Das trifft allerdings für viele Philosophen und Soziologen zu. Das Besondere an Habermas’ Politiktheorie und seinen Stellungnahmen zu aktuellen politischen Fragen ist jedoch, dass er sich dabei auf seine eigene Theorie des kommunikativen Handelns, auf seine Begründung des Geltens einer kommunikativen Rationalität und damit auf seine Wahrheits- und folglich Diskurstheorie stützen kann. Das soll im 5. Kapitel deutlich werden, wo wir Habermas’ Weg von der Gesellschaft in die Politik verfolgen werden – wir hätten auch sagen können: von den Grundlagen der Verständigung in eine wahrheitsorientierte Theorie der Demokratie.
Habermas’ Politiktheorie ist unter dem Titel einer ‚deliberativen‘ Demokratietheorie bekannt geworden. Bevor wir uns im dritten Unterkapitel (5.3) genauer damit befassen, werden wir jedoch in zwei einleitenden Kapiteln die Grundlagen dafür darlegen. Im ersten Unterkapitel (5.1) konfrontieren wir Habermas’ Konzeption des kommunikativen Handelns als Fundament einer Gesellschaftstheorie mit dem systemtheoretischen Ansatz, um zu verdeutlichen, in welcher Richtung die Konsequenzen seiner zentralen Gedankengänge für die Regelung des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu suchen sind. Im zweiten Unterkapitel (5.2) nehmen wir den schon aus Kapitel 3.4 bekannten Begriff der Lebenswelt wieder auf. Habermas hatte der Lebenswelt eine spezielle Rationalität zugeschrieben, die nicht verloren gehen dürfe, wenn wir nicht fundamentale Veränderungen in der Weise, wie wir leben, in Kauf nehmen wollen. Nun werten wir diesen Gedanken aus und skizzieren die Bedeutung einer funktionierenden Lebenswelt für ein Zusammenleben in Gesellschaft und Politik, das jenen Grundlagen entspricht, die sich aus der Charakterisierung des Menschen als eines in sprachlicher Verständigung mit anderen Menschen kooperierenden Wesens ergeben.
Damit ist die Basis für ein Verständnis dessen gelegt, was Habermas als Theorie einer deliberativen Demokratie ausgearbeitet hat. Diese Theorie führte ihn zur Wiederaufnahme eines sehr frühen Themas seiner eigenen Denkgeschichte: der Funktion der Öffentlichkeit für demokratische Politik. Nunmehr aber wird die Öffentlichkeit [<<15] herangezogen, um seine Politiktheorie zu konkretisieren und zu detaillieren, was wir im vierten Unterkapitel ausführen (5.4). Aber man sollte sich hier nicht täuschen lassen: Die Theorie der Öffentlichkeit ist auch eine Fortsetzung seiner zentralen Gedanken über kommunikatives Handeln, über die Bedingungen sprachlicher Verständigung, über Diskurse und damit über das, was als ‚wahr‘ bzw. ‚richtig‘ bezeichnet werden kann. Dieses weit in die philosophischen Grundlagen von Habermas’ Denken zurückreichende Konzept einer Rationalisierung der Politik wird oft zu wenig beachtet. Wir fassen Habermas’ Politiktheorie deshalb im fünften Unterkapitel besonders unter dieser Perspektive zusammen (5.5).
Es stellt ein eigenes Problem dar, wie man ein explizit als Einführung in das Denken einer bestimmten Person konzipiertes Buch beendet. Dieses Buch endet im 6. Kapitel mit einer Skizze von vier Perspektiven bzw. Fluchtlinien des Denkens von Jürgen Habermas. Zunächst liegt der Fokus auf dem eigentümlichen Anspruch dieses Denkens (6.1). Dann soll in einigen Zügen deutlich werden, was der viel zitierte Spruch von einem ‚Projekt der Moderne‘ wirklich mit Habermas’ Denken zu tun hat (6.2). Im nächsten Schritt kommen wir nochmals auf das einleitende Thema zurück, mit dem wir im 1. Kapitel das Buch begonnen hatten: auf das ‚Kritische‘ in Habermas’ ‚Kritischer Theorie‘ (6.3). Die letzte Perspektive gilt schließlich dem Anspruch, die in den Bedingungen sprachlicher Verständigung begründete Theorie des Diskurses berge in sich auch den Gedanken einer Einheit der Vernunft – wenn auch in der Vielfalt der Stimmen (6.4). [<<16]
1 ‚Kritische Theorie‘ – das Interesse an Erkenntnis
1.1 Der Zusammenhang von Interessen und Erkenntnis
Es geht in diesem Buch nicht um das Leben von Jürgen Habermas und auch nicht um seine intellektuelle Entwicklung. Alles dreht sich um das Denken, das gerade dieser Denker uns präsentiert und mit dem er sich von anderen Denkern unterscheidet. Es soll uns auch nicht interessieren, auf welche geistige Herkunft und auf welche Schulbildungen dieses Denken in seiner geschichtlichen Herkunft zurückgeführt werden kann. Deshalb wird darauf verzichtet, nun auf jene ‚Schule‘ einzugehen, die als ‚Kritische Theorie‘ bezeichnet wird und in der Regel mit Philosophen bzw. sozialwissenschaftlichen Theoretikern wie Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in Verbindung gebracht wird. Stattdessen will dieses Kapitel einen kurzen Vorgriff auf Habermas’ Denken unter der Perspektive geben, warum und wie bei ihm das Denken und die Theorie ‚kritisch‘ genannt werden können – bzw. in seinem eigenen Verständnis sollen. Falls dabei manches noch nicht ganz verständlich sein sollte, so wird es im weiteren Verlauf des ‚Leicht-Machens‘ von Habermas noch dazu kommen. Zunächst geht es nur um einen Vorgriff, der das Selbstverständnis dieses Denkens als ‚kritisch‘ plausibel machen soll.
Der Gedanke, dass wir im Erkennen keine ‚reine Schau‘ der Welt betreiben, zieht sich durch Habermas’ gesamtes Denken. Seinen ersten deutlichen Ausdruck fand er schon in der Frankfurter Antrittsvorlesung von 1965, die unter dem Titel ‚Erkenntnis und Interesse‘ 1968 in ‚Technik und Wissenschaft als ‚Ideologie‘‘ erschien und dann in das größere Werk ‚Erkenntnis und Interesse‘ aufgenommen wurde. Hier wird implizit der Anschluss an die erwähnte Schule der ‚Kritischen Theorie‘ sehr deutlich. Habermas orientiert sich dabei zunächst an einer bestimmten Interpretation des griechischen Begriffes der ‚theoria‘, der in sich ambivalent war: Einerseits konnte die neuere Wissenschaft an dessen Bedeutung einer ‚reinen Schau‘ der Welt anschließen, andererseits gelang dies jedoch nur, indem der praktische Bezug der griechisch verstandenen ‚theoria‘ ausgeschlossen wurde. Dort nämlich bezog sich der Begriff [<<19] der ‚theoria‘ auf einen „Bildungsvorgang“, aus dem das Leben seine „Form“ nehmen konnte und sollte (TW 147).1
Erst in der weiteren Entwicklung entstand der ‚Schein‘ einer von der Praxis gelösten und insofern tatsächlich ‚reinen‘ Theorie, wie wir sie heute noch kennen und als ‚Erkenntnis‘ von der Praxis unterscheiden, auch wenn die Letztere im Zuge der intensiven Technisierung heute immer mehr auf die Erstere zurückgreift – einerseits nimmt der Einsatz von Wissen in Lebensbereichen zu, die immer schon erkenntnisorientiert waren, andererseits werden heute wissenschaftliche Erkenntnisse auch auf Gebieten verwendet, auf denen früher traditionales und Erfahrungswissen aus der Praxis ausreichte. Gegen jenen Schein bringt Habermas nun drei verschiedene Erkenntnisinteressen zur Geltung, die er drei verschiedenen Wissenschaftsbereichen zuordnet:

Dass den empirischen Wissenschaften ein technisches Erkenntnisinteresse innewohnt, weil sie sich an technischer Verwertbarkeit und Verfügung über die Natur orientieren, ist ein Gedanke, der bereits bei Descartes deutlich war und schließlich bei Heidegger ausführlich ausgearbeitet wurde. Habermas’ eigenes Denken und seine Konzentration auf ‚kommunikatives Handeln‘ – also Handeln auf der Grundlage der Verständigung zwischen Menschen – wirft jedoch bereits einen deutlichen Schatten voraus, wenn er das Erkenntnisinteresse der historisch-hermeneutischen Wissenschaften als die „Erhaltung und … Erweiterung der Intersubjektivität möglicher handlungsorientierender Verständigung“ bestimmt, d. h., in ihnen geht es letztlich um den „möglichen Konsensus von Handelnden“ (TW 158).
Der Anschluss an die Tradition der ‚Kritischen Theorie‘ wird jedoch an dieser Stelle noch stärker durch die Bestimmung eines dritten Erkenntnisinteresses hergestellt, das eine dritte Gruppe von Wissenschaften prägt, die nicht in die übliche Einteilung in Natur- und Geisteswissenschaften passt, nämlich die ‚kritischen Sozialwissenschaften‘, [<<20] worunter vor allem Ideologiekritik, Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaften zu verstehen sind, aber auch die Philosophie im Habermas’schen Verständnis. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie theoretische Aussagen über Gesetzmäßigkeiten des sozialen Handelns so untersuchen, dass Veränderungsmöglichkeiten von Macht und Abhängigkeit im sozialen Zusammenhang deutlich werden können.
Erkenntnis und Interesse verhalten sich also zueinander auf eine komplexe Weise. Zunächst sind wissenschaftliche Erkenntnisse einerseits von partikularen Interessen frei bzw. sie verdanken sich geradezu einem Abstrahieren von solchen Interessen. Nichtsdestoweniger geht es in ihnen um die „fundamentalen Interessen“, denen die Wissenschaft gerade „die Bedingungen möglicher Objektivität“ verdankt (TW 160). Bei dem Ausdruck ‚Bedingungen möglicher Objektivität‘ wird jeder, der die Anfangsgründe des kantischen Denkens kennt, sofort an die ‚Transzendentale Analytik‘ der ‚Kritik der reinen Vernunft‘ denken. Dort war als zentraler Zusammenhang für die Begründung der Kategorien als gegenstandskonstituierender ‚reiner (d. h. nichtempirischer) Begriffe‘ der Gedanke eingeführt worden, dass die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung gleichzeitig die Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung sind. Unsere Erfahrung ist so strukturiert wie die Gegenstände, die in dieser Erfahrung zur Geltung kommen können, weshalb die Strukturen unserer Erfahrung als apriorische Erkenntnisse über alles gelten können, was unserer Erfahrung in der Form von Objekten zugänglich werden kann.
Für Kant war dies ein Gedanke, mit dem allein er die Möglichkeit apriorisch-synthetischer Erkenntnisse begründbar ansah, also einer solchen Erkenntnis, die nicht einfach auf der Analyse von Begriffen beruht, sondern die unsere Erkenntnisse erweitert und nicht nur näher auseinanderlegt, was wir sowieso schon wissen, die aber andererseits nicht selbst auf der Erfahrung beruht, welche selbst erst mithilfe solcher Strukturen möglich wird. Für Habermas erscheint diese ‚Transzendentalität‘ des erfahrenden Subjekts nun jedoch nicht als ein Gedanke, der sich daraus rechtfertigt, dass wir nur so sichere und gewisse Erkenntnisse gewinnen können. So etwas wie ein transzendentales Subjekt ist vielmehr selbst ein Ergebnis der Geschichte der Menschheit – man könnte auch sagen: der Geschichte ihrer Interessen, d. h., die „Leistungen“ dieses Subjekts für die Konstitution von Objekten und gleichzeitig für die Erfahrung haben selbst „ihre Basis in der Naturgeschichte der Menschengattung.“ (TW 161) Daraus wird schon deutlich, dass die Voraussetzungen und Bedingungen von Erkenntnis nicht unabhängig von den Interessen gedacht werden können, die diesen Prozess und diese Geschichte bestimmt haben.
Es muss aber gleich hinzugefügt werden, dass ‚Naturgeschichte‘ hier keineswegs heißt, dass unsere biologische Ausstattung sich im Prozess der Evolution so entwickelt [<<21] hat, dass sie nun zu solchen transzendentalen Erkenntnisleistungen fähig ist. Biologistisch sollte man Habermas’ These an dieser Stelle also nicht auffassen. Der „kulturelle[] Bruch mit Natur“ (TW 161) ist vielmehr für Habermas dann schon vollzogen, wenn die ‚Menschengattung‘ sich durch transzendentale Leistungen und damit über die Veränderung der Voraussetzungen und Bedingungen von möglicher Erkenntnis entwickelt.
Anders gesagt: Diese Leistungen entstehen auf der Grundlage der Vergesellschaftung der menschlichen Gattung, d. h., sie sind Produkte des Zusammenlebens von Menschen in Gesellschaften und damit in einer auf Kommunikation beruhenden Kooperation. An dieser Stelle können wir noch etwas weiter auf die Grundlinien der Habermas’schen Theorie des kommunikativen – also verständigungsorientierten – Handelns vorgreifen, denn damit ist bereits die Fortführung jenes Gedankens in eine ethische Dimension angelegt. Die Interessen, die in diesem Prozess der Vergesellschaftung und der Ausbildung der transzendentalen Leistungen des Subjekts beteiligt sind, sind – weil im Prozess kommunikativen Handelns entstehend – orientiert an dem, „was eine Gesellschaft als ihr gutes Leben intendiert“. (TW 162)
Wenn bei Habermas von Interessen die Rede ist, die unsere Erkenntnis bestimmen, dann geht es also nicht um die biologische Ausstattung des Menschen. Das hat schon damit zu tun, dass Interessen sprachlich artikuliert sein müssen, wenn sie in Erkenntnisprozesse leitend eingehen können sollen. Die sprachliche Artikulation aber geschieht in den Formen, in denen Menschen sich vergesellschaften, also in einem „Medium“, das Habermas durch „Arbeit, Sprache und Herrschaft“ charakterisiert (TW 163). Arbeit geschieht auf soziokulturellem Entwicklungsniveau als ein kooperativer Prozess und ist deshalb verständigungsorientiert.
Grundsätzlich gilt dies aber auch für Herrschaft im Unterschied zu Macht bzw. Gewalt. Herrschaft ist regulierte Macht, d. h., sie ist abhängig von Regeln dessen, was man tun und lassen soll, und kann deshalb weiter reichen als bloße Macht oder gar Gewalt. Gewalt kann sich immer nur in einem konkreten Fall durchsetzen; Macht dagegen kann man als die verallgemeinerte Form von Gewalt auffassen, d. h., der Machtunterworfene kann sicher sein, dass sein Verstoß gegen die Vorschriften der Macht durch Gewalt sanktioniert wird. Sobald aber von Herrschaft die Rede ist, werden die Abhängigkeitsverhältnisse komplizierter. Nun werden soziale Institutionen bedeutsam und damit Regeln, die kommuniziert werden müssen, m. a. W.: Herrschaft ist von Begründung abhängig, auch wenn man an solche Begründungen in der Regel keine großen Ansprüche bezüglich ihrer Vernünftigkeit stellen sollte – etwa kann auch der Verweis auf die ‚von Gottes Gnaden‘ verliehene Berechtigung genügen.
Erkenntnisleitende Interessen bilden sich also nach Habermas „im Medium von Arbeit, Sprache und Herrschaft.“ (TW 163) Wenn wir aber von solchen Interessen nur [<<22] sprechen wollen, insofern der Übergang der menschlichen Entwicklung auf die soziokulturelle Entwicklungsstufe bereits gemacht ist, so unterscheiden sich solche Interessen von biologisch bedingten Ursachen für so etwas wie die Suche nach Erkenntnis durch eben die Fähigkeit bzw. Eigenschaft, mit der wir uns auf dieser Stufe von der Natur unterscheiden: durch die Sprache, mit der wir uns mit anderen Menschen verständigen.
An dieser Stelle springt Habermas nun bereits in der Schrift ‚Erkenntnis und Interesse‘ sehr weit voraus auf die Theorie, die er viel später erst ausführlich entwickeln wird, die aber das Zentrum seiner ganzen Philosophie und Soziologie darstellt. Bereits an dieser frühen Stelle in Habermas’ intellektueller Entwicklung findet sich ein Zitat, mit dem man jenes Zentrum gut zum Ausdruck bringen kann: Mit der Struktur der Sprache – also mit jenem Übergang von der Natur in den soziokulturellen Zustand, in dem erst von Interessen die Rede sein kann, welche die Erkenntnis leiten,

Wenn dem so ist, so müssen jene erkenntnisleitenden Interessen von einer solchen Art sein, dass sie den Implikationen jener Struktur von Sprache entsprechen, d. h., sie müssen jener ‚Intention‘ bereits des ersten Satzes folgen. Das heißt nicht, dass der tatsächliche Prozess der Erarbeitung von Erkenntnissen jener Fluchtlinie in der ‚Mündigkeit‘ und in einem ‚allgemeinen und ungezwungenen Konsensus‘ schon entsprechen muss. Ein solcher Zustand wäre geradezu eine Beschreibung einer ‚emanzipierten Gesellschaft‘. Da dies nicht der Fall ist, enthält eine kritische Diskussion des Zusammenhangs von Erkenntnis und Interesse nach Habermas stets eine kritische Dimension: Etwas soll sein, obwohl es in der Wirklichkeit doch nicht ist.
Sobald wir über Sprache verfügen und damit nach Erkenntnis suchen können, haben wir nach Habermas also die „Idee der wahren Übereinstimmung“ und mehr noch: Von diesem Zeitpunkt an „gründet die Wahrheit von Aussagen in der Antizipation des gelungenen Lebens.“ (TW 164) Die Interessen, um die es in der Erkenntnis geht, lassen sich demnach aus den Grundlagen des Erkennens selbst begründen, und diese Grundlagen lassen sich wiederum kritisch gegen eine Erkenntnis wenden, die nicht oder zu wenig kritisch ist, weil sie jene Grundlagen nicht ausreichend berücksichtigt. Die kritische Kraft der Erkenntnis lässt sich demnach letztlich darauf zurückführen, dass sie sprachlich geschieht und somit in der Verständigung zwischen Menschen. In dieser Verständigung sind Interessen angelegt, die sich in den so gewonnenen [<<23] Erkenntnissen dann durchsetzen oder aber verloren gehen können. Erkenntnis ist also stets in ihrem Wesen kritisch, weil sie aus ihrer sprachlichen Struktur und damit aus ihrer ‚Natur‘ heraus stets auf jenes Interesse verwiesen ist, das in dieser sprachlichen Struktur und in der Logik der Vergesellschaftung und des kooperativen Lebens in Gemeinschaft angelegt ist.
Es geht also bei der Betonung des Zusammenhangs von Erkenntnis und Interesse in Habermas’ ‚kritischer Theorie‘ keineswegs darum, dass Wissenschaftler monetär motiviert sind und vor allem Publicity erzielen wollen; es geht auch nicht darum, dass Industrieinteressen sich durchsetzen, wenn es um die Forschung über Nikotinwirkungen oder über Arzneimittelnebenwirkungen geht. Es geht vielmehr darum, dass Erkenntnis über ihre sprachliche und gesellschaftliche Form stets schon auf jene ‚Antizipation des gelungenen Lebens‘ verwiesen ist, die sich nach Habermas daraus ergibt, dass Erkenntnis auf die Suche nach sprachlichem Konsens und damit auf das Leben in einer Gesellschaft verwiesen ist, die durch ‚Mündigkeit‘ gekennzeichnet ist.
Eine solche Lage sieht Habermas keineswegs als verwirklicht an. Deshalb wird die Aufgabe einer kritischen Wissenschaft darin bestehen, „aus den geschichtlichen Spuren des unterdrückten Dialogs das Unterdrückte“ zu rekonstruieren (TW 164). Das ‚Unterdrückte‘ aber soll nicht etwas sein, was durch eine ethische Entscheidung zur Geltung gebracht werden sollte, die etwa von Philosophen oder Soziologen vorgenommen werden könnte. Diese Geltung ist vielmehr in den Prozessen der soziokulturellen Entwicklung selbst als deren ‚Fluchtlinie‘ angelegt, weil sie sprachlich ablaufen und der Beginn der Sprache bereits den Anfang des Anspruchs auf Begründung in einem freien Konsens enthält. Unterdrückt werden müsste also eigentlich die eigene Dynamik des Prozesses, in dem Erkenntnis geschieht.
Damit ist bereits deutlich, wie Habermas’ kritische Wissenschaft wird stattfinden müssen: Sie wird nicht ‚von außen‘ her Maßstäbe für die Erkenntnis aufstellen und zur Geltung bringen können. Ihrem eigenen Programm zufolge muss sie solche Maßstäbe vielmehr aus den Möglichkeitsbedingungen sprachlicher Verständigung entnehmen. Gerade darin kann sie solche Interessen zur Geltung bringen, die die Erkenntnis leiten sollen. Man könnte also auch sagen, dass Habermas’ Argumentation über den Zusammenhang von Erkenntnis und Interesse darauf hinausläuft, die eigenen Interessen der Erkenntnis gegen deren Verfälschung durch Macht und Herrschaft zur Geltung zu bringen. Offenbar sind solche Interessen bisher nur verkürzt im Prozess der Erkenntnisgewinnung berücksichtigt worden, d. h., die Erkenntnis hat sich selbst nicht ausreichend verstanden und sich selbst nicht angemessen verwirklicht. [<<24]
1.2 Differenzierungen innerhalb der Erkenntnisinteressen
Allerdings erschöpft sich darin nicht die Habermas’sche Theorie der Erkenntnisinteressen, obwohl der gerade entwickelte Zusammenhang für die weitere Entwicklung des Denkens von Habermas von besonderer Bedeutung ist. Im Grunde wird damit bereits der Gedanke der Erkenntnisinteressen an diejenige Theorie zurückgebunden, aus der sich Habermas’ ganze Philosophie einer kommunikativen Rationalität und eines entsprechenden Handelns begründet. Die Bedeutung von Interessen für das Erkennen wird damit abhängig von der Bedingtheit sprachlicher Verständigung durch die Bereitschaft, Geltungsansprüche in einer idealen Gesprächssituation überprüfen zu lassen, wie ‚kontrafaktisch‘ diese Voraussetzung auch immer sein mag. Darauf werden wir noch genauer eingehen. Aber wir müssen zunächst noch berücksichtigen, dass es bei Habermas auch eine Differenzierung von Erkenntnisinteressen gibt, die parallel geht mit einer zum Teil alten, zum Teil neueren Unterscheidung zwischen verschiedenen Wissensformen.
Eine empirisch-analytische Wissenschaft stellt für Habermas die „systematische Fortsetzung eines kumulativen Lernprozesses [dar], der sich vorwissenschaftlich im Funktionskreis instrumentalen Handelns vollzieht.“ (EI 235) Gemeint sind damit alle Naturwissenschaften sowie diejenigen Teile der Sozial- und Geisteswissenschaften, die empirisch arbeiten. Das darin auffindbare Interesse ist dasjenige an einer technischen Verfügung. Die historisch-hermeneutischen Wissenschaften dagegen haben es von selbst mit dem kommunikativen Handeln zu tun, da sie als eine Weiterführung der Interaktion von Menschen innerhalb der Umgangssprache und der entsprechenden Handlungskoordinierungen aufgefasst werden können. Hier liegt ein ‚praktisches‘ Erkenntnisinteresse vor, das sich mit Interpretationen (und nicht mit empirischen Erkenntnissen) beschäftigt, in denen es um die „Intersubjektivität der Verständigung in der umgangssprachlichen Kommunikation und im Handeln unter gemeinsamen Normen“ geht (EI 221). Mit Interpretationen tragen diese Wissenschaften, die als ‚humanities‘ im Unterschied zur ‚science‘ bezeichnet werden können, also zur intersubjektiven Verständlichkeit im Sinne einer Selbstverständigung und eines Verstehens des Fremden bei.
Das emanzipative Erkenntnisinteresse dagegen ist in der über lange historische Zeiträume entwickelten Systematik der Wissenschaften (Natur- vs. Geisteswissenschaften; empirische vs. Interpretationswissenschaften) nicht so leicht unterzubringen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn ein eigenständiger Ort im Zusammenhang der akademischen Disziplinen angegeben werden soll, also über jene transzendentale Überlegung hinaus, wonach mit dem Beginn der sprachlichen Verständigung bereits der Weg zur diskursiven Einlösung von Geltungsansprüchen in einer idealen Gesprächssituation hin [<<25] begangen wird. Habermas findet dieses Erkenntnisinteresse vor allem dort angelegt, wo das Phänomen der ‚Selbstreflexion‘ innerhalb des Wissenschaftsbereiches institutionalisiert ist, nämlich in der philosophischen Reflexion.