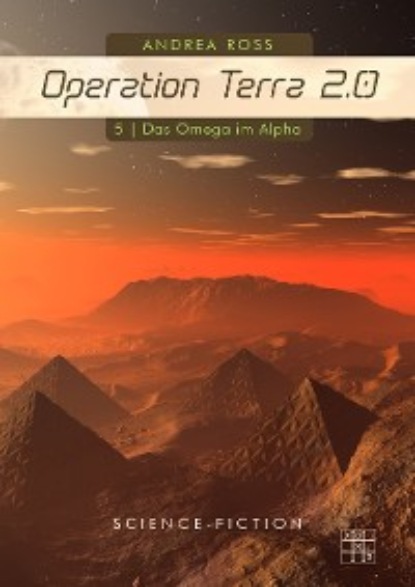- -
- 100%
- +
Wie er empfanden vielen Kolonisten. Nachbarn gingen sich gegenseitig auf die Nerven, Konflikte zwischen den Nationalitätengruppen flammten auf. Die Unmöglichkeit, sich zeitweise persönliche Freiräume zu schaffen oder woanders hin umzuziehen, generierte Nährboden für Ärger. Man steckte in einem Hamsterrad, zusammen mit stets denselben Personen, die man mehr oder weniger leiden konnte, und das ohne Aussicht auf Veränderung.
Viele vermissten im eigenen Heim die allabendliche Berieselung durch das Fernsehen und beklagten die geringe Auswahl an Konsumgütern. Die Raumfrachter brachten nur das Notwendigste mit. Zudem nervte die Notwendigkeit, bei jedem Gang ins Freie eine Atemschutzmaske aus Viskosepapier zu tragen. Die war notwendig, damit der allgegenwärtige feine Marsstaub die Lunge nicht schädigte.
Gut die Hälfte glaubte mittlerweile, dass es ein fataler Fehler gewesen sei, für immer auf den Mars umzusiedeln. Die Einsicht kam natürlich zu spät, denn sie alle hatten sich vertraglich verpflichtet; eine spätere Rückkehr zur Erde war in den Klauseln des Vertragswerks ausdrücklich ausgeschlossen.
Am heutigen Dienstag hatte Philipp die Schnauze mal wieder gestrichen voll. Seine Ehefrau lief mit einer depressiven Leichenbittermiene durch die Gegend, weil sie erneut ihre Periode bekommen hatte. Nachbar Thomas meinte momentan scheinbar, seine miese Laune an ihm auslassen zu müssen, was bei der allmorgendlichen Gartenarbeit in einen ekelhaften Streit ausgeartet war – und vorhin auf der Arbeit hatte er sich einen derben Rüffel eingefangen. Ein Schlauch war undicht gewesen, hatte den Pflanzbereich eines Gewächshauses knöcheltief unter Wasser gesetzt. Er hatte das Leck zu spät bemerkt.
Nachdenklich tigerte Philipp wie jeden Abend jene Straße entlang, welche in den Westteil der Siedlung führte. Der Gedanke, jetzt nach Hause zu müssen, schmeckte ihm gar nicht. Die Sonne schien wärmend vom rötlich blauen Himmel, und es würde noch für ein paar Stunden taghell sein.
Er zog seine Jacke aus, band sie sich um die Hüften. Sollte er versuchen, über die Mauer zu kommen? Das einzige Tor, das aus der Siedlung hinaus führte lag im Südosten, war stets bewacht. Angeblich gegen mögliche Angriffe von außen. Trotzdem hatte er vor ein paar Wochen den Versuch unternommen, hinaus zu spazieren und war prompt aufgehalten worden. Die Kolonie war ein verdammtes Gefängnis, nichts weiter!
›Wenn ich nun eine der großen Regentonnen nehme und sie verkehrt herum vor die Mauer stelle? Dann könnte ich es schaffen, sie zu überwinden. Um diese Jahreszeit sind sie meist leer‹, überlegte Emmerson. Erstaunt stellte er wenige Minuten später fest, dass er bereits an seinem Haus vorbei gelaufen war. Das wertete er als Fingerzeig des Schicksals. Nein, er würde heute nicht gleich heimgehen, sondern es endlich wagen!
Falls sie ihn erwischten, was wollten sie schon tun? Gefängnisse gab es auf dem Mars ebenso wenig wie Polizei oder Gerichte. Zwar bestand die Möglichkeit, kriminelle Elemente mit dem nächsten Raumfrachter zur Erde zu schicken, doch dafür musste man sicherlich mehr anstellen als mal kurz über den Wall zu klettern.
Das letzte Grundstück der Straße kam in Sichtweite, dicht dahinter lag die Siedlungsgrenze. Philipp kannte den deutschen Besitzer dieses Hauses, er arbeitete mit ihm zusammen. Sein Blick fiel unwillkürlich auf die mausgraue Regentonne, die bei den baugleichen Häusern jeweils an derselben Stelle stand. Weit und breit war keiner der Bewohner zu hören oder zu sehen. Wahrscheinlich waren die Lemkes nach der Arbeit noch ins Kino oder Schwimmbad gegangen, das taten sie häufig. Sollte er oder sollte er nicht?
Er sollte, der Beschluss war gefasst. Mit eingezogenem Kopf schlich er durch den Vorgarten, duckte sich wie ein Einbrecher hinter den üppigen Tomatenstauden. Alles blieb ruhig. Dann ging er neben der Regentonne in Deckung, spähte vorsichtig über den oberen Rand ins Innere. Hatte er es sich doch gedacht, nur eine Handbreit rotbraunes Wasser bedeckte den Boden. Kurzentschlossen kippte er die Tonne um, ließ Wasser und Schlamm heraussickern und umfasste sie mit beiden Armen.
Als er das sperrige Plastikgefäß gerade schwitzend auf die Straße zerren wollte, hörte er Stimmen, die sich näherten. ›Die Nachbarn vom Haus auf der anderen Straßenseite, verflucht noch mal! Die werden mich auf jeden Fall sehen!‹
Er ließ von der Tonne ab und stellte sich vor die Haustür. Tat so, als wolle er gerade seinen Daumen auf das IDPad legen.
»Hallo Patrick! Na, einen schönen Tag gehabt?«, fragte die Frau fröhlich. Das Paar war stehen geblieben.
Philipp atmete stoßweise, drehte sich selbstverständlich nicht um. Er nickte. »Geht so«. Innerlich betete er, dass die lästigen Störer in ihrem Haus verschwinden und sich dort möglichst von den Fenstern zum Vorgarten fernhalten sollten.
Weitere Nachbarn nahten grüßend, verwickelten die anderen in ein angeregtes Gespräch. Gelächter. Dann verschwanden alle vier im Haus gegenüber, kümmerten sich nicht mehr um den vermeintlichen Patrick Lemke. Manchmal war gute Nachbarschaft eben doch was Feines.
Nun musste es schnell gehen. Er zerrte an der Tonne, bugsierte sie keuchend um die Grundstücksecke und suchte nach einem ebenen Stück Boden, um sie gerade hinzustellen. Ein letztes Mal sah er sich prüfend um, dann kletterte er auf das etwa einen Meter hohe Behältnis, dessen Boden sich unter seinem Gewicht eindellte, und zog sich mit einem Ächzen an der Mauer hoch. Er zögerte einen Moment, denn er musste auf der anderen Seit zwei Meter fünfzig in die Tiefe springen. Der Boden lag dort voller Geröll, man konnte sich leicht am Knöchel verletzen.
Der Sprung gelang. Erst jetzt wurde Philipp bewusst, dass er auf dem Rückweg Probleme bekommen würde, weil ja die Tonne auf der anderen Seite der Mauer stand und er irgendwie von dieser Seite aus hinauf gelangen musste. Er vertagte das Problem auf später, richtete seinen Blick vorerst lieber auf den glucksenden, gemächlich dahinfließenden Fluss.
Wie herrlich, bewegtes Wasser zu sehen! Dies war eben doch etwas ganz anderes als die Lichtsimulation in seinem Badezimmer, die er inzwischen längst nicht mehr so reizvoll fand wie zu Anfang.
Philipp setzte sich zwischen saftig grünen Farnen und kleinen, blühenden Steppenpflanzen ans Ufer, warf Steine ins wadenhohe Wasser. Die spärliche Vegetation aus kälteresistenten Pflanzen stammte aus der sibirischen Tundra, man hatte die Samen eigens zum Mars transportiert. Von selbst wuchs in dieser toten Einöde absolut nichts, da der Boden ja keine lebenden Samen enthielt. Mit ein bisschen Glück würde sich das angebaute Grün jedoch nach und nach wie ein schönes Kleid über die Landschaft ziehen. Ein Anfang war gemacht.
Er hätte ewig so sitzenbleiben, Betrachtungen anstellen und den entspannenden Anblick des Wassers genießen können, hätte ihn die blanke Neugier nicht weiter getrieben.
Im Schlendergang folgte er dem Flusslauf nach Norden, in Richtung der Hügelketten. Roter Staub lag in der Sommerluft, man sah die Landschaft wie durch einen Weichzeichner. Die Sonne erstrahlte dadurch in Rosa. Philipp genoss den illegalen Ausflug in vollen Zügen. Die Sonne auf der Haut, das Alleinsein, der Gang durch unbekannte Welten, der elektrisierende Reiz des Verbotenen … pfeifend stieg er auf eine kleine Anhöhe, beschattete seine Augen mit einer Hand.
Rotbraune Geröllhalden erstreckten sich in nordwestlicher Richtung bis zum Horizont, nur durchschnitten vom etwa fünf Meter breiten Fluss, der mäandernd in der Ferne verschwand. Im Norden thronten kahle Hügelketten, die nach Osten hin flacher wurden. Wie weit mochte diese Region entfernt liegen? So zehn, fünfzehn Kilometer? ›Eindeutig zu weit für den heutigen Fußmarsch‹, entschied Philipp enttäuscht.
Er wollte sich gerade wieder zum Gehen wenden, da sah er unterhalb eines der Hügel etwas glänzen. Er sah erstaunt ein zweites Mal hin. Kein Zweifel, da reflektierte irgendein Gegenstand die schräg auftreffenden Sonnenstrahlen! Nur – worum mochte es sich handeln? Ihm war nichts darüber bekannt, dass die Siedlung Außenposten unterhielt. Natürlichen Ursprungs konnte die Reflektion allerdings erst recht nicht sein, denn das Flussbett verlief etliche Kilometer weiter westlich. Wie dem auch war, das Rätsel ließ sich aus dieser Entfernung bedauerlicherweise nicht lösen.
Philipp beschloss, noch eine halbe Stunde in der freien Landschaft umher zu wandern, anschließend am Wall entlang zu gehen und am Tor reumütig zu behaupten, er sei auf die Mauer gestiegen, habe das Gleichgewicht verloren und sei versehentlich auf der anderen Seite heruntergefallen. Das Gegenteil würde ihm wohl schwerlich jemand beweisen können.
›Und warum habe ich eine Tonne geklaut … äh, ausgeliehen … und bin überhaupt erst hinauf geklettert?‹, sinnierte Philipp beim Gehen. ›Ah, ich weiß … ich wollte den Wasserstand des Flusses überprüfen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, ob die Bewässerungsanlage für den Rest dieses trockenen Sommers noch problemlos gespeist werden kann‹.
Der Plan funktionierte prächtig. Außer einer Belehrung über die möglichen Folgen bodenlosen Leichtsinns und der Anmaßung von Aufgaben, die ihm gar nicht oblägen, zeitigte seine temporäre Flucht keine Folgen. Philipp brachte in der Abenddämmerung die Wassertonne wieder ordnungsgemäß an ihren Platz zurück, entschuldigte sich bei Patrick Lemke und ging beschwingt nach Hause. Nicht einmal Swetlanas bittere Vorwürfe konnten seinem Hochgefühl etwas anhaben.
*
Drei Monate später gab es Grund zum Feiern. Swetlana überraschte Philipp mit der freudigen Mitteilung, dass der Arzt ihre Schwangerschaft festgestellt habe. Noch
sei es zu früh, Genaueres zu sagen, aber das Scanbild lasse den Rückschluss auf mehr als ein Baby zu.
»Endlich muss ich mich nicht mehr wertlos fühlen, wenn andere Mütter mit ihren kleinen Kindern an mir vorbeistolzieren«, strahlte Swetlana erleichtert. »Und anscheinend werden es gleich Zwillinge, stell dir vor! Das ist prima, dann können die Geschwister von Anfang an miteinander spielen.«
Philipp freute sich mit ihr, doch seine Gedankengänge kreisten insgeheim auch immer wieder um die Frage, wie er es anstellen könnte, das Siedlungsgebiet ein weiteres Mal zu verlassen. Ihm wollte einfach nichts Brauchbares einfallen. Er hatte sogar schon von jenem geheimnisvollen Blinken unter dem fernen Hügel geträumt, so sehr beschäftigte ihn das Gesehene. Nur – wenn er dorthin gelangen wollte, musste er einen Rover entwenden, und das erschien ihm undurchführbar.
Er schalt sich selbst einen egoistischen Idioten. Es gab momentan Wichtigeres, schließlich war er verheiratet und würde bald Vater werden. Daher nahm er sich fest vor, seine Swetlana zum nächsten Termin beim Frauenarzt zu begleiten. Natürlich freute auch er sich mächtig auf die Kinder, sie würden sein eintöniges Leben mit Sicherheit bereichern. Womöglich wäre sogar sein Freiheitsdrang weniger stark ausgeprägt, sobald sie auf die Welt kamen.
Frohgemut betraten die Emmersons gemeinsam die ärztliche Station. Philipp hatte seine Ehefrau schon lange nicht mehr so fröhlich und entspannt gesehen. Die Mutterschaft stand ihr gut zu Gesichte.
Der Arzt platzierte den Scanner auf dem noch flachen Unterleib. Diese neue Technologie hatte vor einigen Jahrzehnten die Ultraschallgeräte abgelöst. Man sah die ungeborenen Kinder nun in Farbe und bis ins letzte Detail. Die gestochen scharfen Bilder ließen sich mühelos vergrößern, bis man auch die kleinste Pore in der Haut zu erkennen vermochte. Swetlana juchzte, als sie die Fruchtblase nebst Inhalten erkannte.
Plötzlich hielt der Mediziner abrupt in seiner fließenden Bewegung inne, der Scanner verweilte auf derselben Stelle. »Oh
… das ist gar nicht gut. Sehen Sie das da? Drei Embryonen … ich hätte Ihnen die Hormonbehandlung vielleicht doch besser nicht verschrieben«, murmelte er. Er schien total entsetzt.
Swetlana lächelte immer noch glücklich. »Eineiige Drillinge? Ach, das ist nicht so tragisch. Mithilfe der modernen Medizin werden wir sie in achteinhalb Monaten schon heil ans Tageslicht holen, da bin ich guten Mutes. So werden die Kinder sich das Standardkinderzimmer halt zu dritt teilen müssen.«
»Ganz so einfach ist das leider nicht … nun ja, warten wir erst einmal noch ein paar Wochen ab. Dann sehen wir weiter«, meinte der Arzt nebulös.
Die drei Ungeborenen entwickelten sich prächtig. Swetlana hatte inzwischen mit Morgenübelkeit zu kämpfen, doch das tat ihrer Freude keinen Abbruch. So ahnte sie nichts Schlimmes, als sie und Philipp sich in der 16. Schwangerschaftswoche zum nächsten Besuch in der Ärztestation aufmachten.
Dieses Mal wirkte der Doktor kühl und sachlich, kein verbindliches Lächeln erhellte seine verkniffene Miene. Im Gegenteil, Mimik und Gestik wirkten abweisend. Er drehte sich um, schaltete den Scanner ein. Das Gerät signalisierte mit einem hohen Piepsen seine Bereitschaft.
»Vielleicht ist der gute Mann wegen der vielen Schwangerschaften schwer im Stress«, raunte Philipp seiner Frau augenzwinkernd zu.
Wieder tastete sich der Kopf des Scanners Zentimeter für Zentimeter über Swetlanas Bauch. Und wieder erschien eine Fruchtblase auf dem hoch auflösenden Bildschirm, aber dieses Mal waren die drei winzigen Körper deutlich erkennbar – einschließlich ihres Geschlechts. Zwei Mädchen und ein Junge drängten sich dicht aneinander.
»Ich werde zum Ende hin wohl mächtig fett werden«, scherzte die werdende Mutter voller Stolz. Sie weinte vor Rührung.
Der Mediziner blieb immer noch ernst, machte keinerlei Anstalten, ein Bild auszudrucken. Swetlana wusste, dass das eigentlich üblich war. Sie hatte von Nachbarinnen schon einige Fotos vor die Nase gehalten bekommen.
»Was ich Ihnen jetzt sage, wird Ihnen nicht gefallen. Sie müssen sich innerhalb der kommenden Woche entscheiden, welches der Kinder wir abtreiben sollen. Bitte erinnern Sie sich – Sie haben den Kolonisationsvertrag unterschrieben, und der enthält den Passus, dass pro Paar nur zwei Babys erlaubt sind.
Das bedeutet, dass wir eines davon loswerden müssen. Ich empfehle, einen Jungen und ein Mädchen zu behalten. Sie sind alle drei gleich gut entwickelt, daher gibt es keine Notwendigkeit, ein bestimmtes Kind auszusuchen«, referierte der Arzt so sachlich, als spreche er über verschimmeltes Brot.
Philipp und Swetlana glaubten, der Schlag müsse sie treffen.
»A … aber … das kann doch nicht Ihr Ernst sein«, stammelte Swetlana verstört. »Das sind ungeborene Menschenleben, es sind meine Kinder, über die Sie da reden!«
»Mir persönlich tut das leid, aber da kann man nichts ändern. Die Vorschrift macht durchaus Sinn, ansonsten hätten wir hier in der Siedlung schnell eine Überbevölkerung, die unsere Gemeinschaft gefährden würde. Die Kapazitäten sind nun einmal begrenzt«, beeilte sich der Arzt zu sagen. Er vermied jeglichen Blickkontakt.
Philipp wurde sauer. »Sie werden keines meiner Kinder umbringen! Für eine Drillingsgeburt muss es Ausnahmen geben, und wenn nicht, soll man gefälligst künftig welche zulassen. Was kann denn bitteschön meine arme Frau dafür, dass sie mehr als zwei Kinder im Leib trägt?«
»Beschweren Sie sich ruhig, doch das wird nichts nützen. Wir bekamen klare Anweisungen, die wir ohne Einzelfallprüfung zu befolgen haben. Ich muss Sie auch noch darauf hinweisen, dass keine Garantie für das Überleben der restlichen Embryonen übernommen werden kann, wenn wir der Gebärmutter eines entnehmen. Manchmal kommt es durch den Eingriff zu Fehlgeburten. Machen Sie sich also besser auf den schlimmsten Fall gefasst. Wir sehen uns nächste Woche. Ihren Termin bekommen Sie wie immer am Empfang.«
Mit diesen Worten verließ er hastig den Raum. Das Ehepaar Emmerson benötigte noch mehrere Minuten, bis es fähig war, die Ärztestation zu verlassen. Philipp musste Swetlana stützen.
»Beruhige dich, mein Schatz. Ich bringe dich nach Hause, und dann gehe ich schnurstracks zur Verwaltung und mache denen dort die Hölle heiß. Du wirst die Kinder alle unbeschadet zur Welt bringen, so wahr ich hier vor dir stehe«, flüsterte der werdende Vater mit starrem Blick. In seinem Inneren kochte ein Magmasee aus Wut und Verzweiflung.
*
Der verantwortliche Leiter der Marskolonie, ein grobschlächtiger Franzose aus der Bretagne, stellte sich befürchtungsgemäß stur.
»Wir können da leider keine Ausnahme machen. Die Zeit drängt. Abtreibungen sind nur bis zur 18. Schwangerschaftswoche erlaubt, danach wäre die Entnahme eines Babys nach den gesetzlichen Vorschriften mit Mord gleichzusetzen. So leid es mir tut, der Eingriff muss zwingend nächste Woche stattfinden«, entschied Marcel Dubois mit unbewegter Miene.
»Aber Sie müssten doch auf der Erde wegen einer Ausnahmegenehmigung nachfragen können! Und was wäre eigentlich, wenn sich einer der anderen Siedler verpflichten würde, das überzählige Kind zu adoptieren?«, stieß Philipp in seiner Verzweiflung hervor.
»So etwas würde mit Sicherheit niemand tun. Die wollen allesamt eigene Kinder haben, was ja verständlich ist. Wie Sie wissen, werden die Frauen nach der zweiten Geburt sterilisiert. Falls eines der Kinder danach stürbe, vielleicht wäre in diesem Fall eine Adoption denkbar … aber das ist graue Theorie. Wir hatten bislang keine Todesfälle, und damit bleibt es bei meiner Entscheidung. Dies ist mein letztes Wort in dieser Angelegenheit.«
Philipp gab nicht auf, fixierte den Mann mit eindringlichem Blick. »Wir könnten einen allgemeinen Aufruf über die Hauskommunikationssysteme starten … womöglich fände sich ja doch ein Paar, das zur Adoption bereit wäre!«
»Dafür ist die Zeitspanne zu knapp. Man kann von niemandem erwarten, dass er eine Entscheidung mit dieser Tragweite mal eben so auf die Schnelle trifft. Finden Sie sich besser damit ab, Herr Emmerson, und freuen Sie sich auf die beiden anderen Kinder.« Dubois drückte auf den Knopf für die Schwebetür, komplimentierte ihn hinaus.
Wie sollte er diese Katastrophe nun Swetlana beibringen, die zu Hause voller Hoffnung auf seine Rückkehr wartete? Er hatte auf ganzer Linie versagt, traute sich nicht, den Heimweg einzuschlagen. Deshalb trottete er mit hängendem Kopf zu den Gewächshäusern hinüber. Auch wenn er gerade keinen Dienst hatte – ein wenig stumpfsinnige Arbeit würde ihn vielleicht ablenken, sein aufgewühltes Gemüt halbwegs beruhigen.
»Gut, dass du kommst! Wir wollten dich gerade holen lassen, konnten dich daheim aber nicht erreichen. Die komplette Bewässerung ist ausgefallen. Irgendetwas muss die Ansaugpumpe drüben am Fluss verstopft haben, oder eine der Zuleitungen ist gebrochen. Du musst sofort raus und nachsehen«, empfing ihn sein Vorarbeiter. Er fuchtelte nervös mit den Armen.
Philipp war ganz verdattert, konnte nicht klar denken. Ȁh
… wie meinst du das, ich müsste raus?«
»Traust du dir zu, einen der Rover zu fahren? Carl Snider soll dir helfen, aber ihn habe ich bislang ebenfalls nicht erreicht. Du müsstest ihn zu Hause abholen. Nimm Werkzeug, Ersatzrohre und Muffen, eines der Überlebenszelte und Proviant mit, falls ihr bis Einbruch der Dunkelheit nicht fertig werden solltet. Ich würde es selbst machen, kann aber hier nicht weg. Seit Darina an Krebs erkrankt ist und dauerhaft ausfällt, fehlt mir ständig Personal.«
»Darina leidet an Krebs? Oh, das wusste ich gar nicht … « Philipp kapierte immer noch nicht vollständig, was man ihm soeben angetragen hatte.
»Komm gleich mit hinaus, ich zeige dir, wie man den Rover bedient«, verfügte der Vorarbeiter hektisch und eilte davon.
Erst als Emmerson im Rover saß und damit durch die Kolonie schnurrte, traf ihn die Erkenntnis wie ein Hammerschlag. Einen Moment mal … er besaß ein Fahrzeug und dazu die offizielle Erlaubnis, durch das Tor zu fahren … führte darüber hinaus Proviant und ein Überlebenszelt mit sich, das vor Hitze, Kälte und dem scharfkantigen Staub schützte …!
Abrupt trat er auf die Bremse. Nein, er würde Carl Snider nicht bei der Hausnummer 267 im amerikanischen Viertel einsammeln. Vielmehr würde er jetzt schnurstracks nach Hause in die Nummer 144 fahren, seine Frau in den Rover setzen und mit ihr in die Freiheit entkommen.
Euphorie durchströmte ihn, seine Wirbelsäule kribbelte. Das Schicksal hatte entschieden. Er glaubt zwar nicht an Gott, aber irgendetwas oder irgendjemand musste hier seine omnipotenten Finger im Spiel gehabt haben.
›Wir zelten zweieinhalb Wochen bei den Hügeln, bis die legale Abtreibungsfrist definitiv vorüber ist. Dann kehren wir zurück – und ich nehme meine Bestrafung entgegen. Aber die ist mir einerlei, solange nur das Kind überlebt. Die kaputte Leitung soll ein anderer Trupp reparieren, hier geht es schließlich um ein junges Menschenleben. Der akute Personalmangel geht mir geradewegs am Arsch vorbei«, dachte er grimmig, während er den Marsrover auf einer Kreuzung wendete. Ihm jagten heiße Adrenalinschübe durch die Adern.
*
Es dauerte volle achtzehn Minuten, bis Swetlana begriffen und das Nötigste gepackt hatte. Philipp steuerte das Gefährt zum Tor. Seine Nervosität stieg mit jedem Meter, den sie zurücklegten. Es war nicht ganz auszuschließen, dass sein Vorarbeiter mittlerweile doch noch Kontakt zu Carl Snider bekommen und dieser ihm womöglich mitgeteilt hatte, dass er dort nicht aufgetaucht war. Würde man sie aufhalten?
Der Rover hielt an der Markierungslinie. Mit zitternden Fingern fischte Philipp den abgestempelten Passierschein aus der Brusttasche seiner Jacke, reichte ihn dem Wachmann. Ein kurzer, kritischer Blick des Wächters richtete sich auf Swetlana, die auf der Rückbank Platz genommen hatte.
»Und das ist eine Kollegin?«
»Selbstverständlich! Für diese Art Arbeit muss man zu zweit sein«, erklärte Philipp wahrheitsgemäß. Sein Magen rebellierte. Falls der Typ jetzt im Gewächshaus nachfragte, wäre die Chance vertan.
»In Ordnung. Weiterfahren, wünsche gute Verrichtung!« Der Wachmann nickte freundlich, gab den Weg frei.
Erst nachdem das Tor wegen des unebenen Geländes außer Sichtweite geriet, atmete das Ehepaar Emmerson tief durch. Swetlana schlang die Arme um ihren Bauch, der neuerdings eine kleine Wölbung aufwies. Es gab hier draußen nur bis zum Fluss eine Staubpiste, die relativ frei von Geröll war. Von da an wurde die Fahrt so holprig, dass Swetlana schon befürchtete, sie werde die Babys allein deswegen verlieren. Sie zogen eine weithin sichtbare Staubwolke hinter sich her.
Philipps Gedanken kreisten um die Frage, wohin er den Rover eigentlich steuern sollte. Sie würden täglich Wasser benötigen, also musste die Zeltstelle in unmittelbarer Nähe des Flusses liegen. Genau dort würde man jedoch am ehesten nach ihnen fahnden … es lag auf der Hand, dass spätestens morgen früh ein Suchtrupp ausrücken würde. Er beschloss, zunächst dem Flusslauf zu folgen und die Entscheidung erst vor Ort zu fällen, wenn sie bei den Hügeln angelangt waren.
Die Fahrt wurde lang und beschwerlich. Mehrmals musste Philipp anhalten, um seiner schwangeren Frau die Möglichkeit zum Ausruhen zu bieten. So auch jetzt. Noch standen sie mehrere Kilometer vom Fuß der schroffen Hügelkette entfernt. Die Sonne versank allmählich am Horizont und es wurde mit jeder Minute kühler.
»Es hilft nichts, wir müssen heute Nacht erst einmal hier bleiben. Bis zu den Hügeln schaffen wir es nicht mehr. Es wäre zu gefährlich, in der Dunkelheit über dieses unebene Gelände zu fahren. Ich würde Abgründe zu spät erkennen. Da dasselbe aber auch für unsere Verfolger gilt, werden wir bis zum Morgengrauen wohl unbehelligt bleiben. Bevor der Morgen dämmert, müssen wir das Zelt wieder abgebaut haben. Die weiße Oberfläche würde sonst die Sonne reflektieren und den Suchtrupp auf unsere Spur führen«, murmelte Philipp frustriert.
Er legte ein etwa vierzig mal vierzig Zentimeter messendes Päckchen auf den Boden, zog an einer Lasche. Sofort entfaltete sich das Zweimannzelt, stand nur drei Sekunden später fix und fertig aufgebaut in der Landschaft. Die Emmersons statteten es mit Decken und ein paar Proteinriegeln aus, und Philipp holte im verlöschenden Tageslicht noch einen Kanister Wasser aus dem Fluss. Um es vom Dreck zu befreien und trinkbar zu machen, würden sie es durch ein Stückchen Stoff filtern müssen.
»Glaubst du, wir werden es wirklich schaffen?«, fragte Swetlana schläfrig. Draußen zerrte der auffrischende Wind an der Zeltkonstruktion, ließ unablässig Flugsand darauf einprasseln. Das Geräusch hörte sich ein bisschen wie Graupelschauer an.