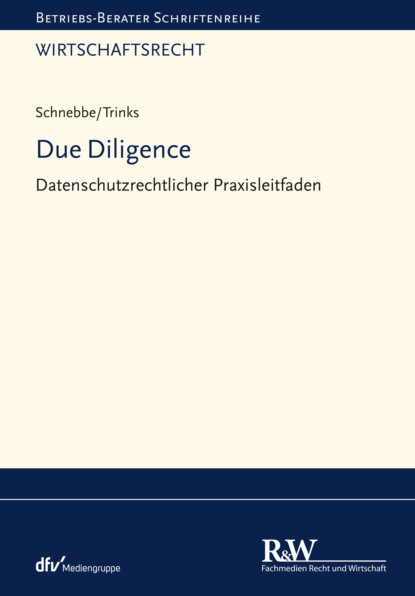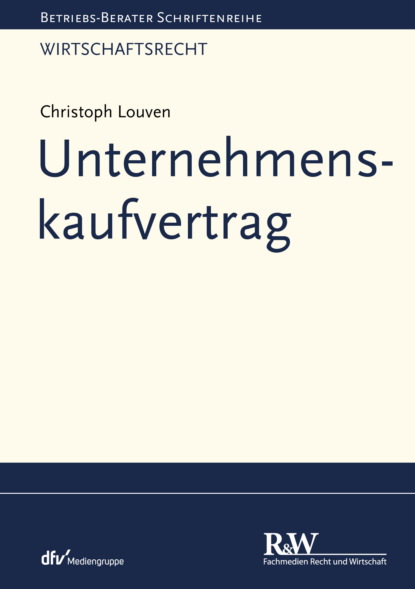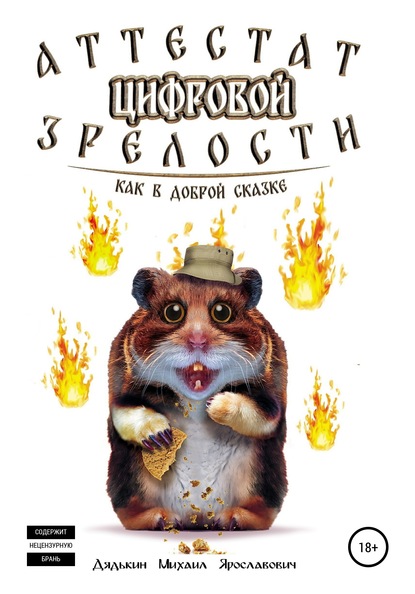Internationales Kauf-, Liefer- und Vertriebsrecht
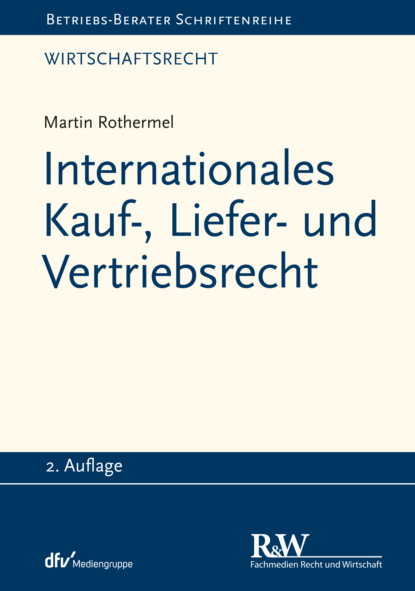
- -
- 100%
- +

von
Dr. Martin Rothermel
München
2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2021
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Alle im Buch verwendeten Begriffe verstehen sich geschlechterneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet – entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat lediglich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-8005-1743-5

© 2021 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main
www.ruw.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Satzkonvertierung: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, 69502 Hemsbach
Druck und Verarbeitung: WIRmachenDRUCK GmbH, Mühlbachstraße 7, 71522 Backnang
Vorwort
Dieses Buch richtet sich auch in seiner zweiten, überarbeiteten und erweiterten Auflage an Praktiker, Justiziare, Anwälte und auch Studenten, die erstmalig oder immer wieder mit internationalen Kauf-, Liefer- und Vertriebsverträgen befasst sind. Ausgangspunkt ist eine ganz einfache praktische Frage: „Wie weit ist es möglich und sinnvoll, trockenen Fußes den deutschen Standardvertrag für internationale Geschäfte einzusetzen, wo regnet es hinein, welche Alternativen bieten sich, was kann man tun?“ Der zusammenfassende erste Teil kommt dafür – bis auf die neue praktische Rechtsvergleichstabelle – nun ganz ohne §§ aus. Man findet dort klare Antworten auf praktische Fragen.
Es wird dabei im ersten Teil versucht, in der EU konkret und praktisch weiterzuhelfen und für Länder außerhalb der EU (noch mehr als bisher) Anhaltspunkte zur Orientierung zu liefern. Zudem sollen Vor- und Nachteile der Vertragsgestaltung nach deutschem Recht, UN-Kaufrecht, Schweizer Recht und Common Law noch stärker ausgeleuchtet werden als in der ersten Auflage.
Der zweite Teil ist juristisch und detailliert. Dafür werden zunächst die wesentlichen Rechtsquellen sortiert, übersichtlich dargestellt und in ihrer Relevanz für deutsche Unternehmer oder Juristen bewertet. Daran schließen sich zielgerichtete inhaltliche Ausführungen zur folgenden Überlegung an: „Welches Recht gilt, welches Gericht entscheidet und wie kann oder soll man das beeinflussen?“. Diese sollen dem Leser ermöglichen, seine trockene Route durch das Bermudadreieck von Rechtswahl, Gerichtsstandswahl und Erfüllungsortvereinbarung zu finden und Ansätze für die Vertragsgestaltung zu identifizieren.
Das internationale Vertriebsrecht (Handelsvertreter, Vertragshändler, Franchise) in über 60 Ländern wird im Hinblick auf die Rechts- und Gerichtsstandswahl sowie zwingende internationale Bestimmungen und nationale Regelungen dargestellt; daraus ergeben sich Möglichkeiten und Erfordernisse für die Einflussnahme durch den Vertrag.
Ausführungen zu Eigentumsvorhalt, Konsignationslagern und Sicherungsübereignung in über 75 Ländern, zu den Incoterms®2020, zum internationalen Gewerblichen Rechtsschutz sowie dem Vertriebskartellrecht in der EU und 15 weiteren Ländern und dem internationalen Schiedsverfahrensrecht mit einer tabellarischen Darstellung von 12 Schiedsordnungen runden die Thematik ab.
Insgesamt werden somit die typischen Fragen besprochen, die dem Autor in Seminaren und Vorlesungen sowie bei der Beratung im internationalen Kauf-, Liefer- und Vertriebsrecht immer wieder gestellt werden.
Da das Buch versucht, das Recht in vielen Ländern darzustellen, zeigt es ein Standbild einer sich ständig bewegenden Materie. Die herangezogenen Quellen aktualisieren sich teilweise monatlich und gehen vielfach auf von Anwälten in anderen Ländern ausgefüllten Q&A Formulare zurück
München im Januar 2021.
Einleitung
1
Grenzüberschreitender Geschäftsverkehr – wie mit internationalen Kauf-, Liefer- und Vertriebsverträgen – fühlt sich so an, als sei er weniger sicher und vorhersehbar als nationaler Geschäftsverkehr. Einkäufer, Verkäufer, Vertriebler, Unternehmer und ihre Berater, gleich ob Justiziar oder Rechtsanwalt, stellen sich viele Fragen: Welches Recht ist anwendbar? Welches Recht wähle ich? Was ist im Recht des Vertragspartners enthalten und ist das besser oder schlechter als das eigene Recht? Kann man Vorteile einer anderen Rechtsordnung vielleicht nutzen? Gibt es unbekannte nachteilige Regelungen, die (un)vermeidlich sind? Welches Gericht ist im Falle eines Streites zuständig? Wie läuft das Gerichtsverfahren ab – vor allem wenn es ein Verfahren im Ausland ist? Kann ein Urteil überall vollstreckt werden? Bringt es Vorteile oder Nachteile, ein internationales Schiedsgericht entscheiden zu lassen? Welches nehme ich? Was ist pragmatisch? Was sollte ich keinesfalls falsch machen? Wie komme ich „trockenen Fußes“ von A nach B, wo könnte es reinregnen und was ist zu tun?
2
Im Grunde bieten sich in solchen Fällen drei oder vier Wege des Vorgehens an:
– Erstens nimmt man einfach die bisher bewährten Verträge und Standardbedingungen nach deutschem Recht (oder vielleicht hat man auch einen Satz solcher Bedingungen nach UN-Kaufrecht oder Schweizer Recht parat), weil das ökonomisch ist. Vielleicht kann man damit pragmatisch alles am einfachsten „erschlagen“.
– Zweitens kann man spezielle Rechtsberater im eigenen Land und im Land des jeweiligen Vertragspartners zu Rate ziehen, um genau zu klären, welches Recht Anwendung findet, welches Recht welche Vor- und/oder Nachteile für die jeweiligen Parteien hätte sowie ob und was man wählen kann oder sollte, inwiefern dies modifiziert werden müsste und auch könnte, sowie welches Gericht entscheidet bzw. welches Gericht man idealerweise anhand des anzuwendenden Rechts, der verfahrensmäßigen Besonderheiten, der Vollstreckungsmöglichkeiten anrufen wollte oder sollte und was es sonst noch an Besonderheiten gibt (zwingende Bestimmungen, ordre public, Formvorschriften etc.), damit man einen idealen Regelungsvorschlag hat. Schlägt der Vertragspartner etwas anderes vor, lässt man das wiederum prüfen und versucht, es entsprechend zu verhandeln.
– Drittens – unter Kombination der vorstehenden Varianten eins und zwei – stellt man sich die Frage, wie weit man sich mit den bewährten Standards in unbekannte Gebiete hinausbegeben kann, ob und inwiefern also deutsches Recht zur Anwendung kommen bzw. gewählt werden kann, ob und inwiefern ein deutsches Gericht zuständig sein kann und ein deutsches Urteil vollstreckbar wäre, sowie welche Regelungen im Land des Vertragspartners möglicherweise international zwingend sind oder einen ordre public bewirken, so dass die Regelungen im Vertrag oder des eigenen Rechts nicht greifen. Auf diese Weise ließe sich abwägen, wofür man möglicherweise weitere Rechtsexpertise benötigt und was man „mit Bordmitteln erledigen“ kann. Genau hierfür dient die folgende Darstellung.
– Viertens stellt sich vielleicht noch die Frage, ob und wann und wie man anderes Recht wählen sollte, um bei internationalen Verträgen etwaige Vorteile, die andere Rechtsordnungen im Vergleich zum deutschen Recht bieten, nutzbar zu machen. Auch hierfür ist dieses Buch hilfreich.
3
Diese drei oder vier Wege werden im Folgenden für Kauf- und Lieferverträge sowie Vertriebsverträge abgehandelt.
I. Pragmatischer Ansatz: Man nimmt einen deutschen Standardkaufvertrag und wählt am besten deutsches Recht und einen deutschen Gerichtsstand?
1. Innerhalb der EU
1
Der pragmatische Ansatz funktioniert innerhalb der EU recht gut (wenn man das deutsche Recht überhaupt haben möchte – zu Für und Wider und alternativen Überlegungen siehe weiter unten im Text und auch die Tabelle in Rn. 85 sowie die Kapitel zu anderen Rechtsordnungen (siehe unten Kap. E, F und G):
– Eine Rechtswahl ist in der EU weitgehend möglich, wenn es um ein grenzüberschreitendes Geschäft geht. Liegt ein Binnensachverhalt (beide Parteien kommen aus einem Land) vor, kann man zwar anderes Recht wählen, es gelten dann aber auch national zwingende Vorschriften (siehe unten Kap. C Rn. 84).
– Für Kauf- und Liefergeschäfte gelten in der EU nach dem Landesrecht anderer Länder relativ wenige international zwingende Bestimmungen, die auch im grenzüberschreitenden Vertrag eine Rechtswahl zugunsten der Anwendung des deutschen Rechtes aushebeln könnten (siehe unten Kap. C Rn. 128ff.).
– Für internationale Vertriebsverträge hingegen gibt es beachtliche international zwingende Bestimmungen in anderen EU-Ländern (siehe unten Kap. H Rn. 108ff.). Die Rechtsfolgen des deutschen Rechts verstoßen hingegen in anderen EU-Ländern wohl nicht gegen ordre public, sind also durchsetzbar (nicht zu verwechseln mit der Vollstreckbarkeit von Urteilen – dazu sogleich).
– Bei der Wahl des deutschen Rechts erscheint die Wahl eines deutschen Gerichts nicht unzweckmäßig (siehe unten Kap. C Rn. 211ff.); eine Gerichtsstandsvereinbarung ist möglich nach den Formvorschriften der Brüssel Ia- Verordnung oder auch EuGVVO genannt (siehe unten Kap. C Rn. 244ff.). Innerhalb der EU sind deutsche Gerichtsentscheidungen vollstreckbar (siehe unten Kap. C Rn. 223ff. und 333). Auch Schiedsgerichtsabreden sind möglich (siehe unten Kap. D).
– Soll die Wahl deutschen Rechts und die Vereinbarung eines deutschen Gerichts in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Standardverträgen (AGB) erfolgen, müssen diese wirksam einbezogen sein, d.h. nach der Rechtsprechung wahrscheinlich sicherheitshalber beim Vertragsschluss mitgeschickt werden (siehe unten Kap. C Rn. 99). Für die Gerichtsstandsvereinbarung oder Schiedsgerichtsabreden empfiehlt sich eine Unterschrift beider Parteien (siehe unten Kap. C Rn. 273).
– Incoterms® (Ex Works, FOB etc.) funktionieren immer (siehe dazu unten Kap. K).
2. Außerhalb der EU
2
Problematisch ist der pragmatische Ansatz außerhalb der EU, denn dort ist schon die Wahl deutschen Rechts und eines deutschen Gerichtsstandes nicht sicher möglich:
– Vielfach ist gar keine Rechtswahl möglich (siehe unten Kap. C Rn. 185) oder unterliegt gewissen zusätzlichen Voraussetzungen. Ob die Rechtsfolgen des deutschen Rechts in anderen Ländern gegen ordre public verstoßen und damit nicht durchsetzbar sind, ist oft schwer zu sagen – ausgeschlossen ist das aber nicht. Vielfach bestehen auch international zwingende Bestimmungen in Ländern außerhalb der EU (siehe unten Kap. C Rn. 128). Beides (Probleme mit ordre public und zwingenden Bestimmungen) dürfte für Vertriebsverträge (siehe unten Kap. H Rn. 108ff.) wahrscheinlicher sein als für Kauf- und Lieferverträge.
– Teilweise ist auch keine Gerichtsstandsvereinbarung möglich (siehe unten Kap. C Rn. 360ff.) bzw. von besonderen Formvorschriften abhängig.
– Darüber hinaus wäre vielfach die Wahl eines deutschen Gerichtes nicht zweckmäßig, weil deutsche Gerichtsurteile in dem Land des Vertragspartners außerhalb der EU womöglich gar nicht vollstreckbar sind (siehe unten Kap. C Rn. 213); dann drängen sich Schiedsgerichtsabreden auf. Bisweilen sind aber auch Schiedsgerichtsabreden schwierig oder Schiedssprüche im Land des Vertragspartners nicht vollstreckbar (siehe dazu unten Kap. C Rn. 355 und Kap. D).
– AGB sind mit den vorstehend beschriebenen Maßgaben verwendbar, aber bestimmt weniger rechtssicher als individuelle Vereinbarungen.
– Incoterms® (Ex Works, FOB etc.) funktionieren immer (siehe dazu unten Kap. K).
3. Änderungen in der EU-Zugehörigkeit
3
Änderungen im Kreis der EU-Mitgliedstaaten (etwaige Eintritte oder Austritte in die EU/aus der EU, also Exits, „Brexits“, „Grexits“ etc.) kommen selten vor und haben nur mittelbare Auswirkungen auf internationale Kauf- und Lieferverträge bzw. die dazu im Vorfeld angestellten Überlegungen (siehe unten Kap. C Rn. 32). Für die hier erörterten Fragen zu Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarung ist zu beachten, dass die dazu maßgeblichen EU-weit vereinheitlichten Antworten in der Rom I-VO bzw. Brüssel Ia-VO (EuGVVO) zu finden sind (siehe unten Kap. C Rn. 69ff. und 129ff.). Die zeitlichen Anwendungsbereiche sind dabei in der jeweiligen Verordnung selbst festgelegt, und im Falle eines Eintritts weiterer Mitgliedstaaten in die EU braucht es eine entsprechende Erklärung, ab wann die bestehenden Verordnungen auch für diesen Mitgliedstaat gelten; im Falle eines Austritts eines Mitgliedstaates aus der EU braucht es eine völkerrechtliche Regelung, bis wann die entsprechenden Verordnungen für diesen Mitgliedstaat noch gelten. Laut Europäischem Parlament sind vom Austritt Großbritanniens aus der EU 21.000 Regelungen und Gesetze betroffen, die gestrichen oder entsprechend angepasst werden müssen. Das erstreckt sich insbesondere über Bereiche wie das Vertragsrecht, das Arbeitsrecht, das Gesellschaftsrecht, das Markenrecht, den Datenschutz und das Finanzaufsichtsrecht. Für Brexits, Grexits oder Exits gibt es also in der Vertragsgestaltung wenig zu beachten, was Recht und Gericht angeht, wenn die derzeitigen EU- Verordnungen noch einige Zeit gelten. Ob eine jetzt vereinbarte Gerichtsstandsvereinbarung weit in der Zukunft (nach einem etwaigen EU-Austritt) dann noch akzeptiert würde, kann nicht sicher vorhergesagt werden – diese Unsicherheit lässt sich aber auch vertraglich nicht beheben. Hinsichtlich etwaiger weiterer Rechtsfolgen eines Exits (Ein- und/oder Ausfuhrbeschränkungen, Zölle, sonstige Hindernisse) lässt sich vielleicht eine vertragliche Regelung dahingehend fassen, dass sich die Parteien auch für den Fall eines Exits so stellen, wie die Rechtslage vor dem Exit war und/oder wie eine Modifikation und auch Aufhebung der Vertragsbeziehung zwischen den Parteien möglich ist. Veränderungen mit Auswirkungen auf die gegenseitigen Leistungspflichten, wie sie etwa durch einen EU-Exit bewirkt werden, dürften dann vor dem Hintergrund des Stichwortes Wegfall der Geschäftsgrundlage, Hardship, Force Majeure o.Ä. diskutiert werden1 – um solche Unsicherheiten zu vermeiden, lassen sich vielleicht vertragliche Vereinbarungen fruchtbar machen.
4
Der Brexit ganz konkret brachte wenig tiefgreifende Änderungen zu anwendbarem Recht und Rechtswahl, denn die Rom I-VO (siehe dazu unten Kap. C Rn. 68) gilt nach wie vor für die Gerichte in der EU (den verbliebenen 27 Staaten). Zudem hat das Vereinigte Königreich Großbritannien deren Inhalte in nationales IPR-Recht von England und Wales umgesetzt. Die Brüssel Ia-VO oder auch EuGVVO gilt allerdings seit dem 1.1.2021 nicht mehr im Königreich (für bis dahin eingereichte Verfahren soll sie aber weiter gelten); sie wird „ersetzt“ durch den Beitritt Großbritanniens am 28.9.2020 zum Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen (siehe dazu unten Kap. C Rn. 336). Das Lugano-Abkommen gilt allerdings nicht (mehr), solange der beantragte Beitritt des Königreiches dazu nicht erfolgt ist (eine Beitrittserklärung liegt vor).
4. Alternativen zu deutschem Recht und Gericht
5
Möglicherweise besteht bei Geschäften in- und außerhalb der EU die Gelegenheit eines grenzüberschreitenden Sachverhalts zu nutzen, um nichtdeutsches Recht zu wählen. Hierfür gibt es durchaus Gründe:
– Für Kaufverträge „fehlt“ dem Käufer im deutschen Recht (im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen) die verschuldensunabhängige Haftung des Lieferanten. Eine Verschärfung der Haftung ist zumindest in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Standardverträgen nicht möglich (siehe zu Alternativen die Tabelle hier unter Rn. 85 und unten die Kapitel E., F., G. zum UN- Kaufrecht, Schweizer Recht, Common Law.).
– Für Lieferverträge wird im deutschen Recht aus Verkäufersicht der zwingende Rückgriff innerhalb der Lieferkette (im Verbrauchsgüterkauf und seit 1.1.2018 auch im Unternehmenskauf) bemängelt. Außerdem besteht im Falle des Verschuldens eine unbeschränkte Schadensersatzhaftung und eine Beschränkung der Haftung ist zumindest in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Standardverträgen nicht möglich (siehe zu Alternativen die Tabelle hier unter Rn. 85 und unten die Kapitel E., F., G. zum UN-Kaufrecht, Schweizer Recht, Common Law.).
– Für Handelsvertreter gibt es kaum ein günstigeres Recht als das deutsche; die Möglichkeiten für den Prinzipal, von zwingenden Vorschriften (die allerdings aufgrund der EU-Richtlinie EU-weit sehr ähnlich sind) abzuweichen, gibt es nur, wenn der Handelsvertreter außerhalb der EU oder des EWR tätig ist. Modifikationen sind in Standardverträgen allerdings ebenfalls kritisch (siehe unten Kap. H Rn. 8ff.).
– Für Vertragshändlerverträge erscheint die analoge Anwendung des Handelsvertreterrechts durch die deutsche Rechtsprechung nachteilig (zumal dies – anders als beim Handelsvertreter – bereits innerhalb der EU in anderen Ländern günstiger ist). Modifikationen sind in Standardverträgen auch kritisch (siehe unten Kap. H Rn. 29).
– Für Franchiseverträge gilt in Teilen das Gleiche wie für Vertragshändler; die vergleichsweise liberale (weil nicht vorhandene) deutsche Gesetzgebung zu Franchiserechten mag allerdings ein Vorteil sein (siehe unten Kap. H Rn. 48).
6
Oft wird Schweizer Recht in Erwägung gezogen, weil es dort praktisch keine AGB-Kontrolle gibt, sowie das Prinzip der geltungserhaltenden Reduktion gilt und die Vertragsfreiheit regelmäßig als weiter empfunden wird (siehe unten Kap. F). Teilweise kommt auch Common Law in Betracht (siehe unten Kap. G). Natürlich bietet sich, für Kauf- und Lieferverträge, auch das UN- Kaufrecht an (siehe unten Kap. E); idealisierte Kombinationen sind denkbar, bspw. UN-Kaufrecht mit Schweizer Recht oder Ähnliches. Vielleicht kann man auch an Soft Law (also nichtstaatliches Recht) denken (siehe unten Kap. C Rn. 38).
7
Man zieht auch oft in Betracht, ein anderes als ein deutsches Gericht zu wählen; Gründe dafür sind die Vollstreckbarkeit und die Zuständigkeit (siehe unten Kap. C Rn. 213) oder auch gewissen Praktikabilitätsgesichtspunkte (Gericht passt zur Rechtswahl, liegt nahe etc.)
8
Möglicherweise ist man auch mit einer Schiedsgerichtsvereinbarung gut oder besser bedient (als mit der Wahl eines staatlichen Gerichts). Das kann darin begründet liegen, dass Schiedsgerichtsvereinbarungen international eher anerkannt werden als eine Gerichtsstandsvereinbarung (siehe unten Kap. D) und zudem Schiedssprüche besser vollstreckbar sind (siehe unten Kap. C Rn. 355 und Kap. D). Außerdem hat man die Möglichkeit, Schiedsrichter zu wählen, die das gewählte Recht kennen, Erfahrungen in der betreffenden Branche haben oder sonst größeres Vertrauen genießen. Auch Verfahrensabläufe und -kosten können für ein Schiedsgericht sprechen (siehe unten Kap. D).
1 Siehe dazu Rothermel, IHR 2020, 89ff.
II. Frage: Wie komme ich zu meinem Recht?
9
Will ich deutsches Recht oder möchten ich oder mein Vertragspartner ein anderes Recht, stellt sich die Frage, wie man dahin kommt.
1. Kann man wählen?
10
Ja. Vielfach gilt Rechtswahlfreiheit, sog. Parteiautonomie. Für grenzüberschreitende Kauf- und Lieferverträge innerhalb der EU findet sich das in der Rom I- VO (siehe unten Kap. C Rn. 69). Außerhalb der EU ist dies wiederum zu relativieren, weil jedes Land seine eigenen Kollisionsregelungen bzw. sein eigenes internationales Privatrecht hat, das die Frage beantwortet, welches Recht auf grenzüberschreitende Beziehungen zur Anwendung kommt und ob, wie und was man wählen kann (siehe unten Kap. C Rn. 185).
2. Wofür kann man wählen?
11
Die Regelungen zum vertraglichen Schuldverhältnis lassen sich wählen, d.h. die Bestimmungen zum Vertragsschluss (allerdings mit bestimmten Besonderheiten – siehe Kap. C Rn. 79 und 114) und die gegenseitigen Rechte und Pflichten für den Fall, dass das Geschäft funktioniert, sowie für den Fall, dass es nicht funktioniert.
12
Im Grunde ist auch eine Rechtswahl gegenüber Verbrauchern möglich; diese sind aber vielfach in den Gesetzen besonders geschützt, was auch der Rechtswahl Grenzen setzt – darum geht es hier aber nicht (gleiches gilt für Arbeitnehmer, Mieter etc.).
13
Auch für Sachverhalte, die nur in einem Land spielen, ist eine Rechtswahl im Grunde möglich. Allerdings schlagen auf einen solchen sogenannten Binnensachverhalt vielfach schon national zwingende Bestimmungen (zu unterscheiden von den international zwingenden Vorschriften – wie unten) durch (siehe unten Kap. C Rn. 84).
14
Wofür man in der Regel nicht wählen kann, sind Fragen der sog. gesetzlichen Schuldverhältnisse, wie z.B. der unerlaubten Handlung, auch wenn dies inzwischen nach der Rom II-VO in bestimmten Maße innerhalb der EU möglich ist (siehe unten Kap. C Rn. 151).
15
Wofür man ebenfalls nicht wählen kann, sind sog. sachenrechtliche Fragen, also Fragen nach Besitz und Eigentum, weil dies sich nach einem wohl weltweit geltenden Grundsatz (lex rei sitae) nach dem Recht des Landes richtet, in dem sich die Sache befindet (siehe unten Kap. J) – dies ist etwa für den Eigentumsvorbehalt von Bedeutung.
16
Wofür man auch nicht wählen kann, sind Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes (Intellectual Properties), also etwa welches Recht sich auf Verletzungen von Patenten, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder Design sowie Urheberrechten o.Ä. anwenden lässt, weil sich dies nach einem weltweit geltenden Grundsatz nach dem Recht des Landes richtet, für das der Schutz besteht (Schutzlandprinzip); wählen kann man hingegen das Recht für die Fragen, ob und inwiefern gewerbliche Schutzrechte lizenziert werden (Vertragsstatut) (siehe unten Kap. L).
17
Wofür man ebenfalls nicht wählen kann, sind Regelungen zum Schutz des lauteren und freien Wettbewerbs (wie etwa im Kartellrecht); hier gilt das Recht des Landes, dessen Markt betroffen ist (siehe unten Kap. I).
18
Eine Rechtswahl ändert nichts an der Geltung der international zwingenden Bestimmungen. Solche international zwingenden Bestimmungen gelten also (wie der Name schon sagt) immer international zwingend (siehe unten Kap. C Rn. 128). Für Kauf- und Lieferverträge (vor allem solchen, an denen kein Verbraucher beteiligt ist) gibt es innerhalb der EU wohl relativ wenig solcher international zwingenden Bestimmungen – wobei es schwierig ist, diese eindeutig zu identifizieren, da sich dies meist aus der Rechtsprechung ergibt. Im Vertriebsrecht sind hingegen mehr international zwingende Bestimmungen zu finden (siehe unten Kap. H).