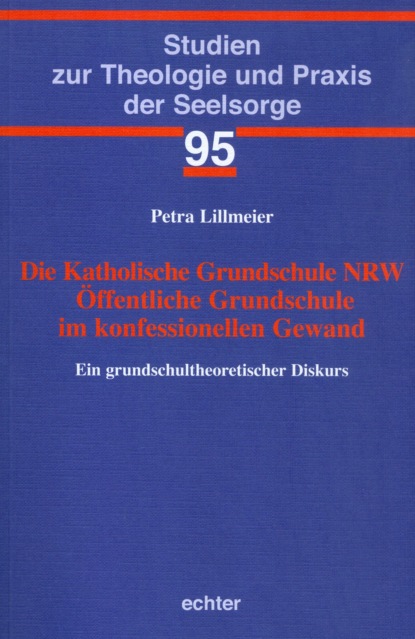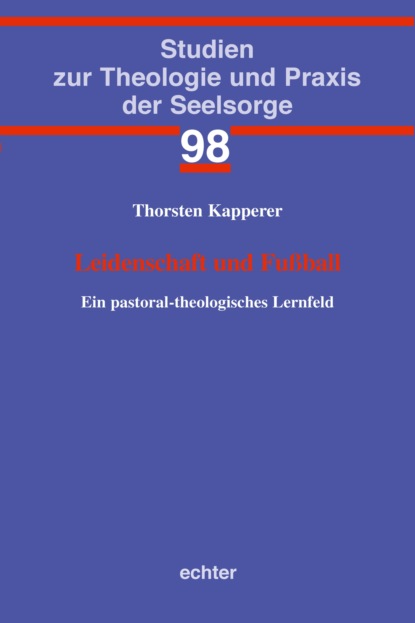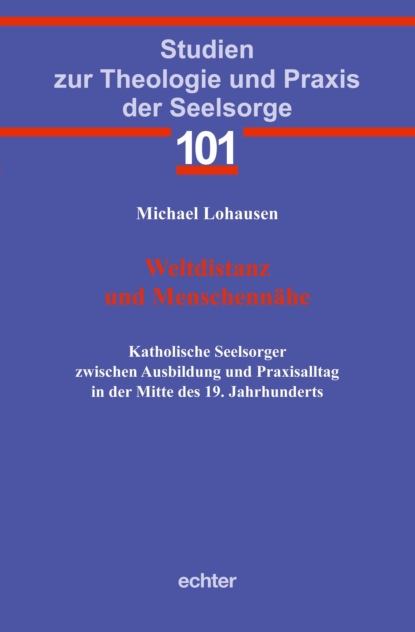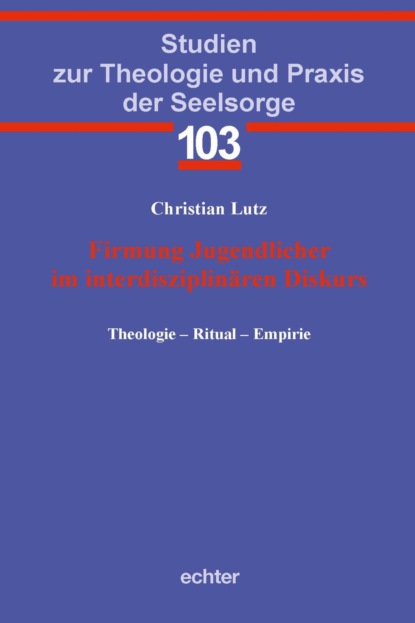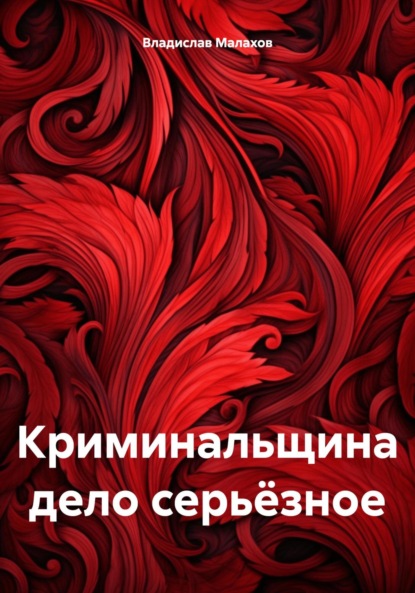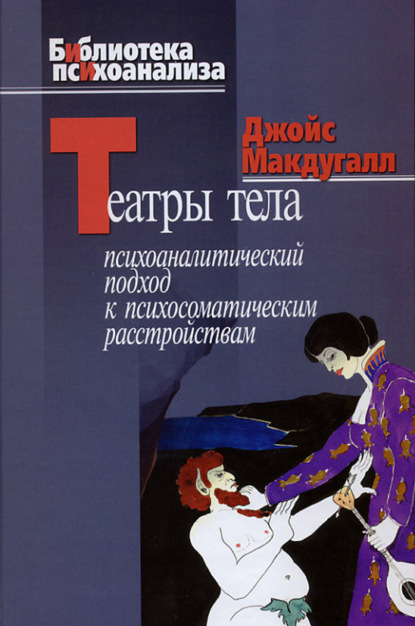Organisationskultur der katholischen Kirche
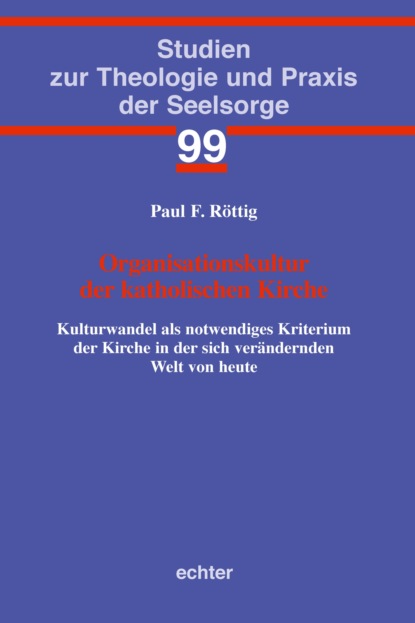
- -
- 100%
- +
(4) Last, but not least: Gibt es eine Roadmap zu einer veränderten Organisationskultur der Kirche? Wie sieht es mit der Fähigkeit, der Bereitschaft und dem Willen zur Veränderung in der Kirche aus? Hat sie die notwendigen Ressourcen zum Wandel? Benötigt sie professionelle Begleitung? Oder genügt die Weihegnade, den Erneuerungsprozess effektiv zu gestalten und das Ziel effizient zu erreichen? Oder braucht eine Organisation wie die Kirche nicht auch persönliche, fachliche und Führungs-Kompetenzen, um ihrem Sendungsauftrag in dieser Welt effizient gerecht zu werden?8
1.2 Methodisches Vorgehen
Ausgehend von dem praktisch-theologischen Ansatz „Sehen – Urteilen – Handeln“ des Begründers der Katholischen Arbeiterjugend Joseph Kardinal Cardijn für seine pastoralen Dienste im Arbeitermilieu, zunächst in Belgien und Frankreich, nach dem II. Weltkrieg dann auch in ganz Europa, wurde dieser so genannte „Dreischritt“ dann auch von Papst Johannes XXIII. in seiner Enzyklika Mater et Magistra (1961) zur methodischen Umsetzung der katholischen Soziallehre aufgegriffen und empfohlen.9
Für die geplante Arbeit soll eine Weiterentwicklung dieser in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts entstandene und pastoral bewährten Methodologie, nämlich der „Vierschritt“ angewandt werden, der dieselbe Logik enthält, aber das ursprüngliche Vorgehen verfeinert:10
(1) Der erste Schritt wird mit dem Begriff Orientierung umschrieben, der vor allem die Erfassung des pluralen Umfeldes, die Kontextualisierung, die Fokussierung auf das Ziel und die Verortung in der kirchlichen Tradition umschließt.
(2) Die Phase des Wahrnehmens, die am ehesten mit der Phase des Sehens im Dreischritt vergleichbar ist, geht allerdings über diese hinaus; denn mag das Sehen noch als neutraler Vorgang eingestuft werden, muss mit dem Wahrnehmen schon eine Deutung und eine Einordnung in die von dem Wahrnehmenden erfahrene Zeit und den ihm bekannten Raum verbunden sein. Dem wahrgenommenen Kairos wird die Frage zugrunde liegen, ob die Kirche sich als Teil der Welt hier und heute sieht, ohne mit der Welt von hier und heute ident zu sein.
Am Ende seines Buchs The Desert is Fertile goss kein Geringerer als Erzbischof Helder Camara diese zweite Phase des „Vierschritts“ in einen einfachen konkreten Satz: „Lasst uns Information über die Situationen zusammentragen, die wir verändern wollen.“11 In Prosa und Lyrik formulierte Camara 1974 in dem kleinen Werk seine tiefste Hoffnung nach Frieden und Gerechtigkeit in der Welt.12 2015 wird Papst Franziskus in seiner Ansprache an die katholischen Bischöfe Armeniens anlässlich des hundertsten Gedenktags des armenischen Genozids im Jahr 1915 seiner pastoral orientierten, jesuitischen Spiritualität gerecht, wenn er diese ermahnt, die Realität mit neuen Augen lesen zu lernen.13 Es geht ihm dabei um das persönliche Bemühen, die Realität von gestern mit den eigenen Augen in die konkrete Wirklichkeit von heute zu übersetzen.
(3) Der dritte methodische Schritt, d.h. die kriteriologische Phase des Deutens und Bewertens der in den ersten beiden Schritten erfahrenen und analysierten Zeichen des Raumes und der Zeit, soll einen Diskurs eröffnen, der das Wahrgenommene sowohl soziologisch, organisationspsychologisch als auch theologisch und hier vor allem praktisch-theologisch, d.h. disziplinär übergreifend analysiert. Keine Einzelwissenschaft, sondern vielmehr bunt zusammengesetzte Teams von Wissenschaftlern sind heute nicht nur im profanen, sondern auch im theologischen Umfeld gefragt, um den Herausforderungen unserer komplexer werdenden Realität glaubhaft entgegentreten zu können. Letztlich wird in diesem Schritt zu konkretisieren sein, ob die Kirche ganzheitlich zielorientiert denkt und handelt.
(4) Die unterschiedlichen Handlungsoptionen, die Kluft der von Jesus Christus „gemeinten“ und der nach zweitausend Jahren in der Kirche verstandenen oder missverstandenen Organisationskultur zu überbrücken wird Moment des letzten der vier methodischen Schritte sein. Hier darf und kann nicht der Fehler gemacht werden, wie er oft in weltlichen Organisationen erfahren wird, nämlich bei der theoretischen Analyse eines Problems oder einer Herausforderung stehenzubleiben, ohne den Mut aufzubringen, der Erkenntnis auch Taten folgen zu lassen.
Erfahrungsgemäß gewinnen diese vier Schritte nicht an Systematik und Wissenschaftlichkeit, wenn sie klinisch sauber auseinandergepflückt werden. So würde eine Erkenntnis im kriteriologischen Schritt nichts bringen, wenn die Möglichkeit des Handelns apriori weder für möglich gehalten noch angedacht werden darf.
1.3 Arbeitshypothesen
Die fünf Hypothesen, von denen die Arbeit ausgeht, sollen systematisch wissenschaftlich hinterfragt, bestätigt oder – wenn nachweisbar – auch widerlegt werden.
(1) Zunächst geht es um die Wirkung, die eine bestimmte Organisationskultur auf die beiden anderen Vollzugselemente einer Organisation, nämlich die Strategie und die Struktur der Institution, ausübt. Aus dem speziellen Blickwinkel der kirchlichen Organisation werden demnach sowohl die pastoralen Wege und Ziele als auch die Strukturen der Kirche von der organisationskulturellen Orientierung beeinflusst – erste Arbeitshypothese.
(2) Restrukturierungprozesse in der Wirtschaft starten häufig mit der Neuausrichtung der strategischen Vision und mit der Struktur der Organisation, denen dann aber auch die Re-Adjustierung der Unternehmenskultur folgen muss. Sollten jedoch Mitarbeiter nicht die richtigen Kompetenzen für diese veränderten Strukturen mitbringen, kommt es in der Regel zu einem right sizing, einem Prozess, in dem Mitarbeiter einfach „ausgetauscht“ werden. Die Realität der Kirche aber lässt einen solchen Prozess aufgrund der Personalknappheit geweihter Seelsorger (zumindest in Europa und den beiden Amerika) nicht zu. Daraus folgert die zweite Arbeitshypothese, dass ein erfolgreicher Erneuerungsprozess in der Kirche immer mit der Erneuerung der Organisationskultur beginnen muss, bevor Strukturveränderungen vorgenommen werden können.
(3) Im empirischen Teil der Arbeit soll mit der systematischen Analyse der Einstellung „kirchennaher“ Gläubiger aus den zwei österreichischen Diözesen Wien und Eisenstadt die Hypothese der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, der ersehnten Soll- und der tatsächlichen Ist-Situation dokumentiert werden.
(4) Als logische Konsequenz der Analyse der Organisationskultur, die mit dem organisatorischen Ziel und der bestmöglichen Struktur den eigentlichen Organisationsvollzug (erste Hypothese) mitgestaltet, und dem Auseinanderklaffen von organisationskulturellem Ist und Soll (zweite Hypothese) stellt sich die Frage nach Fähigkeit (Können) und Bereitschaft (Wollen), notwendige Veränderungen durchzuführen. Kann die Hypothese, dass das Zusammenspiel von Wandlungsfähigkeit und -bereitschaft auf unterschiedlichen Sendungsebenen der Kirche auch unterschiedlich zu Tage tritt, auf Grund empirischer Daten untermauert werden?
(5) Basierend auf den langjährigen Erfahrungen in der Wirtschaft kann angenommen werden, dass Veränderungen in der Organisationskultur der Kirche noch mehr Zeit und professioneller Begleitung als säkulare Unternehmen bedürfen. Als wesentlicher Grund dafür kann die seit 2000 Jahren unveränderte, wenn auch nicht immer und überall voll artikulierte und akzeptierte pastorale „Mission“ der Kirche verstanden werden.
1.4 Struktureller Aufbau
Vorwort und Hinführung fokussieren auf den situativen Gegebenheiten und gesellschaftlichen Zusammenhängen, die die Frage der Unternehmenskultur in wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, sozialen und politischen Institutionen zum Thema ihres Denkens, Sprechens und Handelns machen. Die Schwerpunkte der Arbeit sind in sechs Kapitel (Kap. 2 bis 7) gefasst:
(1) Aus der Vielfalt nicht-kirchlicher Ansätze ergibt sich die Notwendigkeit einer begrifflichen Definition und Interpretation des Begriffs „Organisationskultur“ in der und für die Kirche und in den und für die auf sie zugeordneten Institutionen.
(2) Die mit der Wahl des neuen Bischofs von Rom am 13. März 2013 fast über Nacht einsetzende pastorale Neuakzentuierung der Kirche, die seither die Einstellung zur Kirche (von innen und von außen her), vielfach jedoch noch nicht das Verhalten der Mitglieder des Volkes Gottes verändert hat, drängt nach dem Sichtbarmachen der Zeichen der Zeit, die der Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zwar stets begegnet sind, die jedoch nicht von ihr im allgemeinen Sinn des Wortes, d.h. in ihrer Katholizität im Licht des Evangeliums erforscht und gedeutet wurden (GS 4).
(3) In der nahen Vergangenheit ist nicht zu übersehen gewesen, dass sich kritische Stimmen in der Kirche meistens mit strukturellen Fragen beschäftigt haben und noch immer beschäftigen, die organisationskulturellen Fragen, das heißt verkürzt definiert das wertgeleitete Verhalten und Handeln aller Mitglieder des Volkes Gottes hier auf Erden, jedoch oft gar nicht angesprochen haben. Strategien und Strukturen einer Organisation müssen als organisationskulturelle Interdependenzen gesehen werden, was nichts anderes bedeutet, als dass die Organisationskultur einen direkten Einfluss auf Struktur und Strategie einer Institution hat – und natürlich vice versa. Dieses Kapitel wird versuchen, diese Interdependenzen zwischen Strategie, Struktur und Kultur im kirchlichen Bereich zu definieren, ohne die Strukturdiskussion zum eigentlichen Thema der Arbeit zu machen. Allerdings kann die Konvergenz der drei Organisationselemente menschlicher Zusammenarbeit (Strategie, Struktur und Kultur) nicht außer Acht gelassen werden. Der tiefgehende Wandel der Situation, wie er in Gaudium et spes angesprochen wird (GS 5) und der unter anderem im Wandel der gesellschaftlichen Werte, der Technologie, Demographie, Wirtschaft, Politik, Gesetzgebung und vielem mehr seinen Ausdruck findet, bedingt die Notwendigkeit einer ständigen Neu-Adjustierung der komplexen Organisationssteuerung.
(4) Die konkreten Elemente des organisationskulturellen Profils eines Unternehmens oder einer Institution – und somit auch der Kirche – sind horizontal sowie vertikal vielschichtig; in anderen Worten: Sie umfassen, wie schon oben erwähnt, die Gesamtheit der nach innen und außen hin sicht- und greifbaren, jedoch oft unreflektierten und unbewussten Denk-, Verhaltens- und Handlungsweisen aller Mitglieder der Kirche und können diese innerhalb ihrer eigenen Grenzen in extremen Divergenzen verwirklichen, was auch an Hand zweier diözesaner Organisationen empirisch aufgezeigt werden soll.
Das Profil der Unternehmenskultur umschließt soziale Dimensionen wie Steuerung, Kommunikation, Leistungsorientierung, Vertrauen, Entwicklung und Identität der Organisation nach innen und außen hin. Als einzige dieser sechs Organisationsdimensionen seien hier beispielshaft die Extreme im Kommunikationsverhalten einer Organisation und somit auch der Kirche oder den ihr zugeordneten Institutionen erläutert:
a. In einer eher geschlossenen Organisationskultur werden solche Persönlichkeitstypen favorisiert, die Standpunkte und Kommunikationsstile in kirchlicher Linientreue signalisieren. Die Verwaltung der Organisation erhält einen höheren Stellenwert als ihr inneres Wachstum.
b. Andrerseits wird in Organisationen mit einem offenen Kommunikationsstil die Diversität von Mitarbeitern mit eigenen Meinungen und Überzeugungen gefördert; neue Mitarbeiter fühlen sich sehr schnell wohl, engagieren sich voll und begleiten die Organisation mit ihrer Kreativität und Innovation auf dem Weg in die Zukunft.
(5) Mit diesem Ansatz ist beabsichtigt, die Hypothese des Auseinanderklaffens von tatsächlicher und angestrebter Organisationskultur, das heißt der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit praktisch zu untermauern.
(6) Um der methodischen Vorgangsweise des „Vierschritts“ (Orientieren – Wahrnehmen – Bewerten – Handeln) gerecht zu werden müssen letztlich sowohl die Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft als auch die praktischen Umsetzungschancen in den pastoralen und administrativen Tätigkeitsbereichen der Kirche in Form einer möglichen Roadmap der Erneuerung angezeigt werden. Nach der begrifflichen Klärung und der praktisch-empirischen Diagnose geht es zuletzt um die kritische Frage, wie die Kirche als pilgerndes Volk Gottes mit den Erkenntnissen über Anspruch und Wirklichkeit des gemeinsamen Wegs durch Raum und Zeit umgeht.
Mit einem Resümee und einem Ausblick vor allem auf die vom derzeitigen Pontifikat initiierten Veränderungsprozesse sollen sowohl das ekklesiologische Bild der ecclesia semper reformanda als auch die pastoralen Praktiken einer ecclesia discens (einer lernenden Kirche) gefestigt werden.
1.5 Thematische Hinführung
Wie das korporative Volk Gottes, das heißt die Kirche als organisatorische Einheit in ihrer ganzen Komplexität, und das kollektive Volk Gottes, das heißt die Kirche als Kollektive der einzelnen Ortskirchen und ihrer individuellen Mitglieder ineinander greifen, miteinander umgehen und für einander da sind, wird schon in ihren ersten Anfängen sichtbar. Beim Apostelkonzil von Jerusalem (zwischen 44 und 49), der Zusammenkunft der Apostel der Jerusalemer Urgemeinde mit Paulus von Tarsos und seinen Begleitern, in der es letztlich um die Identität der Kirche Christi der Heiligen und die Gemeinden im jüdischen und griechischen Umfeld ging (Apg 15,1-35), wird die Spannung zwischen dem korporativen und dem kollektiven Ganzen der Kirche ihres einen Hauptes Jesus Christus sichtbar (Kol 1,18). Diese Aktualität hat sich durch zwei Jahrtausende hindurch nicht geändert, vor allem in den regionalen Synoden und den einundzwanzig ökumenischen Konzilien der katholischen Kirche. So hat die Diskussion um die Hermeneutik des Zweiten Vatikanums14 bis in die Gegenwart herauf zwischen restaurativen und „liberaleren“ Theologen Gräben aufgerissen, die die Kirche als korporatives und als kollektives Gottesvolk spaltet. Die einen, vor allem die „Massenmedien und auch ein […] Teil […] der modernen Theologie“, verteidigen die „Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches“, die anderen sprechen von einer „‚Hermeneutik der Reform‘, der Erneuerung des einen Subjekts Kirche, die der Herr uns geschenkt hat, unter Wahrung der Kontinuität“.15 Die Substanz bleibt unverändert, weil ihre Identität in ihrem Gründer wurzelt. Die Art und Weise der Erkenntnis, wie diese Substanz zu den Menschen in die konkrete Welt hineingetragen wird, ist jedoch sowohl räumlich als auch zeitlich kulturell bestimmt. Die Stärkung des kollektiven Aspekts des Volkes Gottes, vor allem durch die Betonung der Rolle des Bischofskollegiums und die Ermächtigung der „Laien“ aufgrund ihrer Taufe in der Kirchenkonstitution Lumen gentium, wird auch von der Festigung der Würde des Menschen und seiner Selbstbestätigung nach den Gräueln des Zweiten Weltkriegs begleitet und bedeutet einen organisationskulturellen Wandel, wie das ganze korporative Volk Gottes, durch Raum und Zeit wandernd, sein Ziel in Zukunft erreichen sollte. Allerdings erlebte diese im Frühchristentum verwurzelte und nun erneuerte Vision der Kirche in den Jahrzehnten nach dem Konzil bittere Enttäuschungen über das von den Konzilssynodalen Formulierte und das von der Kirchenbasis Erhoffte. Somit bleibt die Thematik der Organisationskultur der Kirche auch heute brennende Aktualität.
1.5.1 Praktisch-theologischer Ansatz
Mit dem Blick auf die eigentliche Thematik der Studie, nämlich der Organisationskultur, muss trotz des Bezugs auf die Kirche mit Recht nach ihrem theologischen Charakteristikum gefragt werden. Als „zugleich ‚sichtbare Versammlung und geistliche Gemeinschaft“‘ (LG 8; zitiert in GS 40) geht die Kirche „den Weg mit der ganzen Menschheit gemeinsam und erfährt das gleiche irdische Geschick mit der Welt und ist gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der in Christus zu erneuernden und in die Familie Gottes umzugestaltenden menschlichen Gesellschaft“ (GS 40). Auch wenn die „sichtbare Versammlung“ der Kirche in dieser Arbeit mit organisationspsychologischen Konzepten analysiert und mit systemischen Prämissen verglichen werden soll, kann sie als „irdisches und himmlisches Gemeinwesen […] nur in dem Glauben begriffen werden“ (GS 40), dass es in ihr um den Weg aller Menschen zum Ziel der Vereinigung mit Gott geht, der sie zugleich trotz ihrer Sündhaftigkeit ohne Wenn und Aber auf ihrem Pilgerweg begleitet. Im jesuanischen Kontext des Neuen Bundes mündet die Frage nach der Kultur der Kirche in der bedingungslosen Nachfolge Christi, der ihr in ihrem „Ineinander des irdischen und himmlischen Gemeinwesens“ (GS 40) mit seiner Geburt, seinem Leben und Wirken, seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferweckung Beispiel und Anregung für ihre missionarische Sendung gegeben hat. Die Väter des Konzils sprechen im ersten Kapitel von Lumen gentium, der „Dogmatischen Konstitution über die Kirche“, vom Mysterium, dem Geheimnis der Kirche, an dessen Grenzen wir so lange stoßen, solange wir an unsere irdische Geschichtlichkeit gebunden sind.
Nach dem „Weltbild Gottes“, das die Rolle des Schöpfergottes und alles von ihm Geschaffene aufeinander bezieht, ist alles Irdische vergänglich, auch die „sichtbare Versammlung“ der Kirche. Der Vergänglichkeit kirchlicher Strukturen, auch wenn diese von Jesus selbst durch sein Leben hier auf Erden initiiert wurden, liegt zugleich die Bedingung ständigen Wandels zugrunde. Die ecclesia semper reformanda weist auf keinen Zu- oder Unfall hin, sondern auf das im Gottes- und Menschenbild verwurzelte Kirchenbild, das das 2. Vatikanische Konzil (wieder) sichtbar gemacht hat. Die menschliche Gesellschaft, die in der Kirche mit der Gnade Gottes aufs engste verwoben und von ihr befruchtet wird, unterliegt einer ständigen Umgestaltung; freilich nicht um ihrer selbst, sondern in Christus und um Christi willen (GS 40).
Das theologische Gerüst der vorliegenden Studie über die Kultur der Kirche wird auch in den Quellen jesuanischen Handelns und christlicher Werte deutlich, die dem Volk Gottes auf seiner Pilgerschaft durch Raum und Zeit Wegweiser und „den am Rand lebenden Völkern“ ein spiritueller Kompass sein sollten. Kultur basiert immer auf einem ererbten geistigen oder materiellen Gut, das dazu beitragen kann und soll, aus dem Wissen um erprobte Entscheidungen in der Vergangenheit Lösungen für zukünftige Lebenssituationen aktiv zu gestalten, nicht jedoch passiv, d.h. fraglos zu übernehmen.
Aktivitäten, die auf strukturelle Umgestaltungen kirchlicher Organisationseinheiten abzielen, mögen zwar Einfluss auf die Organisationskultur der Kirche oder kirchennaher Institutionen haben, werden allerdings nicht direkt Gegenstand dieser Untersuchungen sein. Im Kapitel 4 über organisationskulturelle Interdependenzen wird des Näheren auf die gegenseitige Beeinflussung bzw. das Zusammenspiel von Strategie, Struktur und Kultur einer Organisation eingegangen, die im Kern auch die Kirche betreffen. So griff die internationale Presse im November 2007 hastig die Meldung auf, dass Papst Benedikt XVI. ein Bonussystem für exzellente Leistung seiner vatikanischen Mitarbeiter sanktioniert hat. Eine Neugestaltung der Vergütungsstruktur zu verkünden ohne entsprechende Begleitmaßnahmen einer Effizienzsteigerung in der administrativen oder pastoralen (Mit-)Arbeit der vatikanischen Kurie anzudenken kann letztlich nur zu einer Verfestigung der althergebrachten Strukturen – allerdings mit erhöhten Kosten – führen.16
Auch die interne Redaktion pastoraler Leitbilder für Diözesen, Ordinariate, Ordensgemeinschaften, kirchliche Krankenhäuser oder Schulen etc. sind gut gemeinte Bemühungen um mehr Engagement für die Organisation und um eine tiefere Identifikation mit den Zielen, allerdings nur so lange und dann, wenn solche Leitbilder nicht von anderen Organisationen einfach kopiert wurden und somit eher schnell wieder in den Schreibtischladen verstaubten, da ihnen der Konnex zur tatsächlich gelebten Kultur fehlte, in anderen Worten, weil den (mit)arbeitenden Menschen die übernommenen Denk-, Verhaltens- und Handlungsweisen ohne Erklärung, professionelle Begründung und didaktische Hinführung strittig gemacht wurden. In Bezug auf die von Benedikt XVI. geplanten Reformen fanden kritische Medien eher Spott, weil die betroffenen Personen – vom Gärtner bis zum Kurienkardinal – trotz der Veränderungen von Strukturen ihre Arbeitsweise nicht zu ändern beabsichtigten.17 Leitbilder werden schnell zu „Leidbildern“, wenn sie zwar schriftlich festgehalten sind, aber nicht gelebt werden oder Veränderungswille und Veränderungsbereitschaft nicht vorhanden sind.
Demographische Veränderungen in der Welt machen auch vor den Türen der Kirche nicht Halt. Auswirkungen auf allen Ebenen der Verwaltung und Pastoral der Kirche, von der römischen Kurie bis in die kleinste Pfarrgemeinde, rufen nach einem grundlegenden Wandel, wie sich Kirche in der heterogener sich gestaltenden Welt von morgen als Communio auf dem gemeinsamen Pilgerweg zum Ziel hin identifizieren und glaubhaft manifestieren kann. Zunehmender Priestermangel, nicht in allen, aber in vielen Teilen der Welt; weniger Glaubende in den Kirchen; getaufte Kinder und Jugendliche ohne Verständnis ihrer missionarischen Sendung; alte und einsame Menschen, an denen Seelsorger vorbeigehen; Frauen und Männer, die in ihrer Ehe scheiterten; Migranten und Flüchtlinge; Drogensüchtige und Terroristen … Dieses soziale und sozialpsychologische Szenario des beginnenden dritten Jahrtausends verlangt nach neuen Ansätzen eines gemeinsamen Vorwärtsgehens aller Menschen guten Willens mehr als nach neuen Strukturen. Denn veränderte Strukturen, ohne dass diese von veränderten Menschen getragen werden, gleichen einem Haus ohne Fenster und Türen, durch die es von seinen Bewohnern betreten und bewohnt werden kann.
Die vielleicht am unmittelbarsten erlebte praktisch-theologische Herausforderung in vielen, nicht allen Teilen der Weltkirche ist der Trend zu größeren Pastoral- und Seelsorgeräumen, die von allen Betroffenen, d.h. den pastoralen und administrativen Kräften sowie den Glaubenden, mehr Professionalität, Teamfähigkeit und -bereitschaft verlangen. Wollen die Kirche und ihre kirchennahen Institutionen nicht wie viele profit-orientierte Unternehmen in das menschliche Abseits von Überforderung, Stress und Burnout geraten, wird es eines neuen „psychologischen Arbeitsvertrags“ für jene bedürfen, die ihre Arbeitskraft haupt- oder auch nebenamtlich in die Hände der Kirche legen.
1.5.2 Anthropologisch-biblischer Ansatz
In Verbum Domini, dem von Benedikt XVI. verfassten „Nachsynodalen Apostolischen Schreiben“ vom 30. September 2010, reflektiert der Papst die Ergebnisse der 12. Ordentlichen Bischofssynode, die vom 5. bis 23. Oktober 2008 zum Thema „über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche“18 in Rom tagte. In dieser päpstlichen Exhortatio weist Benedikt auf die „Bibel als großen Kodex für die Kultur“19 hin, wobei er hier selbstverständlich primär den „Wert der [nationalen] Kultur für das Leben des Menschen“20 anspricht.
Da eine Organisationskultur – auch die der Kirche – nicht losgelöst von der nationalen Kultur gedacht werden kann, in die sie eingebettet ist und aus der heraus sie lebt, haben sich die Synodenväter für ihre kirchliche Zusammenarbeit bewusst oder unbewusst ein hohes Ziel gesetzt. Sie fordern „unter den Kulturträgern eine angemessene Bibelkenntnis […], auch in säkularisierten Umfeldern und unter den Nichtgläubigen; in der Heiligen Schrift sind anthropologische und philosophische Werte enthalten, die die ganze Menschheit positiv beeinflusst haben.“21 Unter „Kulturträger“ müssen wohl Führungspersönlichkeiten verstanden werden, zu denen sich die Synodenmitglieder als Vertreter des Weltepiskopats auch selbst zuzuordnen haben. Die Kenntnis der biblischen Werte wird somit Vorausbedingung und Fundament „der Begegnung zwischen Wort Gottes und Kulturen“.22
Mit Fug und Recht darf erwähnt werden, dass wohl kein anderes Dokument ein profunderes Bild der anthropologisch-biblischen Dimension der Kirche in der Welt – und darum geht es ja letztlich, wenn die Organisationskultur der Kirche fokussiert wird – zeichnet als die „Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute“. Dem ersten Hauptteil von Gaudium et spes liegt in 4 Kapiteln mit insgesamt 35 Artikeln die Berufung des Menschen, der in diese konkrete Welt hineingeboren ist, in der Kirche von heute zugrunde. Da sich insbesondere diese Pastoralkonstitution nicht nur an die Kinder der Kirche, sondern an alle Menschen richtet (GS 2), nimmt ganz bewusst erst das vierte und letzte Kapitel Bezug auf die Aufgabe der Kirche in der Welt von heute.23 In der Einleitung zum eigentlichen Text der Konstitution weisen Karl Rahner und Herbert Vorgrimler darauf hin, dass die Konzilsväter ganz bewusst einer Situations- oder Auffassungsanalyse zunächst eine Bewertung aus dem allgemeinen menschlichen Blickwinkel folgen lassen, die für alle Menschen akzeptabel erscheint, bevor sie sich mit speziellen lehramtlichen Instrumentarien den möglichen Konsequenzen für das Leben in und mit der Kirche zuwenden. Gegen diesen in vielen Kapiteln und Artikeln von Gaudium et spes angewandten Prozess wehrte sich so mancher Bischof, der eher eine theologische Analyse oder (zumindest) einen biblischen Bezugspunkt bevorzugt hätte.24