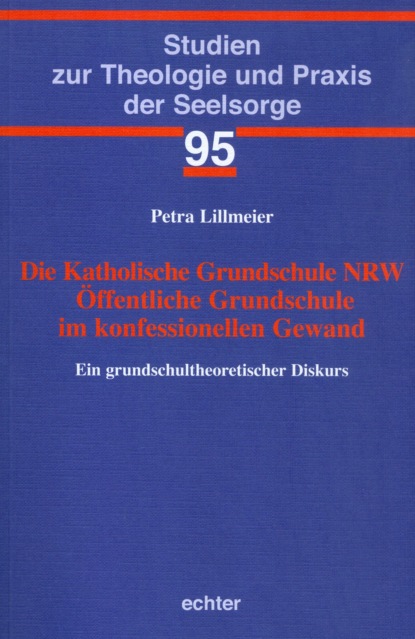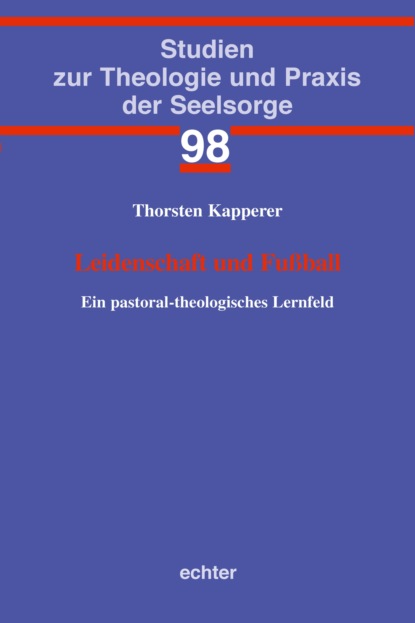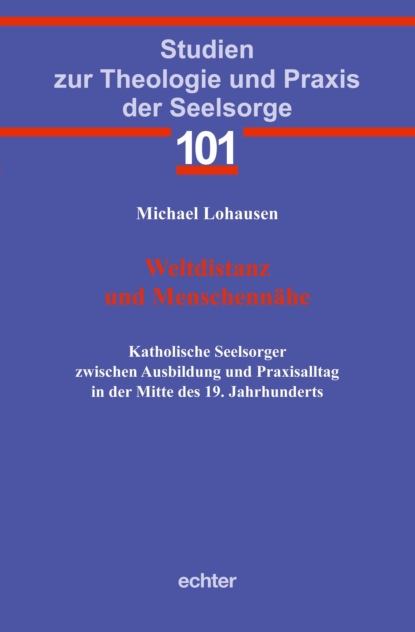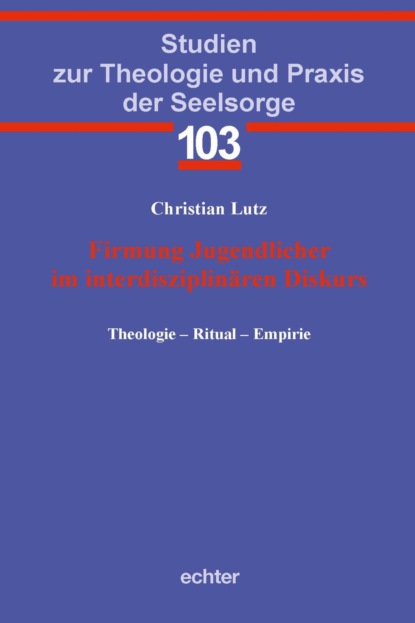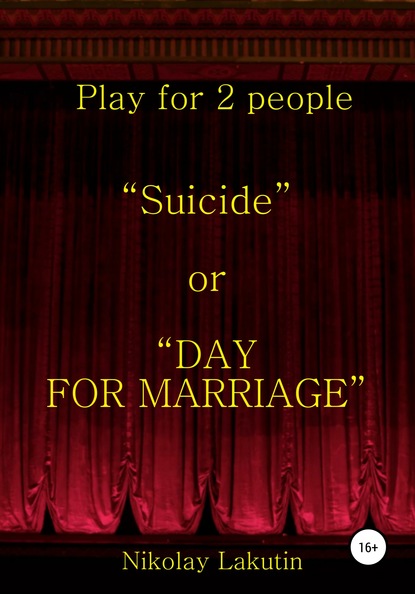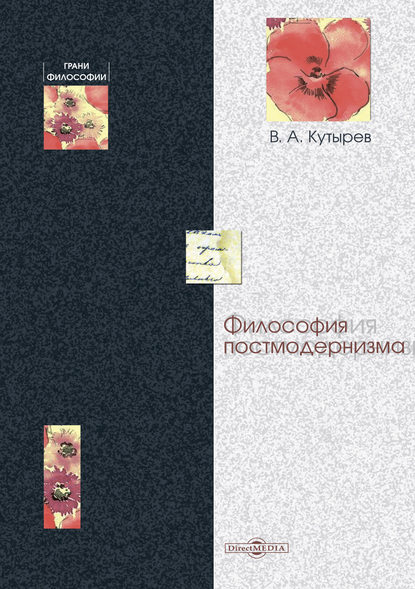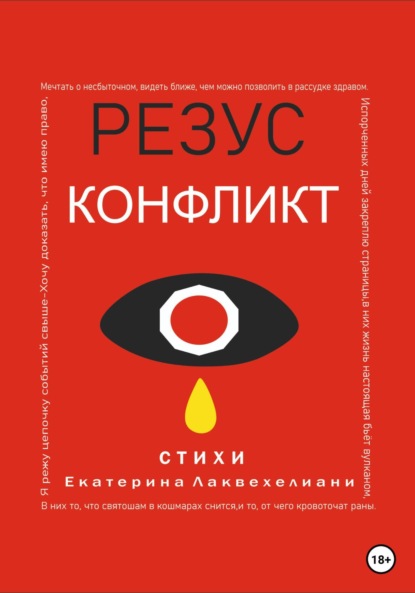Organisationskultur der katholischen Kirche
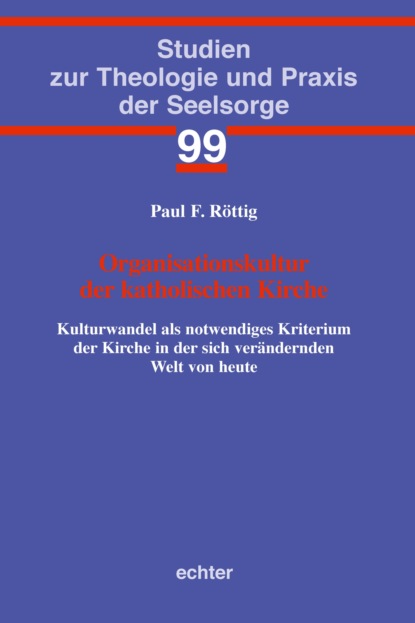
- -
- 100%
- +
In der Kirche muss eine mutige Freiheit der Rede vorausgesetzt werden, damit sie sich nicht „im Geist des theologischen Narzissmus“ um sich selbst dreht und so nicht aus sich selbst herausgehen kann. Auch vier Jahre nach dem Beginn seines Pontifikats ist von seiner Überzeugung der freien Meinungsäußerung kein noch so kleiner Abstrich zu bemerken. Im Gegenteil, besonders eher traditionelle kirchliche Kreise kritisieren den Stil der offenen Rede innerhalb des Bischofskollegiums genauso wie die oft sehr spontanen Äußerungen, Bonmots und „flapsigen Bemerkungen“156 von Franziskus. Der emeritierte Kardinal Francis George von Chicago drückt die Einzigartigkeit des Papstes mit den Worten „He is free“ aus und macht ihn so ohne Zweifel zu einem „Hoffnungsträger für viele Menschen in unterschiedlichen Welten und Kulturen“.157
Im Vorkonklave erwähnt Kardinal Bergoglio Jesus, der vor der Türe steht und anklopft (Offb 3,20), aber er meint auch, dass Jesus oft ebenso „von innen klopft“, weil er aus der „egozentrischen Kirche […] nach außen treten“ möchte. Eine solche Kirche dreht sich um sich selbst und meint, dass sie selbst Licht ist. Dieses „schreckliche Übel“ nennt der Kardinal „geistliche Mondänität“ in einer Kirche, in der „die einen die anderen beweihräuchern“.158 Danach spricht er ganz kurz über das Anforderungsprofil des nächsten Papstes, zu dem er einige Tage später selbst gewählt wurde:159
Was den nächsten Papst angeht: (Es soll ein Mann sein) der aus der Betrachtung Jesu Christi und aus der Anbetung Jesu Christi der Kirche hilft, an die existentiellen Enden der Erde zu gehen, der ihr hilft, die fruchtbare Mutter zu sein, die aus der ‚süßen und tröstenden Freude der Verkündigung‘ lebt.
Abschließend stellt Kardinal Bergoglio die zwei gegensätzlichen Kirchenbilder gegenüber und lässt keinen Zweifel daran, welchen Weg er für den einzig gangbaren hält: „die verkündende Kirche, die aus sich selbst herausgeht, die das ‚Wort Gottes ehrfürchtig vernimmt und getreu verkündet‘, und die mondäne Kirche, die in sich, von sich und für sich lebt“. Dem in die Zukunft blickenden Kardinal ging es im Vorkonklave nicht um seine Person, sondern um Veränderungen und Reformen in der Kirche mit dem klaren Ziel der „Rettung der Seelen“.160
Das Antlitz der Kirche, wie es den Konzilsvätern in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgeleuchtet hat, das dann jedoch immer mehr verblasste, hat sich mit der Wahl von Jorge Mario Kardinal Bergoglio am 13. Februar 2013 schlagartig geändert. Im Scheinwerferlicht der kirchennahen und kirchenkritischen Medien tritt sie nicht mehr unbedingt als triumphale Kirche auf, sondern als Kirche der Bescheidenheit, Einfachheit und Transparenz; als Kirche mit der pastoralen Fähigkeit, Menschen an die Hand zu nehmen und sie auf dem gemeinsamen Weg zu begleiten; als Kirche mit der Fähigkeit und dem Willen, Menschen und nicht nur Katholiken zuzuhören; als Kirche, die arm sein möchte unter Armen; als Kirche des einen Gottes, der ein Gott der Überraschungen ist.161 Manche Medienstimmen bezeugen Papst Franziskus auch, dass er uns die Kirche zurückgebracht hätte,162 und meinen damit offensichtlich, dass wir nach so einigen Ab-, Um- und Irrwegen in den vergangenen 2000 Jahren die ursprüngliche Vision Jesu und seiner jungen Kirche wieder entdecken dürfen, ohne sich allerdings auf diesem Weg zurück zu den Quellen in einen kirchen-zentrischen Kokon zurückzuziehen.
Die Kirche, die Franziskus mit seinen Worten, Gesten und Taten verkündet, ist eine Kirche der unermüdlichen „Dynamik des ‚Aufbruchs‘“ (EG 29). Gott ist der, der den Gläubigen bewegen will, der ihn sendet, und der sich dann mit ihm auch auf den Weg macht. Gott ist nicht der, der die Initiative ergreift, den Menschen dann aber allein auf den Weg schickt. Der missionarische „Aufbruch“, zu dem Gott alle Gläubigen ruft, ist nicht eine individuelle Expeditionins Ungewisse, sondern „stellt sich wesentlich als missionarische Communio dar“.163
Die Dynamik des durch Zeit und Raum wandernden Volkes Gottes beschreibt Franziskus mit fünf Verben, also Worten, die menschliche Aktivität ausdrücken: Initiative ergreifen und auf den anderen zugehen, sich einbringen und den Fremden mit einbeziehen, die Menschheit in allen Lebenssituationen begleiten, Frucht bringen, auch wenn Unkraut aufkeimt, und jeden kleinen Erfolg gemeinsam feiern (EG 24). Wenn Staaten, Gesellschaften oder Organisationen ihren Lebensraum behaupten wollen und ihren Weg in die Zukunft einfrieren, dann hemmen sie menschliche und soziale Reifung.164 Analog gilt das auch für eine Kirche, die ihr im Raum der Tradition Erworbenes nicht überdenken möchte und den Blick in die Zukunft gar nicht wagt. In der menschlichen Gesellschaft gebiert das Einfrieren von Raum und Zeit Krieg,165 in der Kirche wächst in einem solchen Szenario der Bewegungslosigkeit Unfriede zwischen Schwestern und Brüdern der gleichen Familien.
Papst Franziskus verwendet für seine Kirche kräftige Worte, die sowohl von den Medien als auch von den Menschen inner- und außerhalb der kirchlichen Communio eher verstanden werden als manche Fachsprache der Theologen oder die teilweise unverständliche Sprache liturgischer Bücher. Er spricht vom „Geruch der Schafe“ (EG 24), den die Evangelisierenden an sich haben sollen. Dieser Geruch der Hirten macht die Schafe zu Auf-sie-Hörenden, zu Ihnen Folgenden, zu Sie-riechen-Wollenden.
Die Klage vieler Glaubenden über die schwindende Zahl der Kirchenbesucher muss den Schluss zulassen, dass die Menschen für die Kirche da sein müssten, und nicht die Kirche für die Menschen.166 Dem bisweilen auch von Bischöfen vorgebrachten Argument, dass die Anzahl der Priester für die wenigen Glaubenden so und so genug sei, fehlt ebenso die evangelisierende Dynamik, die von der Kirche gefordert wird (EG 27):
Ich [Papst Franziskus] träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient.
Am Beginn der vorösterlichen Bußzeit 2015 zog sich Papst Franziskus mit 70 Kurienmitarbeitern zu Exerzitien nach Ariccia in die Nähe Roms zurück. Am vierten Tag der geistlichen Übungen meldete sich Pater Diego Fares, ein argentinischer Jesuit, im Radio Vatikan über seinen geistlichen Lehrer und Mitbruder im Petrusamt zu Wort. In dem Interview nannte er Franziskus einen „Meister der Spiritualität“. Pater Fares erläuterte, dass die Exerzitien die wahre DNA der Jesuiten seien und er viel davon halte, dass sich der Papst gemeinsam mit seiner vatikanischen Kurie aus Rom wegbegebe, auch wenn jeder für sich selbst die geistlichen Übungen mache. Papst Franziskus tue das, so Pater Fares, „was wir in der Gesellschaft Jesu [dem Jesuitenorden] ‚geistliche Leitunga‘ nennen: ein Leitungsstil, der nicht nur darauf achtet, was man machen muss, sondern auch darauf, wie man es macht.“167 Das Wie-man-es-macht ist ein anderer, weniger wissenschaftlicher, aber umso praktischerer Ausdruck für den Begriff „Organisationskultur“. Der argentinische Jesuit, der von Pater Bergoglio gelernt hat, „wie man andere in Exerzitien begleitet“,168 fasst in einfachen und pastoral verständlichen Worten zusammen, wie Organisationskultur in der Kirche definiert und diese, wenn notwendig, verändert werden kann: und zwar wie das Volk Gottes auf dem gemeinsamen evangelisierenden Weg zu seinem letzten und einzigen Ziel unterwegs ist oder sein möchte, ohne dabei freilich die strukturellen Aspekte der globalen Kirche und der Ortskirchen aus dem Auge zu verlieren.
Auf die Frage des mexikanischen Fernsehjournalisten nach der Kurienreform der Kirche spricht Franziskus Klartext: „Jeder Wechsel beginnt mit dem Herzen: mit der Bekehrung des Herzens … und auch mit einer Bekehrung der Lebensweise. […] Es geht um Umkehr, beim Papst angefangen, er ist natürlich der erste, der umkehren muss, nicht?“169 Mit dieser Auffassung widerspricht er allen denen, die meinen, dass die Kurienreform lediglich die „verschiedenen Strukturen auf ihre Effizienz zu überprüfen“170 hat. Er spricht vielmehr einen kulturellen Wandel an, der als Grundvoraussetzung einer Reform der kurialen Strukturen angesehen werden muss.
Zusammenfassend muss aufgrund einer gegenseitigen Durchdringung (Perichorese) zwischen Welt- und Ortskirche der vorliegenden Studie das Recht, ja sogar die Verpflichtung eingeräumt werden, nach dem „Gegenstand“ der Kirche sowohl als Subjekt als auch als Objekt auf ihre existentiell- und praktisch-theologische Ganzheit hin zu fragen. Das empirisch konzipierte 6. Kapitel fokussiert allerdings nicht die universale, sondern zwei ausgewählte diözesane Ortskirchen Österreichs.
2.2 Was ist Kultur?
In den zahlreichen Definitionen des weiten Begriffs „Kultur“171 scheint beim ersten Hinsehen bisweilen wenig Übereinstimmendes zu finden sein. Was diese wissenschaftlichen und populär-wissenschaftlichen Versuche alle nicht leugnen können und somit gemeinsam haben, ist die lateinische Wortwurzel colere, was nicht weniger bedeutet als „bauen, bebauen, bearbeiten, für etwas Sorge tragen, bewohnen, ansässig sein, verpflegen, schmücken, verehren, heilig halten“.172
Es ist nicht Aufgabe der vorliegenden Studie, den Kulturbegriff als solchen, d.h. philosophisch, anthropologisch, ethnologisch, soziologisch, biologisch oder in einem engeren Sinn zu analysieren. Der Fokus liegt auf dem Begriff „Organisationskultur“, der den Blick auf die „Kultur“ zwar mit einschließt, diese jedoch im Kontext menschlicher Organisationen betrachtet. Zudem werden Kulturdebatten ständig von neuen Typologien und unterschiedlichen Kulturbegriffen getragen, wie sie beispielsweise der Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz aufzeigt: einen normativen Kulturbegriff (von Cicero bis Alfred Weber), einen totalitätstheoretischen (von Johann Gottfried Herder bis zur aktuellen Ethnologie), einen differenztheoretischen (von Friedrich Schiller bis Talcott Parsons) und einen bedeutungs- und wissensorientierten Kulturbegriff (von Ernst Cassirer über den amerikanischen Pragmatismus bis heute).173 Die vielfältigen Typologien und Definitionen von „Kultur“174 werden in den meisten Gesellschaften jedoch durch ähnliche, zumindest vergleichbare Wesensinhalte definiert: Es geht um kollektiv programmierte Denk- und Verhaltensmuster, um von einer sozialen Gruppe (mehr oder minder) akzeptierte Werte und Normen des täglichen Lebens, die aus der Vergangenheit tradiert sind und für die Lösung zukünftiger Probleme und die Bewältigung kommender Herausforderungen bewusst oder unbewusst herangezogen werden.
Johannes Messner (1891–1984), Theologe, Rechtswissenschaftler und Politiker, antwortet in seinem 1954 erschienenen Werk „Kulturethik“ auf die Frage, was Kultur ist: „… offenbar das, worin der Mensch die Vollentfaltung des wahrhaft Menschlichen findet“.175 Ruft man sich große Denker ins Gedächtnis, die sich mit der Kultur und den Kulturen beschäftigt haben, wie Plato, Aristoteles, Thomas von Aquin, Immanuel Kant, Georg W. F. Hegel, Arnold J. Toynbee, Friedrich Nietzsche, Thomas S. Eliot, Clyde Kluckhohn, Adolf Portmann, Christopher H. Dawson und andere, so ist klar zu erkennen, dass dieses vielschichtige und vielgestaltige Thema „Kultur“ Philosophen, Anthropologen, Theologen, Ethnologen und Soziologen seit Jahrhunderten gleichermaßen beschäftigt und in Bann gezogen hat.
Die explizite und somit systematisch-wissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik „Kultur“ hat erst in den letzten hundert Jahren Bedeutung erlangt. Das Brockhaus Konversations-Lexikon in seiner 14. Auflage aus dem Jahr 1894 widmete dem Begriff „Kultur“ lediglich siebzehn Spaltenzeilen und bezeichnet mit dem Wort „teils die Thätigkeit, die auf einen Gegenstand gewendet wird, um ihn zu veredeln oder zu gewissen Zwecken geschickt zu machen, teils den Erfolg dieser Thätigkeit“.176 Wird dort zwar schon von der Kultur des Geistes, der Wissenschaften und Künste und nicht nur von „der Kultur eines Ackers“ gesprochen,177 fehlt auch noch in der 14. Auflage (1929) des großen Konversationslexikons für den englischen Sprachkreis, der Encyclopaedia Britannica, das Stichwort Culture gänzlich.178 Googelt man heute jedoch im worldwide web, so liefert der deutsche Begriff „Kultur“ in 0,46 Sekunden 219,000.000 (in Worten: zweihundertneunzehn Millionen) Ergebnisse179 und das englische „culture‘ in 0,40 Sekunden 1.470,000.000 (in Worten: eine Milliarde vierhundertsiebzig Millionen) Hits.180
Messner fasst die Wesensbestimmung des Begriffs „Kultur“ mit den Worten zusammen: „Unsere Erörterung des Kulturbegriffs ließ drei Wesenszüge der Kultur erkennen: Kultur ist Lebensform, Ordnung und Aufgabe …“181. Und damit baut er eine Brücke zu dem, was heute wissenschaftlich, aber auch allgemein unter Unternehmenskultur verstanden wird.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich auch die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums mit dem beschäftigt, was unter Kultur zu verstehen ist, wobei die Konzilsväter am Schluss ihrer Gedanken eine „diakonale Nachhaltigkeit“ alles Wachsens, Schaffens und Denkens für die ganze Menschheit artikulieren (GS 53):
Unter Kultur im allgemeinen versteht man alles, wodurch der Mensch seine vielfältigen geistigen und körperlichen Anlagen ausbildet und entfaltet; wodurch er sich die ganze Welt in Erkenntnis und Arbeit zu unterwerfen sucht; wodurch er das gesellschaftliche Leben in der Familie und in der ganzen bürgerlichen Gesellschaft im moralischen und institutionellen Fortschritt menschlicher gestaltet; wodurch er endlich seine großen geistigen Erfahrungen und Strebungen im Lauf der Zeit in seinen Werken vergegenständlicht, mitteilt und ihnen Dauer verleiht zum Segen vieler, ja der ganzen Menschheit.
2.2.1 Organisationskultur
Organisationskultur, ein Begriff, für den wirtschaftliche Unternehmen den Namen „Unternehmenskultur“ präferieren, ist keine Schöpfung der letzten Jahrzehnte, auch wenn sich die Wissenschaft im Rahmen der Organisationstheorie erst seit etwa hundert Jahren systematisch mit diesem Wissenszweig auseinandersetzt. Eine aktuelle Stichprobe zeigt für den Begriff organizational culture (in englischer Sprache) 22,2 Millionen elektronische Einträge, corporate culture sogar 145 Millionen Hits.182 Soweit die Menschheitsgeschichte dokumentiert ist, wurden die alltäglichen geistigen und physischen Aktivitäten in sozialen Gebilden, sei es in ganzen Staatsgebilden, in öffentlichen Verwaltungen, Kirchen, Klöstern, Verbänden, karitativen Einrichtungen, Universitäten, Unternehmen, etc. im jeweiligen Umfeld stets von Weltanschauungen, Traditionen, Werten, Richtlinien, Überzeugungen, Glaubenssätzen und Haltungen geformt, die ihrerseits von der „übergeordneten“ Gesamtkultur getragen wurden. Für eine Organisation oder Institution, in der von Menschen in sozialer Interaktion etwas unternommen, gepflegt, erneuert, bebaut, erwirtschaftet oder verehrt wird, gilt der Kulturbegriff analog zu dem in der ganzen Gesellschaft, in der diese Organisation verwurzelt und somit eingebettet ist.183
So wie also eine Analogie zwischen Unternehmenskultur und Gesamtkultur hergestellt werden kann, ist auch beispielsweise eine Analogie der Organisationskultur einer Ortskirche und der regionalen oder nationalen Gesamtkultur, in der diese Ortskirche wirkt, anzunehmen. Die in und nach der III. Außerordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode über „die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung“ im Oktober 2014 aufflackernde Diskussion – vor allem über die Themen wiederverheirateter Geschiedener und gleichgeschlechtlicher Beziehungen – haben die kulturellen Unterschiede zwischen „einer“ europäischen und „einer“ afrikanischen bzw. asiatischen Kultur klar zur Sprache gebracht. Die Äußerungen und Schlussabstimmungen vor allem afrikanischer und asiatischer Bischöfe ließen jedoch klar anklingen, dass sie sich nicht von „einer“ europäischen Kultur bevormunden lassen wollten; wobei zu bemerken ist, dass nur bedingt von einer „einen“ europäischen, afrikanischen oder asiatischen Kultur gesprochen werden kann – auch in der Kirche.
Papst Franziskus ist sich – vielfach intensiver als seine Vorgänger – der bunten kulturellen Vielgestaltigkeit der universalen Kirche bewusst und spricht in Evangelii gaudium vom Volk Gottes als „Volk der vielen Gesichter“ (EG 115). Und in Anlehnung an Augustinus präzisiert er: „Die Gnade setzt die Kultur voraus, und die Gabe Gottes nimmt Gestalt an in der Kultur dessen, der sie empfängt“ (EG 115). Damit festigt er die Prämisse, dass sich die innere Kultur der Kirche, also ihre Organisationskultur, nach dem Willen Gottes nicht von der sie umschließenden Kultur separieren lässt. Zu einer solchen wesensbestimmenden Voraussetzung für einen innerkirchlichen Dialog ist die lernende Kirche allerdings noch unterwegs.
Der 1928 in der Schweiz geborene Edgar E. Schein, Doyen der Unternehmenskultur, der viele Jahre am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA, Organisationspsychologie und -entwicklung und Management unterrichtet hat, geht in seiner Forschung von einem „wirkmächtigen Erklärungs- und Anschauungsmodell“184 aus, um den Begriff der „Unternehmenskultur“ als die „gemeinsamen, unausgesprochenen Annahmen“ zu definieren, „auf die sich das alltägliche Verhalten [einer bestimmten Organisation] stützt“.185
In einem praxisorientierten Seminarangebot des deutschen Management Circle wird darauf hingewiesen, dass sich Organisationspsychologie „mit der Schnittstelle Mensch und Organisation“ befasst und „eine Steuerungsfunktion in Sachen Unternehmenskultur und Betriebsklima“ einnimmt.186 Auch wenn darin vor allem die Führungskräfte im Human Resources Management als Zielgruppe angesprochen werden, kann die Verantwortung für organisationspsychologische Belange nicht alleine, vor allem nicht vornehmlich auf Mitarbeiter im Personalbereich eines Unternehmens limitiert werden. Denn Organisationspsychologie schließt alle auf die Person bezogenen Schnittstellen einer Organisation mit ein: beginnend mit der Personalauswahl über die Mitarbeiterführung und -motivation bis hin zu Veränderungsprozessen, für deren tägliche Umsetzung mehr der direkte Vorgesetzte als der Humanressourcen-Manager Verantwortung trägt. Denn: Der Personalchef ist nicht Chef des Personals. In Unternehmen, in denen die funktionalen Führungskräfte der Personalverantwortung entzogen sind und ausschließlich der Personalmanager für die Unternehmenskultur und das positive Betriebsklima verantwortlich zeichnet, mag zwar die theoretisch-wissenschaftliche Basis vorhanden, für den einzelnen Mitarbeiter jedoch die praktische Umsetzung und damit die auf die Person bezogene Glaubwürdigkeit in Frage gestellt sein.
Organisationswissenschaftlich (und nicht psychologisch, anthropologisch oder wirtschaftswissenschaftlich) beschreibt Schein drei Ebenen der Organisationskultur:187
(1) die Artefakte, also das von Menschenhand Geschaffene, wie beispielsweise das Logo oder die Produktmarke einer Institution, deren sichtbare Organisationsstrukturen und Arbeitsprozesse, die meistens schwer zu artikulieren oder zu entschlüsseln sind;
(2) die öffentlich propagierten Werte und Rechtfertigungen, wie etwa Strategien, Ziele oder Unternehmensphilosophien; und
(3) grundlegende, unausgesprochene Annahmen des Unternehmens, der Institution oder Organisation, wie etwa unbewusste, für selbstverständlich gehaltene Überzeugungen, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle, letztlich die Quelle der Werte des Handelns.
Um den Zweck einer Gruppe oder einer Organisation sichtbar zu machen und die definierten Ziele zu erreichen, kann Organisationskultur demnach als die komplexe Gesamtheit gemeinsam getragener Grundüberzeugungen, Werte und Einstellungen bezeichnet werden. Diese kommen beispielsweise in den Wertvorstellungen der Führungskräfte oder in der Art und Weise des Umgangs miteinander – sowohl nach innen als auch nach außen hin – zum Ausdruck.
Eine positive Unternehmenskultur ist bemüht und versteht es, Ziele, Mitarbeiterengagement und Kundenorientierung in Einklang zu bringen, wobei nachgewiesen ist, dass Zufriedenheit der Mitarbeiter einen direkten Konnex mit Kundenzufriedenheit aufweist. Sie ist der eigentliche Motor der gemeinsamen, unausgesprochenen Annahmen, auf die sich das alltägliche Verhalten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Organisation stützt.188
Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen, denen die Erfahrung in profit- und sozial orientierten Unternehmen zugrunde liegt, ergibt sich die Definition einer kirchlichen Organisationskultur: Sie kann als die Gesamtheit der nach innen und außen hin sicht- und greifbaren, jedoch oft unreflektierten und unbewussten, tradierten und gemeinsam gelebten Denk-, Verhaltens- und Handlungsweisen aller Mitglieder des Volkes Gottes definiert werden, die auf gemeinsamen Werten, Glaubensüberzeugungen und vereinbarten Zielen und Visionen beruht.
So wie jeder Gottesdienst nicht nur die versammelte Gemeinde berührt, sondern konstitutionell eine missionarische Bedeutung in sich trägt, begegnen sich auch in den Ortskirchen und somit in der Weltkirche das Auf-sich-Bezogene und das Auf-nach-außen-hin-Bezogene; ohne scharfe Abgrenzungen und stets sich in Bewegung befindlich. Petra Bahr, die Kulturbeauftragte der evangelischen Kirche Deutschlands, spricht im Kontext der immer wieder aufflammenden Kruzifix-Debatte in öffentlichen Gebäuden und Schulen davon, dass es in dieser Situation keiner Grenzschützer bedarf, wohl aber „sensible[r] Übergangsbegleiter in beide Richtungen“.189 Das Kreuz, sozusagen als das christliche Logo (fast aller Kirchen), wird nicht nur innerhalb der Glaubensgemeinschaft, sondern auch von außen her wahrgenommen. Wenn im Titel dieser Studie von Organisationskultur „der Kirche“ und nicht „in der Kirche“ die Rede ist, wird die duale Orientierung der kirchlichen Kultur nach innen und nach außen hin unterstrichen. So wie „ein Glaube, der keine Bedeutung für die Öffentlichkeit hat, […] nicht dem Evangelium [entspricht]“,190 so können Verhaltens- und Handlungsweisen innerhalb der kirchlichen Mauern nicht einen geschützten Raum vortäuschen, der von der Außenwelt verborgen und nicht einzusehen wäre.
Als Christen sind wir davon überzeugt, dass der Geist Gottes dem Menschen, der seinen Ruf hört und diesem auch antwortet, die Fähigkeiten nicht vorenthält, den Sendungsauftrag für das Volk Gottes auch umsetzen zu können; gewiss jedoch nur im Ausmaß des menschlich Möglichen. Papst Benedikt XVI. spricht davon, dass seine menschlichen Kräfte nicht mehr genügen, „um das Schifflein Petri zu steuern“, denn dazu „ist sowohl die Kraft des Körpers als auch die Kraft des Geistes notwendig; eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen anerkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen“.191 Mit diesem Schritt der Einsicht, dass das Petrusamt nicht nur eine göttliche Dimension beinhaltet, sondern ganz wesentlich auch von der menschlicher Unvollkommenheit abhängt, hat Benedikt wohl Neuland in der neueren Kirchengeschichte betreten und damit wahrscheinlich auch die Struktur dieses Dienstamtes für alle Zukunft verändert.
Abschließend kann gesagt werden, dass der Begriff „Kultur“ eher großzügig undefiniert und bisweilen beliebig schlampig verwendet wird. Nicht nur in der zivilen Gesellschaft, sondern auch in der Kirche, die allerdings in ihrem Denken, Sprechen und Tun die Gewissheit des gemeinsamen Ziels immer vor Augen hat (oder haben sollte), was auf profaner Seite nicht immer der Fall ist oder sein muss. In der Communio der Kirche geht es trotz der vielen Unterschiede und Meinungen um die Mitte, die nur Gott sein kann, den Weg, der Christus ist, und deren einenden Geist. In der Diskussion um den „Aufruf zum Ungehorsam“ der österreichischen Pfarrer-Initiative spricht sich der damalige Grazer Bischof Egon Kapellari im Hirtenbrief zu seinem 50-jährigen Priesterjubiläum für eine „,Kultur der Treue’ und ein Aushalten von Gegensätzen innerhalb der Kirche aus“.192 Eine solche Haltung von Führungskräften, Mitarbeitern oder Kunden würde ein säkulares Unternehmen über kurz oder lang an den Rand eines Konkurses führen. Für die Kirche konstituiert dieses Wort des emeritierten Bischofs der Diözese Graz-Seckau ein Wesensmerkmal, das in ihrem Haupt, Jesus Christus begründet ist (Kol 1,18); allerdings nur bis zu der von ihm gesetzten Grenze, jenseits der welcher Weg, der er selbst ist, verlassen werden könnte.