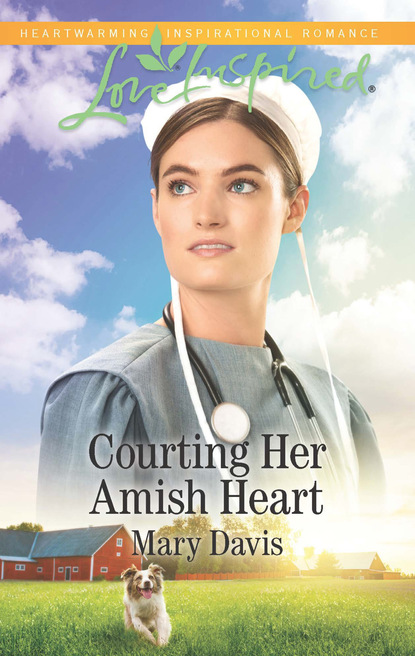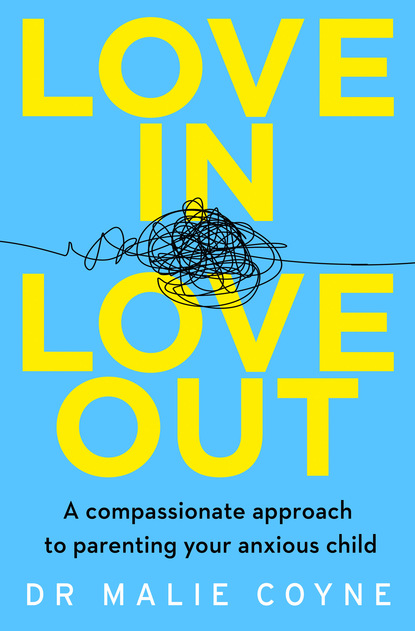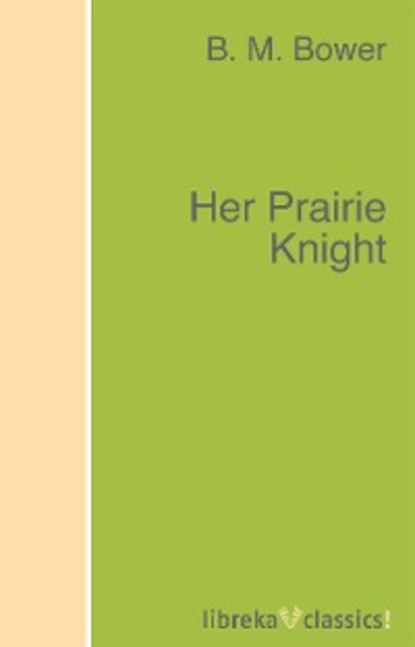Träume - Spiegel der Seele, Krankheiten - Signale der Seele
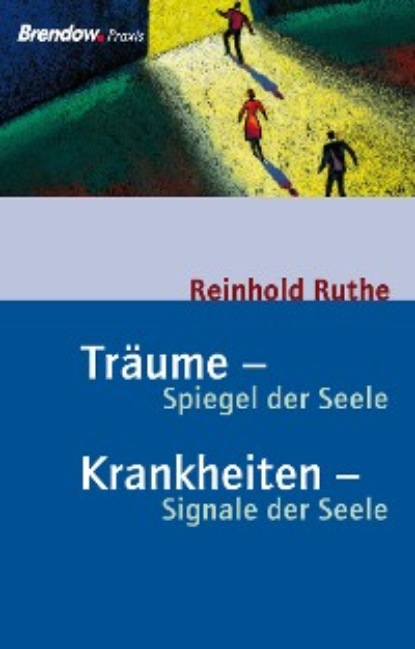
- -
- 100%
- +
Wir beten, dass Gott uns innere Klarheit über diese irrationalen Überzeugungen schenkt oder über einen Seelsorger uns die Augen öffnet, den irrigen Lebensstil zu erkennen und zu ändern. Mit dem Psalmbeter können wir beten:
»Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne … Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken! Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir!« (Psalm 139,1 – 2 und 23 – 24)
Ein solches Gebet um innere Erleuchtung, die der Heilige Geist dem Betenden schenken kann, wird Gott erhören.
Der Beter kann auch zusammen mit dem Seelsorger um innere Klarheit ringen.
Die Einsicht ist der erste Schritt, eine Kurskorrektur der Lebenslüge einzuleiten.
Mit der Himmelfahrt Jesu haben wir Christen die Verheißung, dass der Heilige Geist uns tröstet, für uns eintritt und Worte auch für das findet, was wir nicht ausdrücken können. Er wird uns helfen, unerklärliche Ängste und Befürchtungen, rätselhafte Depressionen und tief verwurzelte Vorurteile, die die Lebenskraft beeinträchtigen, zu erhellen und zu verändern.
Viele ernsthafte Christen lesen täglich in der Bibel. Sie suchen Weisung für ihr Leben und beten um Klarheit bei Problemen und unergründlichen seelischen Schwierigkeiten. Viele neigen unbewusst dazu, ihre unverstandenen Lebenslügen und ihre Neurosen, die Unwahrheit einschließen, dem Heiligen Geist zu öffnen. (Die Neurose kann auch eine Lebenslüge sein. Sie enthält eine uneingestandene, unbewusste Unwahrheit.)
Das Traumgeschehen, das wir in der Seelsorge betend miteinander bedenken, kann eine Hilfe sein, unseren Nöten, auch denen, die wir nicht wahrhaben wollen, ins Gesicht zu schauen.
KAPITEL 4
Begriffe in der Praxis der Traumdeutung
Die verschiedenen psychologischen Schulen arbeiten jeweils mit verschiedenen Begriffen. Es ist daher hilfreich, wiederkehrende Begriffe kurz darzustellen, um Missverständnisse zu vermeiden. Da sich die tiefenpsychologischen Schulen (Freud, Adler und Jung) inhaltlich voneinander unterscheiden, ist es erklärlich, dass sie auch Träume unterschiedlich werten und gewichten.
Manifester Traum – latenter Traum – Traumarbeit und Traumanalyse
Sigmund Freud nennt den Traum, den wir erinnern, den »manifesten Traum«. Es handelt sich dabei um die Bilder, Symbole und Ereignisse, die uns beim Erwachen noch gegenwärtig sind. Die Hintergrundmotive, die versteckten Absichten und das, was uns das Unbewusste sagen will, nennt Freud den »latenten Traum«.
»Den Vorgang der Verwandlung vom latenten zum manifesten Trauminhalt werde ich die Traumarbeit nennen … Der Gegensatz vom manifesten und latenten Trauminhalt … hier finden sich die Rätsel vor, die erst verschwinden, wenn man den manifesten Traum durch den latenten Gedankeninhalt ersetzt.«1
Die eigentliche Traumdeutung nennt Freud die Analysearbeit. Sie beabsichtigt, den manifesten Traum auf seine latenten, verborgenen Wünsche und Ziele hin zu untersuchen. (Ich halte mich in diesem Buch nicht an die Formulierungen Freuds, weil sie in meinem Konzept eine untergeordnete Rolle spielen.)
Die Traumdeutung ist in der Regel eine wirkliche Arbeit und erfordert umfassende Kenntnis der menschlichen Persönlichkeit. Da der Traum nur aus der Kenntnis der Gesamtpersönlichkeit erschlossen werden kann, ist es wichtig, niemals den Ratsuchenden oder den Träumer nur von der Deutung des Traumes allein zu verstehen. Auch wenn Freud den Traum als den »Königsweg« zum Menschen charakterisiert, ist es bedenkenswert, folgende Elemente bei der Deutung zu berücksichtigen:
Tagesreste, Eindrücke des vergangenen Tages,
gegenwärtige Probleme, Probleme der Charakterstruktur, frühkindliche Erinnerungen,
spezielle Ängste und Schwierigkeiten,
wichtige Lebensstilaspekte.
Nur dann kann man einer Gesamtaussage über diesen Menschen gerecht werden. Dieses Sehen im Zusammenhang bewahrt Seelsorger und Berater vor Fehleinschätzungen. Je sicherer ein Seelsorger diese Zusammenhänge erkennt und die Linien verschiedener Aussagen miteinander verknüpfen kann, desto umfassender fühlen sich Ratsuchende verstanden.
Die Traumentstellung – die Traumzensur
Warum sind die Träume so verworren? Warum sind viele Träume für den Durchschnittsmenschen nicht auf Anhieb durchschaubar? Freud hat hier von der »Zensur« gesprochen. Er kommentiert die Traumzensur folgendermaßen:
»Wer an dem Gesichtspunkte der Zensur als dem Hauptmotiv der Traumentstellung festhält, der wird nicht befremdet sein, aus den Ergebnissen der Traumdeutung zu erfahren, dass die meisten Träume der Erwachsenen durch die Analyse auf erotische Wünsche zurückgeführt werden …
Seitdem wir die in ihren Äußerungen oft so unscheinbare, regelmäßig übersehene und missverstandene infantile Sexualität kennen gelernt haben, sind wir berechtigt zu sagen, dass fast jeder Kulturmensch die infantile Gestaltung des Sexuallebens in irgendeinem Punkte festgehalten hat, und begreifen so, dass die verdrängten infantilen Sexualwünsche die häufigsten und stärksten Triebkräfte für die Bildung der Träume ergeben.«2
Freud geht davon aus, dass erotische Wünsche im manifesten Traum als asexuell erscheinen sollen und daher in der Traumzensur »entstellt« werden, wie er das bezeichnet.
Da sexuelle Vorstellungen angeblich tabuisiert und verdrängt werden, dürfen lediglich Andeutungen, Anspielungen und indirekte Aussagen im Traumgeschehen auftauchen.
Der Träumer kennt im Allgemeinen nicht die Bedeutung der sexuellen Symptome, die er in der Traumarbeit verwendet. Freud nimmt aber an, dass diese Symptome weit über Länder- und Sprachgrenzen hinausgehen und Träumer aller Länder vereinen.
Freud will daher in seiner Analysearbeit auf die Deutung der alten Völker zurückgreifen, die – so nimmt er an – mit der Psychoanalyse im Verstehen sexueller Symbole übereinstimmt.
Diese Aussage Freuds, dass sexuelle Symptome in der Regel verdeckt zur Sprache kommen, erscheint überaus einleuchtend. Sie kann zutreffend sein. Aber die Traumentstellung einseitig auf die Verdrängung sexueller Wünsche zu reduzieren macht sie fragwürdig. Ich bin mit Alfred Adler, dem Begründer der Individualpsychologie, der Meinung, dass alle Aspekte, die die Lebens-Grundüberzeugungen zur Sprache bringen, im Traum unverdeckt, aber in Bildern und Symbolen erscheinen. Das heißt, im Traum, der
den Lebensstil spiegelt,
das Bewegungsgesetz dieses Menschen charakterisiert (ob er pessimistisch oder optimistisch, zwanghaft oder mutig ans Leben herangeht),
eine Spiegelung der Lebens-Grundüberzeugungen darstellt und diese zur Sprache bringt,
kommen unterdrückte sexuelle Vorstellungen und vom Lebensstil ausgeblendete Gedanken ans Licht.
Der Träumer vergisst – wie im Wachzustand –, was er vergessen möchte. Er unterschlägt, was er unterschlagen möchte. Die »Traumentstellung«, wie sie Freud charakterisiert, entspricht der subjektiven Wahrnehmung des Träumers, ist also keine Traumentstellung, sondern Ausdruck des Lebensstils.
Ich sehe, was ich sehen will,
ich höre, was ich hören will,
ich fühle, was ich fühlen will,
ich empfinde, was ich empfinden will.
Meine unverstandenen Äußerungen – im Wachen oder im Schlafen – sind Äußerungen meines Lebensstils, meiner Einstellung zu Gott und den Menschen.
Adler schreibt zur Traumzensur: »Was aber Freud ›die Zensur‹ nennt, ist nichts anderes als die größte Entfernung von der Wirklichkeit im Schlafe, ein beabsichtigtes Fernbleiben vom Gemeinschaftsgefühl, dessen Mangelhaftigkeit eine normale Lösung eines vorliegenden Problems verhindert, sodass das Individuum, wie in einem Schock, anlässlich einer erwarteten Niederlage einen anderen Weg zu einer leichteren Lösung sucht, zu dem ihm die Phantasie, im Banne des Lebensstils, abseits vom Commonsense (vom Gemeinschaftsgefühl) behilflich sein soll.«3
Die Traumzensur kommt in der Individualpsychologie Alfred Adlers nicht vor, sie ist überflüssig.
Das Gemeinschaftsgefühl ist für Alfred Adler das Barometer
für seelische Gesundheit,
für Beziehungsfähigkeit,
für ein konstruktives Zusammenleben.
Der Mensch, der auf Grund seiner Lebensführung dieses Gemeinschaftsgefühl vermissen lässt, weicht im Leben und im Traum der Verantwortung vor Gott und vor dem Nächsten wie auch den Anforderungen des Lebens aus. Er sucht eine »leichtere Lösung«, die sich aber als gemeinschaftsfeindlich entpuppt.
Wo Freud die Verdrängung sexueller Wünsche anspricht, spricht Adler von gestörten Beziehungen. Für Adler gibt es keine Traumzensur. Der Traum offenbart unser Denken, Fühlen und Handeln und damit unseren Lebensstil. Ist die Beziehungsfähigkeit untergraben, kommen im Traum die »leichten Lösungen« zur Sprache, die sich der Träumende zurechtlegt.
Wie können »leichte Lösungen« im Traum und im Leben aussehen?
Der Träumende tritt auf der Stelle, er geht nicht vorwärts;
der Träumende wird krank oder ohnmächtig und reagiert mit Angst;
der Träumende überlässt anderen die Arbeit und die Verantwortung;
der Träumende empfindet Reue und Schuld, aber er tut nichts;
der Träumende – wie der Mensch im Alltag – hält sich für klein, untauglich, hilflos und schwach. Er glaubt an seine Unfähigkeit und weicht dem Leben aus.
Worin besteht die Entstellung des Traumes? Freud spricht von der Traumzensur. Adler schreibt:
»Daraus aber folgt die wichtigste Funktion des Traumes, den Träumer auf einen Abweg vom Commonsense, vom Gemeinschaftsgefühl, zu führen … Im Traum begeht also der Träumer einen Selbstbetrug. Unserer Grundanschauung gemäß können wir hinzufügen: einen Selbstbetrug, der ihn angesichts eines Problems, für das sein Gemeinschaftsgefühl nicht ausreicht, auf seinen Lebensstil verweist, damit er das Problem diesem entsprechend löse. Indem er sich von der Wirklichkeit losreißt, die soziales Interesse verlangt, strömen ihm Bilder zu, die sein Lebensstil ihm eingibt.«4
Das heißt für uns:
Der Lebensstil spiegelt sich in den Bildern des Traumes wider. Es gibt keine Zensur.
Der Lebensstil drückt unbewusste, vielleicht neurotische und irrige Ziele aus, die der Nächstenliebe oder dem Gemeinschaftsgefühl zuwiderlaufen.
Der Träumer produziert Bilder, die einem grandiosen Selbstbetrug gleichen. Er phantasiert Möglichkeiten, um auf gemeinschaftsfeindliche Weise zu Lösungen zu kommen.
Und ein letzter Gedanke, wie Adler die unverstandenen Äußerungen des Traumes kommentiert: »Die Unverständlichkeit des Traumes, eine Unverständlichkeit, die sich im Wachen in vielen Fällen ebenso konstatieren lässt, wenn einer mit weit hergeholten Argumenten seinen Irrtum befestigen will, ist demnach Notwendigkeit und nicht Zufall.«5
Das Unverstandene ist das Unbewusste. Wenn jemand beispielsweise im Traum sich als Kind klein und hilflos im Bett liegen sieht, gibt er damit zu verstehen,
dass er nicht wie ein Erwachsener gefordert werden will,
dass er der Verantwortung ausweicht,
dass er lieber wie ein Hilfloser angesehen und behandelt werden möchte.
Traum und Lebensstil spiegeln im Schlaf wie im Wachen einen Menschen wider, der im verantwortlichen Zusammenleben Störungen und Fehlhaltungen aufweist.
Der Traum als Wunscherfüllung
Für Sigmund Freud sind Träume in erster Linie Wunscherfüllungsträume. Nach seiner Meinung sind Wünsche Erreger des Traumes. Über Kinderträume schreibt Freud:
»Das Gemeinsame dieser Kinderträume ist augenfällig. Sie erfüllen sämtliche Wünsche, die am Tage rege gemacht und unerfüllt geblieben sind. Sie sind einfache und unverhüllte Wunschvorstellungen.«6
Da Kinder in der Regel als unkompliziert und offen gelten, so Freud, offenbaren auch ihre Träume leichter als die Träume Erwachsener die geheimen Wünsche ihrer Seele:
Die Gedanken der Kinder, die im Traum zur Sprache gebracht werden, sind Wünsche, die in der Regel aus dem Tagesgeschehen zu erklären sind. Sie werden häufig mit intensiven Gefühlen ausgestaltet.
Auch in den Träumen Erwachsener sieht Freud die Wunscherfüllung am Werk. Sie träumen vom Trinken, weil ein nächtlicher Durstreiz sie quält. Oder sie träu- men von üppigen Mahlzeiten und vom Zuhausesein, wenn sie sich auf Expeditionen weit weg von zu Hause befinden.
Der Ratsuchende entwickelt laut Freud Widerstand gegen die Enthüllung seiner triebhaften, sexuellen Bedürfnisse.
Ich bin dagegen mit Alfred Adler der Meinung:
Die Wunscherfüllung, die es selbstverständlich im Traum gibt, ist nur eine der Möglichkeiten, nach Überlegenheit zu streben.
Das Streben nach Überlegenheit meint:
Der kleine Mensch will groß werden;
der Mensch mit Minderwertigkeitsgefühlen will stark und vollkommen werden;
der Mensch denkt und handelt zielstrebig, um Sicherheit, Erfolg, Wachstum und damit Überlegenheit zu gewinnen. Es ist ein gesundes, von Gott dem Menschen gegebenes Streben.
Dieses Streben nach Überlegenheit und Selbstentfaltung kann allerdings egoistisch entarten. Es kann zu einer unseligen Selbstverwirklichung, zu Macht- und Geltungsstreben werden. Wir sprechen dann vom Überlegenheitskomplex.
»Da jede seelische Ausdrucksform von unten nach oben, von einer Minussituation nach einer Plussituation sich bewegt, kann man auch jede seelische Ausdrucksbewegung als Wunscherfüllung ansprechen«, schreibt Adler.
Kinder wie Erwachsene sind häufig verwöhnte Menschen, die ständig danach streben, unbefriedigte Wünsche im Traum erfüllt zu bekommen.
So genannte Wunscherfüllungsträume bringen nicht in erster Linie unterdrückte Bedürfnisse zur Sprache (das kann sein), sondern artikulieren häufig unberechtigte Wünsche, die gegen das Liebesgebot verstoßen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Diese unberechtigten Wünsche müssen durch ein soziales oder christliches Verhalten im Sinne der Nächstenliebe korrigiert werden.
Was Freud Wunscherfüllung nennt, charakterisiert Adler als eine Leitlinie, die aus einer Minussituation in eine Plussituation führt, den Menschen aus der Minderwertigkeit in die Überlegenheit bringt und den Träumer aus einer erlebten Unvollkommenheit in eine überideal formulierte Vollkommenheit befördert.
Lebensstil und Traum
Der Begriff des Lebensstils spielt in der therapeutischen Seelsorge eine große Rolle. Es ist eine der großen Entdeckungen Adlers, der damit den komplizierten Menschen besser verstehen will. Adler nannte seine Psychologie – im Gegensatz zu Freud – Individualpsychologie (Individuum heißt in seiner ursprünglichen Bedeutung das unteilbare Ganze).
Adler will den Menschen nicht zerteilen, sondern ihn in seiner unteilbaren Ganzheit verstehen. Der Lebensstil bedeutet für ihn:
die Lebens-Grundüberzeugungen, die ein Mensch in sich hat;
das Denkschema, mit dem der Mensch seine unbewussten Ziele ansteuert; – die Meinungen, die er über die anderen hat;
die Vorstellungen, die er von Gott, dem christlichen Glauben und dem Sinn des Lebens hat;
die private Logik, die er sich über Liebe, Arbeit, Freizeit, Genuss, Aktivität, Ehrgeiz usw. gebildet hat;
die subjektive Wahrnehmung, in der er Welt, Dinge und Menschen beurteilt;
das Bewegungsgesetz eines Menschen, das ihn zwanghaft oder mutig, pessimistisch oder optimistisch, aktiv oder passiv, entscheidungsstark oder entscheidungsschwach an die Aufgaben des Lebens herangehen lässt;
die Gangart eines Menschen, die ihn langsam oder schnell, kreativ oder einfallslos, plump oder elegant, vorurteilslos oder voreingenommen alles im Leben in Angriff nehmen lässt;
ein Programm, das sich dieser Mensch geschaffen hat, um allen Anforderungen gewachsen zu sein;
die Summe von Erfahrungen, die der Mensch schon als Kind gemacht und in sein Lebensprogramm eingebaut hat;
die schöpferische Antwort, den Herausforderungen des Lebens auf konstruktive oder neurotische Art und Weise zu begegnen; alle Umgangs- und Verhaltensmuster, mit denen er aggressiv, charmant, betrügerisch, nachgiebig, kämpferisch, abwertend oder fürsorglich die Lebensaufgaben anpackt.
Der Lebensstil ist also die Summe aller Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster, die ein Mensch einsetzt, um den Ansprüchen des Lebens gewachsen zu sein. Der Lebensstil ist die Schablone, die der junge oder erwachsene Mensch über alle Situationen, Gegebenheiten und Ereignisse stülpt. Im Lebensstil kommt der ganze Mensch mit allen seinen Sonnen- und Schattenseiten ungeschminkt zur Sprache. Der Lebensstil ist ein getreues Spiegelbild dieser einmaligen Persönlichkeit.
Aufgabe der therapeutischen Seelsorge ist es, diesen Lebensstil mit dem Ratsuchenden herauszuarbeiten. Je klarer der Lebensstil definiert ist, desto besser kann dem Ratsuchenden geholfen werden:
seine Mängel zu erkennen,
seine Probleme zu verstehen,
seine Beziehungsstörungen einzuordnen,
seine Glaubensschwierigkeiten wahrzunehmen,
Lösungen für Konflikte anzustreben.
Der Traum ist eine Möglichkeit, den Lebensstil eines Menschen zu verstehen. Denn im Traum kommen die Muster und Lebens-Grundüberzeugungen zur Sprache, die für sein Denken, Fühlen und Handeln kennzeichnend sind.
An einem Beispiel möchten wir deutlich machen, wie der Traum den Lebensstil enthüllt. Den Traum erzählte eine achtunddreißigjährige Frau, die die Beratung aufsuchte. Zunächst beschrieb sie ihr Problem:
»Ich bin verheiratet und habe Schwierigkeiten mit meinem Mann. Immer bin ich unzufrieden. Bei den kleinsten Dingen, die nicht nach meinen Vorstellungen verlaufen, reagiere ich mit Kritik. Ich habe das Gefühl, dass ich es richtig mache, und er macht vieles falsch. Meine Unzufriedenheit ist so stark, dass ich mit der Kritik nicht aufhören kann. Ich werde unwahrscheinlich aggressiv. Als ich heiratete, wusste ich, dass ich einen großen Fehler machte, aber ich wollte den Mann nicht enttäuschen.«
Mein Traum war so:
»Ich gehe zu einem Mann in die Seelsorge. Er hat lange, schlohweiße Haare. Der Bischof hat mir den Mann empfohlen. Auf dem Weg dorthin werden meine Schritte langsamer. Ich spüre, wie ich selbst mit mir rede. ›Warum gehst du langsamer?‹ Und ich höre mich sagen: ›Er wird das Gespräch nicht bringen, was du dir vorstellst!‹ Als ich die Tür öffne, kommt mir ein Gesicht entgegen, das ich langweilig finde. Ich spüre keine Überzeugung, dass er mir helfen kann. Was er sagt, ist oberflächlich. Ich spüre, dass in mir Zorn hochkommt. Plötzlich fallen ihm seine Aufzeichnungen aus der Hand. Auf der Erde liegt alles durcheinander. Er findet nichts wieder. Da wache ich auf.«
Der Lebensstil erschließt sich durch fünf Fragen:
a) Wie sieht die Ratsuchende sich selbst?
Unzufrieden, pessimistisch,
selbstkritisch, besserwisserisch,
überheblich, fehlerorientiert.
b) Wie sieht die Ratsuchende die anderen? Wie sehen die anderen die Ratsuchende?
Die anderen genügen nicht,
sie machen alles falsch,
sie sind schuld,
besonders Männer sind enttäuschend,
sie erfüllen nicht ihre Erwartungen,
die anderen werden entwertet,
die Ratsuchende wirkt in den Augen der anderen unangenehm,
handelt in den Augen der anderen lieblos und unpartnerschaftlich,
wird als arrogant und kritiksüchtig erlebt.
c) Wie fühlt sich die Ratsuchende in der Welt? Wie ist ihre Glaubenserziehung?
Sie lebt unglücklich in dieser Welt,
das Leben bleibt ihr vieles schuldig,
sie findet, Gott ist ungerecht,
der Glaube ist eher eine Last und keine Freude,
sie fühlt sich auch von Gott oft im Stich gelassen.
d) Welche Ziele verfolgt die Ratsuchende?
Sie muss überlegen sein,
sie handelt richtig,
nur durch Überlegenheit meistert sie das Leben,
sie weiß alles und weiß alles besser,
durch ständige Entwertung anderer steigert sie ihre eigene, allumfassende Macht,
selbst die Ratschläge eines namhaften geistlichen Führers, eines Bischofs, sind irrig.
e) Mit welchen Mitteln und Methoden verfolgt die Ratsuchende ihre Ziele?
Mit unbarmherziger Kritik,
Aggressionen,
Entwertungen,
unmenschlicher Überheblichkeit,
Besserwisserei,
Selbstgerechtigkeit (»Ich mache alles richtig!«),
Verachtung von Menschen, besonders der Männer.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das geschilderte Eheproblem und der Traum sind in den Aussagen so deckungsgleich, dass die Leitmotive des Lebensstils in beiden Äußerungsformen klar ersichtlich sind. Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen kommen so eindrücklich zur Sprache, dass es der Seelsorger leicht hat, den roten Faden im Auge zu behalten.
Die verschiedenen Aspekte des Lebensstils sollen allerdings nicht vom Seelsorger gedeutet werden. Der Seelsorger hat die Aufgabe, die Selbstaussagen, die im Problem und im Traum offenbar werden, mit der Ratsuchenden ins Licht zu heben. Sieht sich die Ratsuchende im Spiegel seiner Stellungnahmen, kann die Selbsterkenntnis so hilfreich sein, dass mit Gottes Hilfe eine Korrektur des alten Lebensstils gelingt.
Die Zielrichtung des Traums
Ein Begriff, der das Konzept der therapeutischen Seelsorge und des biblischen Denkens beherrscht, ist der Begriff der Zielgerichtetheit, der Finalität (finis = Ziel). Das Ziel des Menschen besteht darin,
im Geistlichen wie im Menschlichen positive oder auch zerstörerische Vorstellungen zu verwirklichen,
mit praktisch gelebter Liebe, aber auch mit störenden Verhaltensmustern das Leben zu meistern,
von klein auf Hilflosigkeit in Stärke zu verwandeln,
Unsicherheit in Sicherheit zu überführen,
Unvollkommenheit in Vollkommenheit zu verarbeiten, die Minussituation des Lebens in eine Plussituation umzugestalten.
Wo wird im biblischen Denken das zielorientierte Planen und Handeln des Menschen deutlich? Einige Bibelstellen sollen das verdeutlichen:
»Gib dein Bestes im Glaubenskampf, damit du das ewige Leben gewinnst. Zu diesem Leben hat Gott dich berufen, als du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis des Glaubens ablegtest« (l. Timotheus 6,12).
»Im Voraus setzt du (Gott) fest, wie alt er (der Mensch) wird, auf Tag und Monat hast du es beschlossen« (Hiob 14,5).
»Lehre mich, Herr, dass mein Leben ein Ziel hat« (Psalm 39,5).
»Jage nach dem vorgesteckten Ziel« (Philipper 3,14).
»Arbeitet an euch selbst in der Furcht vor Gott, damit ihr gerettet werdet! Ihr könnt es, denn Gott gibt euch nicht nur den guten Willen, sondern er selbst arbeitet an euch, damit seine Gnade bei euch ihr Ziel erreicht« (Philipper 2,12 – 13).
Der Mensch wird angehalten,
zu Gott zu kommen,
eine Hoffnung auf ihn zu setzen,