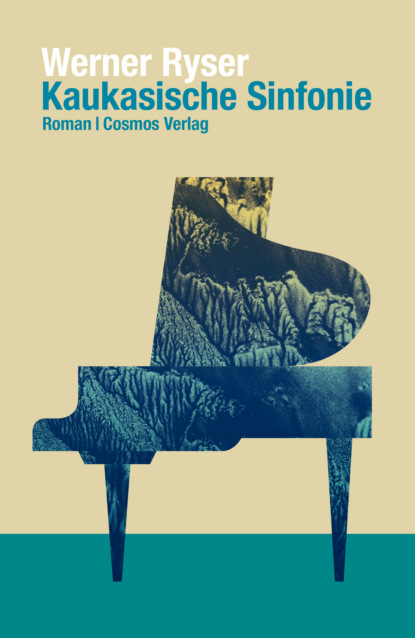- -
- 100%
- +
Eine verfluchte Stadt? In den folgenden Wochen dachte ich oft über Jakobs Bemerkung nach. Manchmal spazierte ich vom Haus der Generalin zum Senatsplatz und betrachtete den Ehernen Reiter. Auf einer gigantischen Welle aus Granit zügelt, lorbeerbekränzt, Peter I., den die Geschichtsschreibung den Grossen nennt, sein sich aufbäumendes Pferd.
Ich versuchte, mir vorzustellen, wie der Zar, dieser über zwei Meter lange Mensch, hoch zu Ross, zusammen mit seinen Höflingen das sumpfige Gelände des Mündungsgebiets der Newa durchstreifte, irgendwann anhielt und mit grosser Geste über den Strom und die vielen Inseln zeigte und verkündete: «Hier soll meine neue Hauptstadt entstehen, grösser und schöner als alles, was wir kennen. Ich will es.»
Im Geschichtsunterricht im Adelsgymnasium von Tiflis hatte man uns beigebracht, dass es dem Kaiser darum gegangen sei, für das russische Reich das Tor zur Welt weit aufzustossen, ihm den Zugang zum Meer zu öffnen, genau hier, wo sich die Newa in die Ostsee ergiesst. Und so legte er am 16. Mai 1703 auf der strategisch günstig gelegenen Haseninsel den Grundstein zur Peter-und-Paul-Festung und damit zu Sankt Petersburg. Man verschwieg uns, dass das Fundament der Stadt von achtzigtausend Sträflingen, Bauern und Kriegsgefangenen gelegt worden war. Achtzigtausend Verdammte, die unter den Peitschenhieben ihrer Aufseher ganze Wälder abholzten. Sie mussten Pfähle herstellen und sie in den sumpfigen Boden rammen, damit auf ihnen jene Paläste und Kirchen erbaut werden konnten, die später vom Glanz und der Glorie der Romanows zeugten. Was scherte es den Zaren, dass die Zwangsarbeiter dabei zu Tausenden verreckten: in den Hochwassern der Newa ertranken, in den bitterkalten Wintern in ihrer dürftigen Kleidung erfroren und verhungerten. Zweifellos verfluchen die Schatten der Unglücklichen die Stadt, die auf ihren Leichen erbaut worden ist.
Der Petersburger Blutsonntag hatte wie ein Fanal gewirkt. Das ganze Land befand sich danach in Aufruhr. Nach der Niederlage der russischen Armee im fernen Osten gegen die vom Zaren als Makaken verhöhnten Japaner war das Ansehen von Nikolaj II. auf einen Tiefpunkt gesunken. Truppen meuterten, die Arbeiter in den Fabriken streikten, Bauern verwüsteten Gutshöfe und verjagten deren Besitzer. Die Regierung des Zaren reagierte mit gnadenloser Härte. Täglich wurden Aufständische hingerichtet oder in die Verbannung geschickt.
Im Spätsommer erreichte mich ein Brief Jakobs. Er schrieb mir, Doktor Erchinger, der seit über fünfzig Jahren Arzt in Katharinenfeld gewesen war, sei gestorben. Man suche dringend einen Nachfolger. Komm zu uns in unser friedliches Schwabendorf, forderte er mich auf, wir brauchen dich!
Von wegen friedlich: Auch in Transkaukasien waren Unruhen ausgebrochen. Der Ruf nach nationaler Eigenständigkeit wurde laut. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Sturm auch die deutschen Einwanderer erreichen würde, die übers ganze Land verstreut in ihren Dörfern lebten.
Was mich letztlich bewog, nach zwölf Jahren meinen Aufenthalt in Sankt Petersburg abzubrechen, weiss ich selbst nicht genau. Vielleicht wollte ich dabei sein, wenn sich Georgien von Russland lösen würde, vielleicht hatte ich Heimweh nach meinen Eltern, nach unserem Gutshof Eben-Ezer und nach der Steppe, wo ich aufgewachsen bin, vielleicht sehnte ich mich nach einem Leben mit Jakob und Menschen, die wie ich Deutsch sprechen.
Wie auch immer: Mitte Oktober 1905 übergab ich meine Praxis einem Nachfolger und fuhr nach Katharinenfeld. Seither lebe ich an der Kreuzgasse im Haus meines verstorbenen Vorgängers. Rosina Dieterle, eine Witwe aus dem Dorf, besorgt meinen Haushalt.
Jakob holt mich aus meinen Erinnerungen zurück ins Jahr 1914. Er ist unterdessen beim dritten Satz von Rachmaninows Klavierkonzert angelangt und singt den Auftakt, der dem Orchester vorbehalten ist, ohne Worte natürlich, allein mit Tatata und Tataratata, bevor er am Klavier in eine Zwiesprache mit den imaginären Musikern tritt. Schon in den ersten beiden Sätzen hat er einzelne Instrumente singend nachgeahmt.
In den letzten Takten des Stücks intoniert Jakob mit seiner Stimme den Part des Orchesters, welches das Grundthema wieder aufnimmt. Seine Finger hämmern wie rasend auf die Tasten. Sein Gesicht ist schweissüberströmt. Die Musik, scheint mir, überträgt sich auf seinen ganzen Körper, der in ständiger Bewegung ist. Er spielt den furiosen Schluss mit der ihm eigenen Brillanz. Dann legt er, wie er es häufig tut, seine Hände auf die Oberschenkel und rührt sich nicht.
Mein jüngster Bruder galt als Wunderkind. Von seinem sechsten Lebensjahr an lebte er während der Wintermonate in Katharinenfeld im Haus des Advokaten Georg Erchinger und seiner Frau Lotte, der Freundin meiner Mutter. Er wuchs mit deren Töchtern, Martha und Marie, auf. Mit Marie ist er inzwischen verheiratet. Von Ludwig Wieland, dem Organisten und damaligen Dirigenten des Sinfonieorchesters, erhielt er Klavierunterricht und wurde in Musiktheorie ausgebildet. Daneben erlernte er das Orgelspiel. Drei bis vier Stunden am Tag sass er am Piano und übte. Jeweils am letzten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst luden die Erchingers ihre Freunde zu einer Matinee in ihr Haus. Jakob spielte auf dem Klavier Eigenkompositionen und begleitete Solisten des Orchesters, die ihre Kunst vorführten. Daneben besuchte er die Dorfschule und musste in den Sommermonaten auf dem elterlichen Gutshof, neben den Übungen, die ihm Ludwig Wieland aufgegeben hatte, mit Hilfe unseres Hauslehrers, Cornelius Fresendorff, nachholen, was der Schulmeister in Katharinenfeld versäumt hatte, ihm beizubringen. Unser Vater legte Wert darauf, dass wir unser Wissen mehrten. Was einer im Kopf habe, pflegte er zu sagen, könne ihm niemand stehlen.
In der Mitte des zweiten Satzes des Klavierkonzerts hat Jakobs Frau den Pavillon betreten und eine Reihe hinter mir Platz genommen. Unsere Familie ist mit den Erchingers gleich doppelt verschwägert. Maries ältere Schwester, Martha, ist mit Hannes verheiratet. Ich brauchte mich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass sie da war. Maries Duft ist unverkennbar. Keine andere Frau in Katharinenfeld benutzt Moschusparfum. Sie ist ihrer siebenunddreissig Jahre zum Trotz noch immer eine Schönheit. Sie macht auch einiges dafür. Allein für ihre Frisur wendet sie viel Zeit auf. Mit dem Brenneisen kräuselt sie ihr volles, dunkles Haar, steckt es mit Kämmen aus Perlmutt hoch und lässt es dann kaskadenartig über ihren schmalen Rücken fallen. Kein Wunder, dass sie auffällt in einem Dorf, in dem die Frauen ihr Haar zu einem strengen Dutt knüpfen oder es zu Zöpfen flechten und als Kranz auf dem Kopf oder Schnecken über den Ohren tragen. Marie ist stets elegant gekleidet. Ausserdem trägt sie einen goldenen Halsreif und grosse, goldene Ohrringe, die Jakob für sie kurz nach der Hochzeit in Sankt Petersburg gekauft hatte. Im frommen Katharinenfeld gibt es keinen Juwelier. Wenn sie durch die Strassen geht, fast schwebend wie ein Wesen aus einer anderen Welt, wagen ihr die braven Schwaben nur verstohlen nachzuschauen. Sie fürchten ihre scharfzüngigen Ehefrauen, die über die kleine Erchinger, wie sie sie immer noch nennen, herziehen. Dieses herausgeputzte Weibsbild, behaupten sie, habe den Pfad der Tugend verlassen und sei längst in die breite Strasse eingebogen, die direkt in die Hölle führt.
Ihr Vater, Georg Erchinger, ist viel zu früh, ein Jahr vor der Hochzeit seiner jüngeren Tochter verstorben. Jakob und seine Frau leben zusammen mit Maries Mutter im elterlichen Haus am Äusseren alten Wingert. Mein Bruder hat in seiner Wohnung ein geräumiges Arbeitszimmer, in dem sein Flügel steht. Dort komponiert und übt er. Im Übrigen lässt er sich von den beiden Frauenzimmern verwöhnen. Sie lesen ihm jeden Wunsch von den Augen ab.
Marie hatte zahlreiche Verehrer. Aber sie wollte stets nur Jakob, den sie seit ihrer Kindheit liebt. Während der Sommerfrische, die Tante Lotte mit ihr und Martha auf Eben-Ezer verbrachte, stand sie, wenn Jakob Klavier spielte, stundenlang neben ihm und wendete auf sein Nicken hin die Notenblätter. Sie bewunderte ihn, wich nicht von seiner Seite, es sei denn, er wurde ihrer überdrüssig und schickte sie fort. Dann zog sie sich zurück, war unglücklich, weinte. Im Prinzip ist das noch heute so. Als Kind hat er ihr beigebracht, Klavier zu spielen, und sie ist eine ganz passable Pianistin. Ihr eigentliches Instrument ist aber die Geige. Das gab ihr die Möglichkeit, mit ihm zusammen zu sein, zu üben und später gemeinsam mit ihm aufzutreten.
Auch wenn die Katharinenfelder hinter ihrem Rücken die Mäuler über Marie zerreissen, so hindert sie dies nicht, ihr zuzujubeln, wenn sie zusammen mit ihrem Mann Vittorio Montis Czardas spielt. Sie steht in ihrem schulterfreien roten Kleid auf der Bühne, lächelnd, mit halb geschlossenen Augen, und lässt den Bogen über die Saiten ihrer Violine tanzen. Sie scheint nicht zu bemerken, dass sie ihr Publikum verzaubert und es von seinen Vorfahren träumen lässt, die einst, wie unser Vater, die Donau hinunter zum Schwarzen Meer gefahren sind.
Sie ist Primgeigerin im Orchester. Niemand neidet ihr den Posten. Marie ist unbestritten eine begnadete Violinistin, eine Künstlerin. Der Preis, den sie dafür bezahlt, ist allerdings hoch. Manchmal sucht sie mich in meiner Praxis auf. Sie hat Schmerzen im Nacken und in den Schultern, ausserdem im Handgelenk. Dazu kommt ihre ständige Angst, den hohen Ansprüchen Jakobs nicht zu genügen. Ich verschreibe ihr schmerzlindernde Salben, die ich nach den Rezepten von Mariam Stepanyan, der verstorbenen Hebamme und Kräuterfrau von Eben-Ezer, herstelle. Schon mein Vorgänger, Josef Erchinger, Maries Grossvater, hielt grosse Stücke auf die Heilkunst der Steppenhexe, wie er Mariam nannte. Was Marie Not täte: für ein paar Monate ganz mit dem Geigenspiel aufzuhören, um sich richtig auszukurieren. Am besten in Bordshomi, wo es Mineralquellen gibt, die Wunder bewirken sollen. Aber als ich ihr einmal den Vorschlag machte, schaute sie mich entgeistert an. «Das geht nicht», sagte sie. Ich vermute, sie hat Angst, dass Jakob sich eine andere Violinistin suchen würde, wenn sie, auch nur vorübergehend, mit dem Geigenspiel aufhörte.
Endlich richtet sich Jakob auf, schaut vom Podium herunter zu mir und begrüsst seine Frau mit einem Kopfnicken. «Rachmaninow schreibt für die Instrumentierung des Orchesters zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen und Tuba vor», zählte er auf. «Ausserdem Pauken, grosse Trommel, Becken und natürlich die Streicher. Nur die Hörner bereiten mir Bauchweh. Wir haben lediglich zwei im Orchester. Was meint ihr, soll ich mich damit begnügen oder mir bei den Generälen Ersatz besorgen?»
Generäle nennt er die Mitglieder der Blaskapelle. Die Musikanten tragen schmucke Uniformen und ziehen hinter Jakob mit schmetternden Klängen durchs Dorf. Er erwartet keine Antwort auf seine Frage. «Wenn wir das Klavierkonzert am Erntedankfest spielen wollen, kommt eine harte Zeit auf euch alle zu», sagt er stattdessen. «Ich werde wöchentliche Proben ansetzen, und natürlich Extraproben, getrennt für die Bläser und Streicher. Und üben müsst ihr, üben, üben.» Er streicht sich das rote Haar aus der Stirn.
Wir schweigen, denn wir kennen Jakob gut genug. Er wird jeden Einwand von Seiten der Orchestermitglieder weglächeln, wird keine Ausrede gelten lassen. Wer in einer Probe fehlt, wird sie einzeln nachholen müssen. In seiner sanften, hartnäckigen Art wird er nicht lockerlassen, bis alle ihren Part zu seiner Zufriedenheit beherrschen.
Die braven Katharinenfelder Musiker werden heimlich murren, aber sie werden sich seinem Willen beugen. Auch ich. Marie ohnehin. Wir alle sind stolz auf ihn, auf ihn, seine Begabung, sein Können und seine Erfolge.
Zwischen 1895 und 1898 hat Jakob am Konservatorium von Sankt Petersburg Komposition und Instrumentation studiert. Zusätzlich besuchte er Vorlesungen über musikalische Formenlehre und kontrapunktischen Satz. Ausserdem nahm er Klavierunterricht in einer Meisterklasse, sass täglich vier bis sechs Stunden am Flügel und vervollkommnete sein Spiel. Abends ging er oft in die Oper, ins Konzert oder ins Ballett. Ab und zu begleitete ich ihn. Er pflegte mit geschlossenen Augen dazusitzen. Manchmal zog er eine Kladde aus der Innentasche seines Fracks und machte sich Notizen. Er komponiert schon seit seiner Kindheit. Ein halbes Jahr vor Abschluss seiner Ausbildung wurde ihm die Aufgabe gestellt, das Gedicht Sehnsucht von Joseph von Eichendorff zu vertonen. Er schuf eine Melodie, die mir noch heute die Tränen in die Augen treibt. Jakob schloss sein Studium mit der Kleinen Goldmedaille ab.
Anschliessend begann er eine Laufbahn als Pianist. Er spielte in Kasan, Jekaterinburg, Moskau und Sankt Petersburg, gab Konzerte in Riga, Königsberg, Berlin und Dresden, in Böhmen und Mähren und sogar in Wien. Manchmal trat er gemeinsam mit Marie auf, die bereits damals konzertreif spielte. Aber um 1900, als Ludwig Wieland starb, kehrte er nach Katharinenfeld zurück und übernahm dessen Aufgaben. Seither dirigiert er nicht nur das Sinfonieorchester und die Blasmusik, sondern leitet auch den Kirchenchor und verleiht dem sonntäglichen Gottesdienst mit seinem Orgelspiel Glanz. Ab und zu geht er noch auf Tournee. Aber lediglich für wenige Konzerte in Georgien, nur ausnahmsweise auch Russland.
Ich fragte ihn einmal, ob es ihm nicht leidtue, sein Talent in unserem grusinischen Krähenwinkel versauern zu lassen. Jakob sah mich erstaunt an. «Weshalb sollte es mehr wert sein, mit seiner Kunst einem Publikum aus blasierten Adeligen und reichen Bürgern die Zeit zu vertreiben als den Nachkommen schwäbischer Einwanderer die Freude an der Musik und am Musizieren zu wecken? Und wer sagt dir, dass ich mein Talent versauern lasse?» Er ereiferte sich. «Ich versuche ständig, mein Spiel zu verbessern, komponiere und …» Er stockte, ein schüchternes Lächeln huschte über sein Gesicht. «Ich will ein grosses Orchesterwerk schaffen. Ich weiss schon, wie ich es nennen werde.» Er errötete. «Kaukasische Sinfonie», sagte er schliesslich. «In ihr soll alles enthalten sein, was wichtig ist: die Schönheit unseres Landes und die Menschen, die hier leben, arbeiten, Kinder zeugen, sie grossziehen und sterben. Und ihre Sehnsucht nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit.» Er machte eine hilflose Handbewegung. «Alles. Ich stelle mir ein Werk vor, das die wichtigsten Episoden, die das Leben ausmacht, in Tönen zum Ausdruck bringt und sich unmerklich zu einem Ganzen vereint.»
Dass er seinen Traum erzählte, war zweifellos ein Vertrauensbeweis. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Auch nicht mit unserer Mutter. Obwohl ich weiss, dass sie nicht verwundert wäre, wenn sie davon erführe. Was immer mein Bruder macht, ist für sie richtig. Wenn sie an Feiertagen mit Vater, Hannes und Martha und deren Kindern zum Gottesdienst nach Katharinenfeld kommt, versäumt sie es selten, mir zu erzählen, wie er sich bereits 1879 als Dreijähriger das Klavierspiel selbst beigebracht hat. Sie war vernarrt in Jakob – sie ist es immer noch. Er ist ihr Liebling, so wie für den Vater Hannes, der einzige von uns drei Brüdern, in dessen Blut das bäuerische Erbe unserer Emmentaler Vorfahren fliesst.
Jakob
1
Im Frühjahr 1879 entdeckte Sophie Diepoldswiler, dass Jakob über ein ausserordentliches musikalisches Talent verfügte. Wenn sie am Piano sass, wich der Dreijährige nicht von ihrer Seite. Er kniete neben ihr auf der Klavierbank und schaute gebannt auf ihre Finger. Manchmal sang sie mit ihm Kinderlieder, die sie mit einfachen Akkorden begleitete. Wenn sie im Gemüsegarten arbeitete, spielte er im Kies zwischen den Beeten. Immer wieder stellte er ihr Fragen zur Musik, die ihn beschäftigten. Sophie antwortete, so gut sie konnte. Wurde es ihr zu viel, schickte sie ihn zu Mayranoush. Die Armenierin war ihre Amme gewesen. Heute führte sie die Hauswirtschaft auf Eben-Ezer.
Einmal, als Sophie aus dem Garten zurückkehrte, sass Mayranoush auf der Veranda und rüstete Gemüse. Auch wenn immer mehr graue Strähnen ihr einst rabenschwarzes Haar durchzogen, war sie, fand Sophie, die schönste Frau, die sie kannte. Niemand hatte Augen wie Mayranoush: mandelförmig, unergründlich, dunkel. Sie neigte zur Melancholie. Nur selten spielte ein Lächeln um ihre vollen Lippen. Sie war gross und schlank. Nach dem Tod ihres Verlobten, von dem sie ein Kind empfangen hatte, wollte sie nichts mehr von Männern wissen. Seit ihr Sohn, Hovan, Sophies Milchbruder, einjährig an der Bräune verstorben war, hatte sie ihre ganze Liebe Sophie geschenkt, die an ihr hing, wie man an einer Mutter hängt. Wenn sie unter sich waren, sprachen sie Armenisch miteinander.
«Wo ist Jakob?», fragte Sophie.
Mayranoush unterbrach ihre Arbeit. «Er ist oben und spielt Klavier.»
«Er spielt Klavier?» Sophie schaute sie ungläubig an.
«Gewiss, er macht das schon seit einiger Zeit. Immer wenn er aus dem Gemüsegarten kommt, geht er in eure Wohnung und spielt. Hörst du ihn nicht?»
Sophie lauschte. Tatsächlich waren aus dem Fenster ihrer Wohnung ganz leise Töne zu vernehmen – manchmal sogar Dreiklänge. «Wer hat ihn das gelehrt?»
Mayranoush lächelte. «Wenn nicht du, wer dann?»
Sophie schüttelte den Kopf. Sie ging ins Haus und stieg die Treppe hoch. Die Tür zur Wohnung war offen. Ebenso jene zum Salon. Auf der Schwelle blieb sie stehen.
Jakob kniete auf der Klavierbank, damit er die Tasten des Pianos erreichen konnte. Er sang eine offenbar selbst erfundene Melodie, verwendete dazu Worte in einer eigenen, unverständlichen Sprache und begleitete sie mit Akkorden. Sophie trat hinter ihn und schaute ihm über die Schultern. Er schlug mit dem Zeigefinger der linken Hand den Grundton an und mit Zeige- und Ringfinger der rechten die entsprechenden Tasten der grossen Terz und der Quinte. Scheinbar bereitete es ihm keine Mühe, Dreiklänge zu bilden.
Das Kind spürte, dass es nicht mehr allein war. Es brach sein Spiel ab, drehte sich um und schaute die Mutter schuldbewusst an.
Sophie hob den Kleinen hoch und schloss ihn in die Arme. «Wer hat dich das gelehrt, Jakob?»
«Niemand, es ist ganz einfach.» Der Bub löste sich von ihr. «Ich zeige es dir.» Er kniete sich wieder auf die Klavierbank. «Wenn du hier beginnst», er schlug ein C an, «und dann alle weissen Tasten der Reihe nach hintereinander spielst, dann passen die Töne zueinander, bis du wieder denselben hast wie am Anfang, nur höher. Du kannst damit weiterfahren bis ans Ende des Klaviers. Es sind immer dieselben Töne, von ganz unten bis ganz oben, genau gleich wie eine Treppe.» Sein Zeigefinger hämmerte mit rasender Geschwindigkeit drei Tonleitern hintereinander hinauf und hinunter.
Sophie war bass erstaunt. «Und schaffst du es auch, wenn du die Tonleiter», sie korrigierte sich: «die Reihe mit einer anderen Taste anfängst, beispielsweise mit dieser?» Sie zeigte aufs G. Gespannt beobachtete sie, wie Jakob einen Ton nach dem andern anschlug und nach dem E, ohne zu zögern, ein Fis spielte, bevor er mit dem eine Oktave höheren G zum Abschluss kam.
«Aber diese Reihe kannst du wohl nicht.» Sophie zeigte aufs H. Die H-Dur-Tonleiter mit ihren fünf Kreuzen schien ihr denn doch zu schwierig für den Kleinen. Jakob lachte glücklich. Im Nu spielte er h-cis-dis-e-fis-gis-ais-h und schaute die Mutter stolz an. Sie drückte ihm einen Kuss auf den Scheitel.
«Ich kann noch mehr.» Jakob spielte sein Lieblingslied: C-a-f-f-e-e, trink nicht so viel Caffee! Er sang es und spielte dazu, zeitlich versetzt, die zweite Stimme auf dem Klavier.
«Ich fasse es nicht», flüsterte Sophie. «Sag einmal Jakob», sie trat zu ihm ans Piano, «weisst du auch wie die Töne heissen? Zum Beispiel dieser hier?» Sie deutete aufs C.
Der Kleine sah sie verwundert an. «Haben sie denn Namen?»
«Und wie nennt man das?» Sophie spielte eine Tonleiter.
«Eine Reihe?», fragte Jakob zweifelnd.
«Kannst du drei Töne, die zusammenpassen, gleichzeitig spielen?»
Der Bub schlug verschiedene Dur- und Moll-Akkorde an.
«Und wie sagt man diesen drei Tönen?»
«Ich weiss es nicht.»
Sophie fuhr ihm über den Kopf: «Das musst du auch nicht wissen, mein Liebling, noch nicht. Ich bin stolz auf dich!» Sie nahm sich vor, ihm zu zeigen, wie man richtig spielt, welche Finger auf welche Tasten gehören.
Von diesem Tag an setzte sie sich jeden Morgen eine Stunde mit Jakob ans Klavier. Zuerst brachte sie ihm bei, wie man Tonleitern hinauf und hinunter korrekt mit den fünf Fingern der rechten Hand spielt. Sophie gab ihm auf, das Erlernte fleissig zu üben. «Du musst so weit kommen», erklärte sie ihm, «dass deine Finger, ohne dass du denkst, die richtigen Tasten von allein finden.» Aber das war kein Problem für ihn. So konnte sie ihm schon bald zeigen, wie man die linke Hand einsetzt.
Lange bevor sie Jakob im Klavierspiel unterrichtete, hatte Sophie mit ihm zahlreiche Kanons gesungen. Jeden Abend vor dem Einschlafen: Dona nobis pacem oder O wie wohl ist mir am Abend, tagsüber: Froh zu sein, bedarf es wenig, auch Hejo, spann den Wagen an und natürlich Bruder Jakob, an dem er wegen der Namensvetternschaft besonders Freude hatte.
Zwei Jahre später war Jakob in der Lage, anspruchsvolle Stücke zu spielen. Sophie würde jenen Sonntag Ende März wohl nie vergessen. Als sie und Simon von einem Spaziergang zurückkehrten, überraschten sie ihre beiden grusinischen Mägde, die im Treppenhaus standen und andächtig dem Klavierspiel lauschten, das durch die angelehnte Wohnungstür in der Beletage klang. Sophie hielt ihren Mann am Arm zurück. «Jakob hat ein neues Stück entdeckt», flüsterte sie.
«Kennst du es?», fragte Simon.
Sie nickte. «Es ist der Fandango in d-Moll von Padre Antonio Soler, einem spanischen Komponisten. Ich habe ihn im letzten November geübt. Aber er spielt ihn besser als ich!»
«Der Kleine ist ein Künstler», behauptete Ekaterina, als die Schlussakkorde verklungen waren. Tamara nickte bestätigend.
«Was sagt sie?», fragte Simon, der nicht Georgisch konnte.
«Jakob sei ein Künstler», übersetzte Sophie. Sie registrierte, wie ihr Mann lächelte.
«Ein Künstler», wiederholte er. Jakob, das wurde er nicht müde zu behaupten, sei seinem eigenen, viel zu früh verstorbenen Bruder, dem Maler, dessen Namen er trug, wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie sein Onkel war der kleine Jakob feingliedrig, hatte ein von Sommersprossen übersätes Gesicht und rotes, weiches Haar. Sophies Schwager hatte einige Bilder und Skizzen hinterlassen, die in ihrer Wohnung hingen. Sie hätte ihn gerne gekannt.
Auf dem Treppenabsatz im ersten Stock erschien Jakob.
«Das hast du wunderbar gespielt!», rief Sophie.
«Ich habe es mit Herrn Fresendorff heimlich geübt», sagte der Bub. «Es ist ein Geschenk für dich.»
2
Seit einem Jahr gab es auf Eben-Ezer einen neuen Bewohner: Cornelius Fresendorff, den Hauslehrer von Karl und Hannes, die inzwischen acht-, respektive siebenjährig waren. Er wolle nicht, dass seine Buben bei den Schwaben in Katharinenfeld zur Schule gehen, hatte Simon erklärt. Dort würden sie zusammen mit fünf Dutzend anderen Kindern unterrichtet und lernten wenig bis nichts. Er wusste, wovon er sprach. Er selbst war in seiner Kindheit im Emmental während sechs Jahren im Winterhalbjahr mit fünfundsiebzig Leidensgenossen in einer engen Stube eingepfercht gewesen, wo ein überforderter Schulmeister mit zweifelhaftem Erfolg der ungebärdigen Schar die Grundlagen des Schreibens und Rechnens eingeprügelt hatte. Tatsache war, dass Simon noch heute keinen fehlerfreien Brief zustande brachte. Dass er fähig war, die Bücher eines Gutsbetriebes zu führen, verdankte er den Brüdern Hieronymus und Benedict Lüthi, bei denen er das Käserhandwerk erlernt hatte.
«Ich will, dass wir für Karl und Hannes einen Hauslehrer anstellen», hatte Simon gesagt. «Am besten einen aus dem Baltikum.» Dort spreche man Deutsch und Russisch, und richtig Russisch sprechen und schreiben müssten die Buben lernen, wenn sie es in Grusinien zu etwas bringen wollten. Er hatte einem Agenten in Tiflis den Auftrag gegeben, in Riga in der Zeitung für Stadt und Land ein entsprechendes Inserat aufzugeben.
Immer wenn sie an Cornelius Fresendorffs Ankunft auf Eben-Ezer dachte, musste Sophie lächeln. Sie und Simon hatten am Teich im Blumengarten miteinander geplaudert, als ein Fremder durch die Birnbaumallee aufs Herrenhaus zuritt. Sie sahen ihm belustigt entgegen. Der Mann fühlte sich sichtlich unwohl auf seinem Maulesel. Ein zweites Tier, das sein Gepäck trug, führte er am Halfter neben sich her. Er war kleingewachsen und etwas rundlich. Seinem noch unfertigen, bartlosen Gesicht konnte man entnehmen, dass er nur wenig über zwanzig war. Er trug einen schwarzen Anzug, ausserdem einen breitkrempigen Hut. Durch die runden Gläser seiner Brille musterte er das Ehepaar und fragte, ob dies hier das Gut der Diepoldswilers sei.