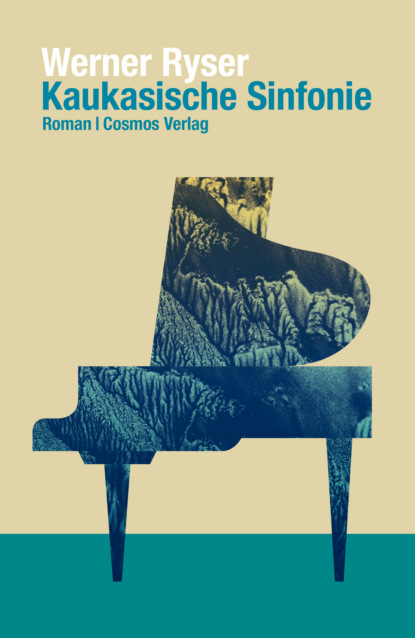- -
- 100%
- +
Sophie wurde warm ums Herz. Er sprach das Deutsch der Balten, dasselbe, das ihr Vater gesprochen hatte. «Ihr seid gewiss unser neuer Hauslehrer. Herzlich willkommen auf Eben-Ezer!», begrüsste sie ihn.
Er stieg umständlich von seinem Tier und zog den Hut, unter dem ein schwarzer Haarschopf zum Vorschein kam. Er deutete eine Verbeugung an und schlug die Hacken zusammen. «Gestatten», sagte er, «Cornelius Fresendorff.» Die lange Fahrt mit der Eisenbahn und in Postkutschen habe ihm die Seele aus dem Leib geschüttelt, klagte er. Dass er am Schluss in Katharinenfeld noch zwei Maulesel habe mieten müssen, ausgerechnet er, der weiss Gott kein Reitersmann sei, habe seiner Reise nach Grusinien die Krone aufgesetzt.
«Ihr seid also aus den Ostseeprovinzen», eröffnete Simon beim Nachtessen, das man wie üblich gemeinsam mit dem Gesinde einnahm, das Gespräch. Er bemühte sich, jenes Hochdeutsch zu sprechen, das er aus den Büchern Gotthelfs kannte. Üblicherweise blieb er beim Berndeutschen. Mit den Dienstboten und den Leuten aus dem Dorf redete er ein fehlerhaftes Russisch, das er sich im Laufe der Jahre mühsam angelernt hatte.
«Aus Kurland», beantwortete Fresendorff Simons Frage, «um genau zu sein, aus Libau, wo mein Herr Vater als Arzt praktiziert.»
«Und studiert habt Ihr in Sankt Petersburg?»
«Ja. Mein Vater, dem ich in meiner Jugend oft assistiert habe, hätte es zwar lieber gesehen, wenn ich nach Dorpat gegangen und Medikus geworden wäre, wie er. Aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, klassische Philologie und Geschichte zu studieren.»
«Philosophie, meint Ihr wohl?», fragte Simon.
«Nein, Philologie – Sprachwissenschaften.» Der junge Mann säbelte ein grosses Stück vom Schmorbraten ab, den Sophie nach einem Rezept ihrer Grossmutter zubereitet hatte. Er balancierte es auf seinen Teller, zerkleinerte es, spiesste ein Stück ums andere mit seiner Gabel auf und spülte alles mit einem tüchtigen Schluck Wein hinunter. Klassische Philologie, dozierte er, beschäftige sich mit altgriechischen und lateinischen Texten, mit Dramen, Epen und Lyrik, aber auch mit historiographischen, naturwissenschaftlichen und philosophischen Zeugnissen der alten Römer und Griechen.
«Aha», sagte Simon und machte ein ratloses Gesicht. Ihm wurde bewusst, dass er einen seltsamen Vogel auf den Hof geholt hatte.
Sophie wirkte eher besorgt. «Und das alles müssen meine Buben jetzt bei Euch lernen?»
«Gott bewahre!» Fresendorff hielt Wassilij, dem alten Diener des Barons, der den Mundschenk machte, das leere Weinglas hin. «Ich bringe ihnen zuerst einmal Lesen und Schreiben bei, auf Deutsch und Russisch, dann Rechnen, später Geschichte, Naturkunde und Geografie. Wenn es Euch recht ist, beginne ich mit dem Unterricht gleich morgen: vier Stunden am Vormittag, zwei am Nachmittag. Am Mittwoch- und am Samstagnachmittag sollen sie frei haben.»
Sophie sah ihren Mann fragend an. Der zuckte mit den Schultern. «Das ist in Ordnung», meinte sie. «Ich habe im Anbau ein Schulzimmer eingerichtet: ein Pult und eine Wandtafel für Euch, zwei kleine Tische und Schiefertafeln samt Griffel für Karl und Hannes. Wenn Ihr mehr braucht, so sagt es mir.»
Cornelius Fresendorff lebte sich auf Eben-Ezer ein. Sobald sie die Schulstube betraten, war ihr Lehrer für Karl und Hannes die höchste Autorität. Sie fügten sich willig seinen Anweisungen, bemühten sich, seinen Anforderungen gerecht zu werden, und gierten nach seinem Lob. Mayranoush schloss den jungen Mann, der ihr, so gelehrt er auch sein mochte, etwas weltfremd erschien, in ihr Herz. Sie half ihm, seine beiden Kammern unter dem Dach einzurichten: einen Schlafraum und eine Stube mit einem Kanonenofen, der im Winter für behagliche Wärme sorgte. In dieser kleinen Wohnung hatte Simon vor seiner Heirat gelebt. Die Armenierin bat Hovhannes Stepanyan, den Zimmermann, für den neuen Lehrer ein Regal anzufertigen, in das er seine vielen Bücher einordnen konnte. Sie selbst nähte ihm Kleider, die hier draussen in der Steppe praktischer waren als sein schwarzer Anzug.
Wenn die Buben im Bett waren, trafen sich die Diepoldswilers mit Mayranoush und Cornelius im Salon. Wie schon zu Zeiten des Barons wurde für die Männer Cognac serviert, während die Frauen aus winzigen Tassen stark gesüssten türkischen Kaffee tranken. Man plauderte, erzählte sich Geschichten und Fresendorff las aus Büchern vor, welche die anderen nicht kannten. Ab und zu sang Sophie Lieder aus Des Knaben Wunderhorn und begleitete sich dazu auf dem Klavier.
Eines Abends brachte der Balte eine Klarinette mit. Er habe in Sankt Petersburg in einem Orchester mitgespielt, sagte er, und wenn sie nichts dagegen habe, so könne man gemeinsam musizieren.
«Was möchtet Ihr denn spielen?», fragte Sophie.
Ob sie den Walzer aus der Schönen Helena von Jacques Offenbach kenne?
Sophie erstarrte. Im Sommer vor neun Jahren hatte eine Kosakeneinheit, die zur russisch-osmanischen Grenze unterwegs war, auf dem Gutshof drei Tage gerastet. Baron von Fenzlau hatte den Offizieren in seinem Haus Gastrecht gewährt. Auf seinen Wunsch hatte Sophie, damals ein siebzehnjähriges, törichtes Ding, zur Unterhaltung der Gäste Leutnant Schota Awalischwili, der seine Violine mit sich führte, auf dem Piano zu Offenbachs Walzer begleitet. Sie hatte sich in den gut aussehenden jungen Mann verguckt. Am nächsten Tag war sie auf dem Hügel bei der alten Kapelle, dort, wo jetzt das Grab ihres Vaters war, von ihm verführt worden. Hätte Simon sie nicht geheiratet und ihren Erstgeborenen, Karl, als eigenen Sohn anerkannt, würde sie heute ein vaterloses, unter liederlichen Verhältnissen gezeugtes Kind aufziehen müssen. Ihr Mann wusste nichts Genaues von den Umständen, die zu ihrer Schwangerschaft geführt hatten. Er wollte es auch gar nicht wissen, denn das gehörte zu den Dingen, über die man auf Eben-Ezer nicht sprach.
Und jetzt kam dieser Mensch aus Kurland und wollte mit ihr den Walzer spielen, der sie, nachdem der Leutnant weitergeritten war, über Wochen als Ohrwurm gequält hatte. «Nein!», sagte sie schroff. «Ich kenne das Stück nicht und will es auch nicht kennenlernen.»
Fresendorff schaute sie verwundert an und spielte dann die ersten Takte von Ännchen von Tharau. «Aber das habt Ihr gewiss schon gehört?»
Sophie nickte. Sie kannte das populäre Liebeslied.
Von diesem Abend an spielten die beiden regelmässig deutsche und russische Volkslieder – er mit seiner Klarinette die Grundmelodie, sie die Begleitung. Wenn Sophie sang, dann intonierte der Hauslehrer, zum Vergnügen von Simon und Mayranoush, die zweite Stimme. Karl, Hannes und der fünfjährige Jakob stiegen aus den Betten und schlichen sich in ihren Hemden vor die Tür des Salons, um zuzuhören. Und selbst der alte Wassilij, zu dessen Pflichten es gehörte, die sechs Ulmer Doggen aus ihrem Zwinger zu befreien, damit sie nachts das Anwesen schützten, blieb draussen auf dem Platz vor dem Haus unter dem offenen Fenster stehen und lauschte.
Cornelius Fresendorff war ein musikalischer Mensch, dem Jakobs Talent nicht verborgen blieb. Er war der Meinung, das Kind sei alt genug, die Grundzüge der Musiktheorie kennenzulernen. «Wenn mich nicht alles täuscht, verfügt Euer Jüngster über eine ausserordentliche Begabung, die unterstützt werden muss», sagte er zu Sophie. Er würde sich freuen, Jakob einmal in der Woche unterrichten zu dürfen. Zögernd stimmte sie zu, und so lehrte Fresendorff Jakob seit einem halben Jahr die Notenschrift, sprach mit ihm über Taktarten und Rhythmen, über Tonhöhen, Intervalle und Akkorde, und selbst die systematische Anordnung aller zwölf Dur- und Molltonarten im Quintenzirkel erläuterte er ihm.
Bereits nach kurzer Zeit war Jakob in der Lage, einfache Lieder ab Blatt zu spielen. Sobald er die Melodien im Kopf hatte, begann er sie zu variieren. Tatsächlich schien ihm das Improvisieren und das Erfinden neuer Melodien mehr Freude zu machen als das strenge Spiel nach Vorgabe.
«Du musst zuerst die Grundlagen beherrschen, bevor du zu komponieren beginnst», versuchte Cornelius Fresendorff ihn zu bremsen.
«Aber die Melodien sind hier drin!» Der Bub schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. «Sie wollen hinaus. Ich muss sie spielen.»
Kurz vor Weihnachten gab der Balte Jakob den Klavierauszug des ersten Satzes der Berchtoldsgaden-Musik. «Versuch das einmal!», forderte er ihn auf. «Es stammt von Leopold Mozart, dem Vater des grossen Wolfgang Amadeus, der bereits als Sechsjähriger in Konzertsälen aufgetreten ist.»
Jakob setzte an, spielte die ersten Takte, zögerte, spielte weiter. Manchmal unterliefen ihm Fehler. Sein Lehrer stand daneben, schweigend. Sophie verkrampfte die Hände. «Das ging schon ganz ordentlich», meinte Fresendorff, als der Junge schliesslich aufblickte. «Das werden wir jetzt üben, bis es sitzt, und so werden wir es in Zukunft mit allem halten, was ich dir gebe.»
Alexander von Kutzschenbach
1
Immer nach Ostern, wenn Wildtulpen die Steppe in einen bunten Blumenteppich verwandelten, über den bereits frühe Schmetterlinge gaukelten, liessen Sophie und Simon ihre Buben in der Obhut von Mayranoush und Cornelius Fresendorff zurück und fuhren für ein paar Tage nach Tiflis. Dort kauften sie all jene Dinge ein, die man auf Eben-Ezer benötigte und die in Katharinenfeld nicht zu bekommen waren. Die Diepoldswilers pflegten in jenem Hotel am vornehmen Golowin-Boulevard abzusteigen, in das sie Vitus von Fenzlau kurz vor seinem Tod eingeladen hatte.
Wie jedes Jahr war auch im Frühling 1881 ein Abend für die Oper reserviert. Dieses Mal besuchten sie das Gastspiel einer französischen Truppe, die mit Bizets «Carmen» durch Osteuropa und Russland reiste. Besonders die Habanera hatte es Sophie angetan. Am Vormittag des nächsten Tages erwarb sie in einem Musikgeschäft die Noten der Klavierversion der Arie.
Später spazierten sie durch die engen Gassen der Sololaki-Vorstadt. An den hölzernen Säulen der mit Schnitzereien verzierten Balkone der Wohnhäuser rankten Weinreben in die Höhe. «Tbilissi – die vielbalkonige Schönheit», bemerkte Sophie auf Russisch. Simon schaute sie fragend an.
«So hat Jakow Petrowitsch Polonski die Stadt beschrieben», erklärte sie. «Er war ein Dichter und arbeitete während seines Aufenthalts im Kaukasus für den Gouverneur. Mein Vater kannte ihn. Er hat mir viel von ihm erzählt.»
Hinter den Häusern des Viertels stiessen sie auf einen jener gewundenen Pfade, die durch einen mit Gestrüpp und Wald bewachsenen steilen Hang hinauf zum Mtazminda führte. «Mta» heisse auf Georgisch Berg und «zminda» heilig, übersetzte Sophie und bat Simon, mit ihr auf den Gipfel zu steigen.
Schon als Backfisch war sie auf dem heiligen Berg gestanden. Ihr Vater, den sie damals noch für ihren Paten hielt, hatte sie 1869 als Vierzehnjährige zum ersten Mal nach Tiflis mitgenommen. Seit Tagen hatte sie sich auf den Ausflug gefreut, und als es endlich so weit war, hatte sie sich schön gemacht und herausgeputzt. Sie trug ein weisses Musselinkleid mit gestuften Volants und dazu einen breitrandigen Strohhut mit einem hellblauen Band, das, wie sie fand, in einem reizvollen Kontrast zu ihren blonden Locken stand. Mayranoush hatte ihr sogar etwas Wangenrouge aufgetragen.
Ihre weissen, engen Schnürstiefelchen waren für den steilen Aufstieg zum Mtazminda gewiss nicht das geeignete Schuhwerk, und Sophie war froh, als sie auf halber Höhe, mitten in der Wildnis, eine Kuppelkirche mit Glockenturm erreichten, bei der sie rasten durfte. Der Baron erzählte ihr, das Gotteshaus sei Dawit geweiht, einem jener dreizehn frommen syrischen Väter, die im sechsten Jahrhundert ins Land gekommen waren, um den Ungläubigen mit dem Höllenfeuer zu drohen und ihnen den rechten Weg zu weisen. Im Innern der Kirche blieben sie vor einer Ikone stehen. Auf Goldgrund war ein Heiliger dargestellt. Er trug ein senfgelbes Kleid und einen blauen Überwurf. In der linken Hand hielt er eine Bibel. Er hatte gepflegtes, schwarzes Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel, und einen akkurat getrimmten Bart.
«Als käme er direkt aus dem Friseursalon», spöttelte von Fenzlau und behauptete, so habe Dawit natürlich nicht ausgesehen. «Er hauste hier oben in einer Höhle. Ich stelle mir vor, dass er sich nur mit kaltem Wasser waschen konnte. Vermutlich verbreitete er keinen Rosenduft. Sein Haar, falls er welches hatte, hing ihm bis über die Schultern und war verfilzt und gewiss voller Läuse, ebenso der Bart, der die Brust bedeckte. Sein Kleid war bestimmt von minderer Qualität und vielfach geflickt. Möglicherweise ernährte er sich wie Johannes Baptista von Heuschrecken und wildem Honig.» Dann erzählte er Sophie halblaut die Legende von Dawit.
Einmal in der Woche sei der Eremit hinunter in die Stadt gestiegen, um dort, sehr zum Missfallen der zoroastrischen Priesterschaft, den Heiden das Evangelium zu verkünden. Um sich des Konkurrenten zu entledigen, hätten sie eine Schwangere dazu angestiftet zu behaupten, sie sei von Dawit vergewaltigt worden. «Die aufgebrachte Menge wollte den Heiligen steinigen. Der aber berührte mit seinem Stab den Bauch seiner Anklägerin und fragte den Fötus, wer sein Vater sei. Und dieser, oh Wunder, gab Auskunft, und die Verleumderin gebar auf der Stelle einen Stein. Daraufhin schüttelte Dawit den Staub der Stadt Tiflis von den Füssen und wanderte nach Kachetien, wo er das Höhlenkloster Garedscha gründete und mit seinen Anhängern ein gottgefälliges Leben bis an sein seliges Ende führte.»
Sophie hatte während der Erzählung den Paten aus den Augenwinkeln beobachtet. Unter seinem dichten Schnurrbart zuckte es verdächtig. Sie wusste, dass er sich über den Gottesmann lustig machte. Zu ihrem Kummer gehörte der Baron zur Schar der Ungläubigen. Luise Hegele, die Frau des Pastors von Katharinenenfeld, bei deren Familie sie während der Wintermonate lebte, hatte ihr ans Herz gelegt, für sein Seelenheil zu beten. Er brauche es. Mit der ganzen Inbrunst, zu der ein junges Mädchen fähig ist, flehte sie Abend für Abend den Herrn Jesus an, die unsterbliche Seele ihres geliebten Paten zu retten.
Vom Gipfel des Mtazimda bot sich Simon und Sophie ein überwältigender Ausblick. Unter ihnen lag die Stadt, die sich zwischen den Ausläufern des Saguramibergrückens und dem östlichen Teil des Trialetischen Massivs zu beiden Seiten der Kura ausbreitete. Es war ein ungewöhnlich klarer Tag. Im Nordosten waren die schneebedeckten Berge des Grossen Kaukasus zu erkennen. Der Anblick des fernen Gebirges weckte in Simon Erinnerungen an seine Jugend in der Schweiz.
«Was beschäftigt dich?» Sophie kannte das Gesicht ihres Mannes, wenn seine Gedanken in die Vergangenheit abschweiften.
«Nichts Besonderes.» Ohne zu wissen, weshalb, hatte sich Simon immer geschämt, ihr zu erzählen, dass er, gerade einmal elf Jahre alt, als elendes Knechtlein zu einer Kleinbauernfamilie in eine Kinderhölle verdingt worden war. Er litt auch unter seiner mangelhaften Bildung. Seine Frau wusste lediglich, dass er nach dem Tod seiner Schwester dank Lydia Amsoldinger, der Pflegemutter seines Bruders, bei zwei gütigen Täufern das Käserhandwerk hatte erlernen dürfen. Auch dass sein Bruder Jakob ihn nach Grusinien begleitete hatte und drei Tagesreisen nördlich von Eben-Ezer ums Leben gekommen war, wusste sie. Simon hatte ihn am Ufer der Kura bei Uplisziche begraben. Damals war in ihm die Angst gewachsen, dass alle Menschen, die er liebte, vorzeitig zu Tode kommen müssten. Er glaubte es noch heute.
«Gehen wir weiter», sagte er. Sie wanderten über einen mit duftenden Kiefern bewachsenen Kamm zur Ruine der Festung Nariqala. Sie hatte eineinhalb Jahrtausend jedem feindlichen Ansturm getrotzt und war erst 1827 zerstört worden, als ein Blitz die Pulvervorräte der russischen Besatzer in die Luft sprengte. Sophie und Simon suchten sich auf dem alten Gemäuer ein sonniges Plätzchen und schauten über die Türme, Kuppeln und Dächer zur Metechi-Kirche, die auf dem Felsenband über dem linken Kuraufer stand. Sophie lehnte den Kopf an die Schulter ihres Mannes. «Was für Leute mögen dort drüben leben?», fragte sie und wies auf die ineinander verschachtelten Häuser und Häuschen hinter dem Gotteshaus.
Simon, der oft nach Tiflis fuhr, schwieg. Er kannte das Avlabari-Viertel, in dem Familien in heruntergekommenen Behausungen lebten und von deren Kindern manchmal nicht gewiss war, welcher Mann sie gezeugt hatte. Sophie brauchte nicht zu wissen, dass er dort bis zu seiner Heirat ab und zu Huren aufgesucht hatte, Frauen aus ganz Transkaukasien, die in den engen, schmutzigen Gassen zwischen Handwerkern, Krämern und lärmigen Kneipen ihrem Gewerbe nachgingen und ihren Kunden gegen ein geringes Entgelt für eine Stunde die Illusion gaben, geliebt zu werden.
Als sie am späten Nachmittag dieses Tages im Salon des Hotels beim Tee sassen, trat Herr von Kutzschenbach an ihren Tisch und fragte, ob er ihnen Gesellschaft leisten dürfe. Er küsste Sophies Hand. Über ihr Gesicht huschte ein rätselhaftes Lächeln. Sie dachte an ihren Vater, der aus Livland stammte. Er hatte sich mehr als einmal über Alexander von Kutzschenbach lustig gemacht. Weil er auf einem brandenburgischen Rittergut aufgewachsen war, hatte er ihn als preussischen Junker bezeichnet und sich darüber mokiert, dass der Mann seinen Schnurrbart à la Wilhelm trug: buschig und an den Enden aufwärts gezwirbelt. «Fehlt nur noch, dass er sich auf beiden Wangen ein Gestrüpp wachsen lässt, wie sein Idol», pflegte er zu sagen. Er spielte damit auf den imposanten Backenbart des Monarchen an. Mit seiner ganzen Deutschtümelei verstehe es Kutzschenbach ausserdem bestens, sich im Gouverneurspalast beim Vizekönig, seiner kaiserlichen Hoheit Grossfürst Michail Nikolajewitsch Romanow, Liebkind zu machen. Das habe ihm ein zinsloses Darlehen eingebracht. Man werde sehen: Am Schluss verleihe ihm der Zar noch einen russischen Adelstitel. So seien sie eben, die Reichsdeutschen: geschmeidig und berechnend.
«Was für ein Zufall, dass ich Sie hier treffe», wandte sich von Kutzschenbach an Simon. «Ich beabsichtigte nämlich, Sie in den nächsten Tagen aufzusuchen.» Er besitze unweit von Dmanissi einen rund tausend Dessjatinen grossen Wald, den er verkaufen wolle, fuhr er fort. «Er grenzt direkt an Ihren Forst, und wie ich höre, möchten Sie Ihre Waldungen vergrössern.»
Das traf zu. Seit der Viehbestand von Eben-Ezer auf rund tausend Stück angewachsen war, hingen in der Käserei sechs grosse Kupferkessel mit einem Volumen von je hundert Litern. Unter ihnen standen drei Feuerwagen, mit denen man die Hitze regulieren konnte. Man brauchte sie nur hin- und herzuschieben. Aber es war abzusehen, dass man langfristig mehr Brennholz benötigen würde, als im eigenen Wald, wo man auch Bauholz schlug, nachwuchs. Dawit Achwlediani, der grusinische Obersenn, hatte schon davon gesprochen, zusätzlich Kuhdung als Brennmaterial zu verwenden. Aber Simon war die Vorstellung, seinen Emmentaler mit Mist zu produzieren, unangenehm. Das Angebot Kutzschenbachs kam ihm deshalb wie gerufen.
«Weshalb wollen Sie den Forst abstossen?», fragte Sophie.
Der Deutsche schaute sie erstaunt an. Er war es nicht gewohnt, dass sich eine Frau in Männergeschäfte einmischte. Dann lachte er. «Das will ich Ihnen gern sagen, Madame. Ich brauche flüssige Mittel und verkaufe deshalb Land. Nicht nur diesen Wald. Ich will bei Saparlo östlich von Dmanissi eine Tochtersiedlung mit einer Glashütte und zwei Ziegeleien aufbauen. Ein deutscher Direktor wird das Ganze leiten. Wir werben in Schlesien Glasfacharbeiter an. Für die Herstellung von Backsteinen und Ziegeln werden wir Perser, Griechen und Tataren anlernen. Das Dorf soll Alexandershütte heissen.»
Wie viel der Wald denn kosten solle, wollte Simon wissen.
«Fürst Zviad Ratischwili wäre bereit, fünftausend Rubel zu bezahlen. Ich verkaufe ihn Euch für dieselbe Summe plus einen Rubel, damit ich dem Hurensohn sagen kann, Ihr hättet mir ein besseres Angebot gemacht.»
Ratischwilis Hof befand sich in Kariani, südlich von Eben-Ezer. «Lass dich von seinem Titel nicht beeindrucken», hatte sein Schwiegervater Simon einmal gesagt. «1793 hat der Zar den adeligen Familien in Grusinien dieselben Privilegien gewährt wie dem russischen Adel. Sie alle dürfen sich Knjaz nennen, egal ob sie von königlichem Geblüt sind oder nur Krautjunker wie Ratischwili, der nicht einmal hundert Kühe besitzt. Die grosse Zeit seines Geschlechts ist längst vorbei.»
Der Preis scheine ihm hoch, meinte Simon. Für das Geld könne man eine Käserei samt dem dazugehörigen Inventar kaufen.
«Was nützt die schönste Käserei, wenn das Holz fehlt, den Käse zu produzieren?» Von Kutzschenbach lehnte sich zurück. «Wissen Sie was? Ich lade Sie und Ihre Familie ein, die Pfingsttage bei uns auf Mamutlie zu verbringen. Wir können dann in aller Ruhe die Einzelheiten besprechen.» Offenbar war er sich sicher, dass der Handel zustande kommen würde.
Wieder kam Sophie ihrem Mann zuvor: «Wir nehmen Ihre Einladung gerne an, Herr von Kutzschenbach.»
Als sie am nächsten Tag nach Eben-Ezer zurückfuhren, sang Sophie leise den Text der Habanera: L’amour est un oiseau rebelle.
«Was heisst das?», wollte Simon, der kein Französisch verstand, wissen.
«Die Liebe ist ein wilder Vogel.»
«Ist sie das?»
«Manchmal schon.» Sie schmiegte sich an ihn.
«Aha.» Simon war mit seinen Gedanken woanders. «Weshalb weiss von Kutzschenbach, dass ich unseren Forst vergrössern muss?»
Sophie rückte von ihm ab. «Gottlieb Graf wird es ihm gesagt haben. Du hast ihm ja von deinen Sorgen erzählt.»
Gottlieb Graf betrieb in Karabulakhi, fünf Werst nördlich von Eben-Ezer, Milchwirtschaft. Er stammte aus Reichenbach im Berner Oberland und war vor fünfzehn Jahren nach Grusinien gekommen. Wie die Ammeters, die Siegenthalers und andere Schweizer hatte er ein paar Jahre auf Kutzschenbachs Gutshof Mamutlie als Käser gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. Er hatte Käthi Bieri geheiratet, die Barbara von Kutzschenbach als Hausmädchen zur Hand gegangen war. Die Grafs und die Diepoldswilers waren Nachbarn. Man besuchte sich gegenseitig.
«Natürlich!» Simon schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. «Er wird es von Gottlieb erfahren haben.»
«Kutzschenbach kann den Hals nicht vollkriegen», stellte Sophie fest. «Es genügt ihm nicht, Grossgrundbesitzer zu sein. Nein, er will auch noch Unternehmer werden. Alexandershütte! Wenn du mich fragst, geht es ihm nicht darum, einen unserer drei Zaren dieses Namens zu ehren, sondern allein sich selbst: Alexander von Kutzschenbach.»
«Und weshalb hast du seine Einladung angenommen, wenn du ihn nicht magst? Weisst du überhaupt, ob mir das passt?»
«Ach Simon!» Sie legte ihre Hand auf seinen Arm. «Vielleicht hättest du Nein gesagt. Aber ich wollte schon lange einmal Mamutlie sehen. Du weisst doch, wie neugierig ich bin. Man hört so viel über Herrn von Kutzschenbach und seine Frau.»
Das liess sich nicht leugnen. Um die abenteuerlichen Umstände der Heirat des Deutschen und den Aufbau seines Gutes rankten sich Legenden.
Alexander von Kutzschenbach galt als Abenteurer. In Katharinenfeld erzählte man sich, sein Vater, ein preussischer Rittergutsbesitzer, habe mit einem ungeschickten Landerwerb einen grossen Teil des Familienvermögens verloren, weshalb sein Ältester in den frühen Sechzigerjahren aufgebrochen sei, um sein Glück in Transkaukasien zu suchen. Anders als Simon, der derselben Auswanderergeneration angehörte, sich aber dank der Heirat mit Sophie in ein gemachtes Nest setzten konnte, hatte der Deutsche ganz von vorn beginnen müssen. Als der Siebenundzwanzigjährige 1862 nach Grusinien gekommen war, liess er sich hundert Werst südwestlich von Tiflis, nahe der Grenze zur Türkei, nieder. Die Gegend, in der fast nur Tataren lebten, galt als unsicher. Aber das focht ihn nicht an. Er pachtete zweitausendsechshundert Hektaren Wildnis und machte sich daran, sie urbar zu machen.
Auch seine Frau war eine bemerkenswerte Person. Von Kutzschenbach, der in den Bernischen Blättern für Landwirtschaft einen Obersenn gesucht hatte, stellte 1863 ihren bereits fünfzig Jahre alten Vater an, den Käser Christian Scheidegger aus Lützelflüh. Die damals dreiundzwanzig-jährige Barbara begleitete ihre Eltern in den fernen Kaukasus. Zunächst hausten die Auswanderer, gemeinsam mit dem Patron, unter primitivsten Bedingungen in einer tatarischen Erdhütte, einer in einen Hang gegrabenen Höhle, die man durch einen Türsturz aus unbehauenen Balken betrat. Sie bestand aus einem einzigen Raum, in dem man knapp stehen konnte. Man schlief auf Strohsäcken. Gekocht wurde auf einem alten Herd, der gleichzeitig als Ofen diente. Ein Bach in der Nähe lieferte das notwendige Wasser. Unter den beengten Verhältnissen kam es, wie es kommen musste: Der Preusse schwängerte die um fünf Jahre jüngere Barbara und heiratete sie.