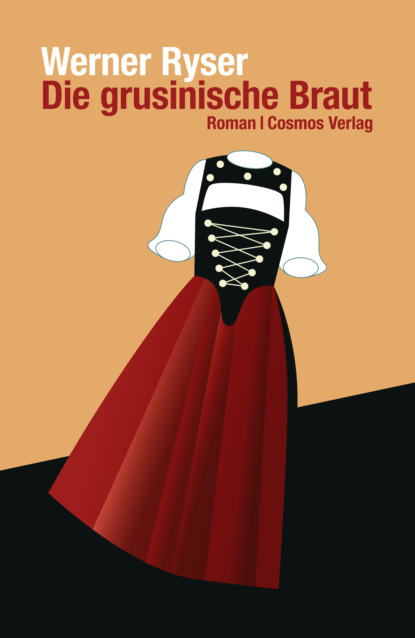- -
- 100%
- +
Vitus’ Mutter, Amalie von Fenzlau, hatte dort mit ihren Söhnen jeweils die Sommerfrische verbracht. Wenn der Hauslehrer ihn und Gregor am frühen Nachmittag aus dem Unterricht entlassen hatte, pflegte sich Vitus auf dem väterlichen Hof herumzutreiben. Er half mit, wenn die Bauern, die Baron von Fenzlau Frondienst schuldeten, das Gras für die Winterfütterung des Viehs einbrachten. Er sah ihren Frauen und Töchtern zu, die morgens und abends die hundert Kühe melkten, und er stand neben Karl Schüpbach, wenn dieser die erwärmte und geronnene Milch mit der Käseharfe im grossen Kessel, der am Turner hing, verrührte.
Schüpbach, ein untersetzter kräftiger Mensch mit einem stets geröteten Nacken, war für die von Fenzlaus der Schweizer, wie die Balten den Beruf des Senns bezeichneten. Er war zuständig für die Überwachung der Herde, und er verarbeitete die Milch zu Butter und Käse, goldgelbe, kreisrunde Emmentaler, die vom Baron mit gutem Gewinn nach Sankt Petersburg verkauft wurden, wo man sie, wie es hiess, am Zarenhof schätzte. Das mochte wahr sein oder nicht. Schüpbach jedenfalls platzte fast vor Stolz, als er Vitus einmal verriet: «Dr Cheiser frisst myn Chäs.» Vitus, der sich häufig im Stall und im Käsekeller herumtrieb, verstand inzwischen, zumindest teilweise, den Dialekt des Senns, von dem die Baronin behauptete, er sei eine unmelodische Abfolge von Krachlauten.
Einmal, Vitus stand kurz vor seiner Abreise nach Sankt Petersburg, wollte er vom Käser wissen, weshalb er 1810 seine Heimat verlassen habe und seither in Livland lebe.
«Wegen dem Näppi», erklärte Schüpbach kurz angebunden.
Näppi – wieder so ein schweizerdeutscher Ausdruck. Vitus musste nachfragen, bis er begriff, dass Napoleon gemeint war.
«Die Eidgenossenschaft war verpflichtet, diesem Blutsäufer jedes Jahr sechzehntausend junge Männer für seine Armee zu stellen», empörte sich Schüpbach. «Kaum einer ging freiwillig. Und so liess man das Los entscheiden. Wenn es einen Reichen traf, so konnte er sich freikaufen. Das war ganz einfach. Er musste nur einen Habenichts finden, den er dafür bezahlte, dass er für ihn die Haut zu Markte trug. Die Not war gross. Viele hatten keine Arbeit. Manche litten Hunger. Da war es besser, das Geld zu nehmen, das den Angehörigen für ein paar Monate das Überleben sicherte, als darauf zu warten, dass einen das Los im nächsten Jahr selber traf und man gratis sterben musste.»
«Und damit du dich nicht totschlagen lassen musstest, bist du aus der Schweiz ausgewandert?», wollte Vitus wissen.
Der Senn fasste ihn unterm Kinn und zwang ihn, ihm in die Augen zu schauen. «Nein Bub, wann und wie wir sterben, liegt in Gottes Hand. Ich bin gegangen, weil ich niemanden totschlagen wollte. Meine Familie ist mennonitisch. Unser Glaube verpflichtet uns, keine Waffen zu tragen und den Kriegsdienst zu verweigern. Manche von uns werden deshalb ins Gefängnis geworfen, andere wandern aus. So wie ich.»
Wie das seine Gewohnheit war, wenn sein Regiment ins Feld zog, galoppierte Theodor Dreyling einmal im Tag seiner Einheit voraus, um vom rechten Strassenrand aus die Soldaten zu inspizieren, die an ihm vorbeimarschierten. Flankiert wurde er dabei von einem höheren Unteroffizier, der die Regimentsfahne neben sich in den Boden gerammt hatte, und von Leutnant von Fenzlau. In der Regel fand dieses Ritual am Nachmittag statt, wenn die militärische Zucht der Männer zu wünschen übrigliess, weil sie vom langen Marsch müde waren. Kerzengerade, seine Linke auf den Degen gestützt, sass der Oberst auf seinem Pferd und gab sich den Anschein, als fasse er jeden einzelnen seiner Soldaten, die auf ein scharfes Kommando ihrer Vorgesetzten den Kopf grüssend nach rechts warfen, ins Auge. Von Zeit zu Zeit knurrte Dreyling: «Vierte Kompanie, dritter von rechts im fünften Glied, ein Dutzend!» Oder: «Zwölfte Kompanie, im achten Glied, Flügelmann links, zwei Dutzend!»
Vitus fragte den vorgesetzten Korporal nach dem Namen des Betroffenen, notierte die Anweisungen des Obristen in sein Notizbuch und versäumte nicht, am Abend den zuständigen Kompaniekommandanten daran zu erinnern, dass ein Unteroffizier dem Unglücklichen mit der Knute den nackten Hintern zu verstriemen habe. Die Kameraden schauten zu und wetteten um ein Glas Wodka, ab welchem Streich der Delinquent zu schreien anfange. Alle schrien, das war so sicher wie das Amen in der Kirche, denn für den Mann, der die Exekution durchführte, war dies eine Frage der Ehre.
Anfänglich hatte Vitus versucht herauszufinden, nach welchen Kriterien der Oberst die Männer bestrafen liess, bis er realisierte, dass es sich um reine Willkür handelte. «Ich will für meine Leute ein Exempel statuieren», hatte der Onkel seine Frage beantwortet. «Keiner soll sicher sein, am Abend nicht verprügelt zu werden. Wenn mich die Kerle nicht mehr fürchten als den Feind, dann taugen sie nicht für die Schlacht.»
Kein einziger von ihnen war freiwillig beim Militär. Der Zar brauchte Kanonenfutter, Männer, die für ihn starben. Es waren Leibeigene, die irgendeinem Gutsbesitzer gehört hatten. Junge Burschen, die keine gute Arbeit leisteten oder widerspenstig waren, wurden für fünfundzwanzig Jahre in die Armee abgeschoben. Damit sie unterwegs nicht davonliefen, trugen manche Ketten, wenn man sie dem Regiment zuführte, in dem sie zu dienen hatten. Dort brachte man den zum Waffendienst gepressten Kreaturen bei, wie man erhobenen Hauptes in den Tod marschiert, wie man schiesst und dem Feind mit dem aufgepflanzten Bajonett den Bauch aufschlitzt.
Als Soldaten galten sie vor dem Gesetz zwar als frei. Tatsächlich aber waren sie von nun an Untertanen ihres Regiments, und es verging kein Tag, an dem nicht einer von ihnen für ein geringfügiges Vergehen von irgendeinem Offizier mit dem Stock gezüchtigt oder vom Profos ausgepeitscht wurde.
Selber in einem aristokratischen Haus aufgewachsen, machte sich der junge von Fenzlau wenig Gedanken über die Niedriggeborenen. Sie waren dazu da, dem Adel zu dienen. Sie galten als ungebildet und unkultiviert. Man betrachtete sie als eine Art unmündige Kinder, die man eben bestrafen musste, wenn sie ungehorsam waren.
Oberst Dreyling, der in Sankt Petersburg ein grosses Haus besass, hatte sich im Balkan, wo sich die Russen seit hundert Jahren mit den Osmanen herumschlugen, Stufe um Stufe bis zum Regimentskommandanten hochgedient. In der Familie nannte man den einen Meter neunzig grossen und weit über hundert Kilogramm schweren Koloss respektvoll «Türkenschreck». Wenn er, selten genug, seine Verwandten in Riga besuchte, brach er wie ein Unwetter ins Haus von Vitus’ Eltern an der Jekaba ielea ein: laut, lärmend – eine Urgewalt. Er ass Unmengen, die er mit reichlich Alkohol hinunterspülte, kniff seine beiden Neffen in die Wangen und die Mägde in den Hintern. In weinseliger Stimmung begann er Geschichten von aufgeschlitzten Türken, von Hurenweibern und Hurenböcken zu erzählen, worauf die Mutter ihre beiden Söhne schleunigst in ihre Zimmer verbannte.
Während seiner Zeit in der Kadettenanstalt verbrachte Vitus seine freien Tage im Haus der Dreylings am Newskij Prospekt, unweit der Brücke, welche die Fontanka überquerte. Der Onkel war selten zuhause. Meist befand er sich im Krieg gegen die Türken oder die Perser. So blieb es Leonore, seiner jungen Frau, überlassen, sich um den Neffen zu kümmern. Mit den Kindern der Dreylings konnte Vitus wenig anfangen. Seine beiden Cousinen, die Zwillinge Charlotte und Carolina, waren dreizehn Jahre jünger als er, und ihr kleiner Bruder Adrian musste noch gewickelt werden.
Als die Baronin von Fenzlau einmal in Sankt Petersburg zu Besuch war, hörte Vitus, wie seine Mutter dem Onkel sagte, dass sie, falls er nichts dagegen einzuwenden habe, in Erwägung ziehe, zwischen ihrem Sohn und einer seiner beiden Basen, sobald sie mannbar sein würden, eine Heirat zu arrangieren. Vitus, der Lini und Lotti nicht auseinanderhalten konnte, betrachtete amüsiert die damals Dreijährigen und versuchte sich vergeblich vorzustellen, wie sie wohl im Brautkleid aussehen würden. Er vergass das Gespräch wieder. Erst als ihm der Onkel nach dem Abschluss der Ausbildung an der Kadettenanstalt eine Offiziersstelle in seinem Regiment anbot und andeutete, dass er für eine rasche Beförderung sorgen werde, erinnerte sich Vitus an die Heiratspläne seiner Mutter. Die Aussicht, eines fernen Tages Schwiegersohn eines Obristen zu werden, den der Zar möglicherweise noch zum General machen würde, war allerdings nicht der Grund dafür, dass er das Angebot des Onkels annahm. Es war vielmehr schiere Abenteuerlust, die Vitus den Entscheid leicht machte. Das Regiment Dreyling erhielt damals, im März 1826, den Befehl, in Transkaukasien erneut gegen die Perser ins Feld zu ziehen. Im Krieg von 1804 bis 1813 hatte man sie bereits geschlagen, aber jetzt wollten sie ihre damals verlorenen Gebiete zurückerobern.
Vitus sollte seinen Entschluss nicht bereuen. Er liebte es, auf seinem Pferd neben der Truppe zu reiten, wenn sie singend in den Krieg zog. Er liebte es im Freien zu kampieren, umsorgt von Offiziersburschen, die darauf gedrillt waren, ihren Vorgesetzten, den sie als «Eure Durchlaucht» anzusprechen hatten, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Er liebte das Kartenspiel und die Besäufnisse mit seinen Kameraden. Er liebte es, mit kaukasischen Mädchen anzubandeln, die bereit waren, sich ihm für wenig Geld hinzugeben, und er liebte das prickelnde Gefühl einer bevorstehenden Schlacht.
3
Am 24. August 1828, fünf Tage nach dem Aufbruch in Katharinenfeld, erreichte das Regiment Minazde. Das Dorf lag an einem Berghang über der Kura, die sich hier in weitem Bogen nach Osten wandte. Auf der anderen Flussseite vor Alchaziche breitete sich eine Ebene aus. Oberst Dreyling war angewiesen worden, sich in Minazde mit seinem Regiment in Bereitschaft zu halten, bis der Befehl zum Sturm auf die Stadt erfolgen würde. Man errichtete das Lager. Die Männer, die vom Kommandanten im Verlauf des Tages dazu verurteilt worden waren, wurden verprügelt. Anschliessend verpflegte sich die Truppe, und es wurden Wachen aufgestellt. Im Übrigen war man froh, dass man sich vor der Schlacht von den Strapazen des Marsches erholen, die Waffen in Ordnung bringen und im Fluss die verschwitzten Kleider waschen konnte.
Wenn Vitus von Fenzlau später über die Schlacht von Alchaziche sprach, schilderte er sie so, als habe er das Geschehen als unbeteiligter Zuschauer beobachtet. Was in gewisser Weise auch zutraf. Als Flügeladjutant hielt er sich in der Regel weit hinter der Front auf und wurde lediglich manchmal nach vorn zu einem der vier Bataillonskommandanten geschickt, dem er eine Order des Obristen zu überbringen hatte. Aber auch jene pflegten ihre Gefechtsstände im sicheren Bereich hinter der Kampfzone einzurichten.
Am 27. August ritt Vitus um vier Uhr in der Früh mit dem Onkel über die Brücke, die Pontoniere über die Kura geschlagen hatten. Am Westufer inspizierte der Oberst die Gefechtsbereitschaft seiner Bataillone. Die Soldaten in ihren weissen Hosen und den grünen Uniformröcken mit dem Kreuzbandelier, an dem die Patronentaschen und das Seitengewehr hingen, standen stramm, als Dreyling, gefolgt von ein paar Offizieren, langsam an ihnen vorbeiritt. Vitus betrachtete die verschlossenen, angespannten Gesichter der Männer. Plötzlich fiel ihm ein, dass mancher von ihnen den Tag nicht überleben würde. Er scheuchte den Gedanken wie eine lästige Fliege beiseite.
Zwei Stunden später, kurz vor Sonnenaufgang, begann die Feldartillerie, die während der Nacht in Stellung gebracht worden war, Alchaziche mit einem gewaltigen Bombardement unter Beschuss zu nehmen. Es war, als habe die Hölle ihren Schlund aufgetan. Vitus stand neben seinem Onkel auf dem Dach ihrer Unterkunft, von wo aus sie den Kampf durch ihre Fernrohre beobachteten. Er hörte das Donnern und Brüllen der Kanonen, die den Tod aus ihren Rohren spien. Er sah, wie Häuser in Flammen aufgingen. Er sah, wie lange Menschenkolonnen die brennende Stadt verliessen. Er sah das Mündungsfeuer und den Pulverdampf, der zeitweise die Türme der Festung und die Kuppel der grossen Moschee in einen grauen Schleier hüllte. Er stellte sich vor, wie die Erde unter dem Rückstoss der Geschütze, die sich auf die Lafetten übertrug, zitterte. Dann vernahm er die Trommelwirbel, welche die langgezogenen grünweissen Reihen der Soldaten vorwärtstrieb. Durch sein Fernrohr sah er, wie das Stadttor geöffnet wurde und eine türkische Kavallerieeinheit mit gezogenen Krummsäbeln und gefällten Lanzen die Russen im Galopp frontal angriff.
«Bildet endlich eure Karrees!», knurrte der Oberst, und als ob sie ihn gehört hätten, formierten die Infanteristen, wie sie das in endlosen Exerzierstunden geübt hatten, fünf Gevierte. Die Männer der äussersten Reihe knieten, jene hinter ihnen standen. Die aufgepflanzten Bajonette auf ihren Gewehren bildeten einen Stachelwall, vor dem die Pferde der Muselmanen scheuen würden. Die Offiziere im Zentrum der Verteidigungsstellungen konnten warten, bis der Feind nah genug war. Jede Reihe hatte nur einen Schuss. Für einen zweiten war die Zeit zu knapp. Es dauerte zu lange, bis das Schwarzpulver in den Lauf der Vorderladermusketen geschüttet und die Kugel mit dem Ladestock hinterhergestopft war.
Vitus hörte die Salve, welche die Russen auf den anstürmenden Feind abfeuerte. Er sah, wie zahlreiche Pferde stürzten, wie reiterlose Tiere in Panik gerieten und ziellos über das Schlachtfeld galoppierten. Ohne sein Fernrohr vom Auge zu nehmen, befahl ihm der Oberst, die Bataillonskommandanten anzuweisen, die Karrees aufzulösen. Die Hälfte der Einheit solle in zehn Reihen zu je hundertfünfzig Mann gegen die türkische Infanterie vorrücken, die sich vor der teilweise zertrümmerten Stadtmauer aufgestellt hatte und den Feind erwartete. «Der Rest bleibt vorderhand als Reserve zurück. Reiten Sie endlich los, Herr Leutnant!», schrie Dreyling.
Vitus stieg auf seinen Kabardiner und gab ihm die Sporen. Als er seinen Auftrag erfüllt hatte und über die Brücke nach Minazde zurückkehrte, sah er, dass die Männer seines Regiments bereits auf den Feind zumarschierten, wie sie etwa siebzig Meter vor ihm stehen blieben und die inzwischen wieder geladenen Gewehre auf ihn anlegten. Eine kleine Ewigkeit lang standen sich die Russen und Türken gegenüber. Dann zerrissen zwei Salven die Stille. Auf beiden Seiten fielen zahlreiche Männer. Für Vitus sahen sie aus, wie die Figuren auf einer Kegelbahn. Er wusste: Jetzt würde das grosse Hauen und Stechen beginnen. Muslime und Christen würden aufeinander losgehen, die einen mit dem Krummsäbel, die anderen mit dem aufgepflanzten Bajonett. Man würde sich gegenseitig niedermetzeln, bis zum bitteren oder glorreichen Ende.
Es war ein gewaltiges Ringen, und es dauerte den ganzen Tag. Schritt für Schritt drängte die russische Infanterie, unterstützt von kosakischen Reiterverbänden, die Türken zurück. Am späten Nachmittag endlich hatte die Armee General Paskewitschs die Stadtmauer überwunden und die Kanonen der Verteidiger schwiegen. Als die Sonne hinter den dunklen Kämmen des Messchetischen Gebirges versank, wurde auf der Festung die weisse Fahne gehisst. Achalziche war gefallen.
Jetzt entschloss sich Oberst Dreyling, mit seinen Offizieren in die eroberte Stadt zu reiten. Das Schlachtfeld, das sie überqueren mussten, war vorher fruchtbares Ackerland gewesen. Die Menschen, die hier lebten, hatten seit dem Frühjahr mit schmerzenden Rücken und Schwielen an den Händen für ihr tägliches Brot geschuftet. Die Früchte ihrer Arbeit würden ihnen jetzt die Sieger nehmen.
Die ganze Ebene war mit den Leichen unzähliger, zum Kriegsdienst gepresster junger Männer bedeckt. Sie hatten sich gegenseitig massakriert und lagen nun in verdreckten und blutigen Uniformen herum. In teils grotesken Verrenkungen schienen sie über die mit Orden behangenen Höheren, die an ihnen vorbeizogen, zu spotten. Keiner von denen würde sie je wieder krummschliessen lassen, zu einer Prügelstrafe verurteilen oder nach ihrem Gusto persönlich züchtigen können. Genau gleich wie die Kadaver der Pferde von Freund und Feind lagen auch die toten Russen und Türken einträchtig auf den abgeernteten Feldern, in Gebüschen und Bächen. Vitus bemühte sich, sein Pferd nicht in Blutlachen treten zu lassen, auch nicht auf die abgetrennten Arme und Beine und die abgeschlagenen Köpfe, die überall herumlagen. Wie der Abfall in einem Schlachthof, dachte der Leutnant. Was irgendwie auch stimmte. Und auch hier flatterten Schwärme von Raben krächzend über dem Festmahl, das ihnen die Menschen bereitet hatten.
Noch schlimmer als der Anblick der verstümmelten Leichen waren die Hilferufe, das Stöhnen und Wimmern der zahllosen Verwundeten. Es war die Musik zum makabren Totentanz, den Zar Nikolaus im fernen Sankt Petersburg und Sultan Mahmut II. in Istanbul ausgerichtet hatten. Vitus sah junge Burschen, die noch nicht gestorben waren, obwohl ihnen die feindlichen Säbel und Bajonette den Bauch aufgeschlitzt hatten. Er sah Gesichter, die eine einzige Wunde waren, Männer mit abgehackten Gliedmassen, deren Stümpfe jemand notdürftig abgebunden hatte, damit sie nicht sofort verbluteten. Überall machten sich Unversehrte zu schaffen: Musiker der Regimentskapelle, die jetzt als Sanitäter eingesetzt wurden, und Bauernweiber aus der Umgebung. Sie mühten sich ab, die verletzten Männer, von denen viele weinten wie Kinder, auf Karren und Bahren, manchmal auch auf ihren Schultern nach Alchaziche zu bringen, in die Moscheen, die Kirchen und die Synagoge, die als Lazarette dienten, wo es den Pflegern an Verbandzeug, Medikamenten und Wasser mangelte und die Ärzte, mitten im Gestank von Wundbrand, Eiter und Blut Gliedmassen amputierten, nur um das Leben und Leiden der Unseligen um ein paar Tage zu verlängern.
4
Theodor Dreyling war von General Paskewitsch zum Militärgouverneur der Stadt und der dazugehörenden Provinz Mechetien ernannt worden. Der Oberst und sein Regiment würden hier bleiben, während der Rest der Kaukasusarmee weiter Richtung Westen vorstossen sollte, um die Türken ein zweites und ein drittes Mal aufs Haupt zu schlagen.
Der Oberst, der lieber hinter den Muselmanen hergejagt wäre, war zuerst ungehalten gewesen. «Seine Durchlaucht, der Graf von Jerewan, degradiert mich zum Gendarmen!», hatte er gebrüllt. Immer wenn er von Iwan Fjodorowitsch als «Seine Durchlaucht» sprach, wusste Vitus, dass der Onkel vor Wut schäumte. Bald hatte Dreyling aber realisiert, dass er als Gouverneur mit der Festung Rabat über eine standesgemässe Residenz verfügte, in der sich komfortabel leben liess. Zusammen mit seinem Neffen bewohnte er die luxuriösen Gemächer des vor den Russen geflohenen Paschas. Und er zweifelte nicht daran, dass es ihm innert kürzester Zeit gelingen würde, den türkischen, tatarischen, armenischen und jüdischen Bewohnern, welche die Stadt vorderhand nicht verlassen durften, den nötigen Respekt vor dem Zaren und Mütterchen Russland einzubläuen. Als Erstes liess er bei der Bevölkerung die Kriegskontributionen eintreiben. Dann gab er Anweisung, die zur Festung gehörende Moschee in eine Kirche umzuwandeln. Obwohl er Gottesdienste nur besuchte, wenn es sich nicht vermeiden liess, war er entschlossen, Alchaziche im Zeichen des Kreuzes zu regieren.
Ein paar Tage nach dem Sieg meldete sich Feldweibel Timofejew im Vorzimmer von Oberst Dreyling. Leutnant von Fenzlau schaute von den Papieren hoch, mit denen er beschäftigt war. Der graubärtige Unteroffizier stand stramm und meldete, er habe seinen Auftrag erfüllt. Draussen im Korridor würden fünf Weiber warten, die er mit seinen Leuten befreit habe.
Vitus erinnerte sich. Sein Onkel hatte den Feldweibel angewiesen, mit sechs Soldaten in der Stadt die Häuser der Reichen zu durchsuchen und sämtliche russischen und deutschen Sklaven zu befreien. «Ihre Neger und die übrigen Heiden mögen die Hurensöhne behalten», hatte er bestimmt. «Ebenso die gefangenen Tscherkessen, Inguschen, Tschetschenen und Dagestanen – kurz: das ganze Gesindel, gegen das wir im Nordkaukasus Krieg führen.» Dann hatte Dreyling seinem Neffen befohlen: «Gib Timofejew Rashid mit. Der spricht leidlich Russisch und kann ihm als Übersetzer dienen.»
«Ist der Mann auch vertrauenswürdig?», hatte Vitus wissen wollen.
«Wir haben seine Frau und seine Kinder in Geiselhaft genommen. Wenn er sie wiedersehen will, so wird er sich als nützlich erweisen müssen.» Theodor Dreyling hatte dröhnend gelacht.
Jetzt stand der Feldweibel also da und wartete darauf, dass der Flügeladjudant ihm sagen würde, was weiter zu geschehen habe.
«Nur fünf Frauen», staunte der Leutnant, «mehr nicht?»
«Nein, Euer Gnaden.» Mit einer vagen Geste drückte der Veteran, der über seine fünfundzwanzigjährige Dienstzeit hinaus in der Armee geblieben war, sein Bedauern aus. Alchaziche sei nur ein Umschlagplatz für den Sklavenhandel. Die meisten gefangenen Weissen seien ins Innere des Osmanischen Reichs geschafft und dort verkauft worden. «Nur fünf Weiber. Deutsche. Ich kann sie nicht verstehen.» Er zuckte mit den Schultern.
«Bring sie herein!»
Es stellte sich heraus, dass sie aus Katharinenfeld, Helenendorf und Annenfeld stammten. Bei den Überfällen vor zwei Jahren waren sie in Gefangenschaft geraten und hatten seither als Mägde für ihre muslimischen Herrschaften gearbeitet. Der Leutnant liess eine um die andere vortreten und nahm ihre Personalien auf. Er notierte schwäbische Namen: Käthe Sackmann, Maria Dangel, Babette Bart und Hilde Wegner. Als Balte hatte er keine Schwierigkeiten, sich mit ihnen zu verständigen.
Eine von ihnen, die Jüngste, hielt sich hinter den vier anderen versteckt. Ihr Haar war vollständig von einem Kopftuch bedeckt. Ausserdem trug sie einen viel zu grossen russischen Uniformmantel, den ihr der Feldweibel gegeben haben mochte. Sie trat als Letzte vor von Fenzlaus Schreibtisch und vermied es, ihn anzusehen.
«Wie heisst Ihr, und woher kommt Ihr?»
«Mein Name ist Barbara Grathwohl. Ich stamme aus Katharinenfeld», sagte sie leise.
Vitus hob den Kopf. «Seid Ihr etwa die Frau von Johannes Grathwohl?» Und als sie ihn mit grossen Augen anschaute und nickte: «Ihr seid frei, und ich werde dafür sorgen, dass Ihr zu ihm zurückkehren könnt.»
Barbara, die auf der langen Reise nach Georgien ihre Eltern und Geschwister verloren hatte, von einer Nachbarin an Kindes statt aufgenommen worden war und als Siebzehnjährige, kurz nachdem man sie verheiratet hatte, in die Gefangenschaft von Sklavenhändlern geraten war, begann zu weinen. «Frei», schluchzte sie. «Guter Herr Jesus, ich bin frei!»
Von Fenzlau stand auf. «Sorg dafür, dass die vier anderen unterkommen!», wies er den Feldweibel an. «Mit dieser hier», er fasste Barbara am Ellenbogen, «habe ich zu reden.»
Er führte die junge Frau in sein Zimmer, das Stube und Wohnraum in einem war. Dort liess er sie auf dem Sofa Platz nehmen, setzte sich neben sie und erzählte ihr von seiner Begegnung mit Johannes Grathwohl. «Euer Mann hat Euch nicht vergessen» schloss Vitus seinen Bericht. «Jeden Tag betet er um Eure Rückkehr.»
Sie schlug die Hände vors Gesicht und weinte.
«Jetzt ist doch alles gut», versuchte Vitus sie zu trösten. «Ihr werdet Euren Mann wiedersehen und gemeinsam ein neues Leben beginnen.»
«Wie soll ich ihm nur gegenübertreten?», schluchzte sie.
«Freut ihr Euch denn nicht, ihn wiederzusehen?»
«Weshalb sollte ich?» Erneut schlug sie die Hände vors Gesicht. Dann, mit stockender Stimme: «Als die persischen und tatarischen Teufel vor zwei Jahren unser Dorf überfielen, rissen sie jungen Mädchen und Frauen, auch mir, die Kleider vom Leib. Sie vergewaltigten uns vor den Augen der Umstehenden. Die Männer unseres Dorfes, die uns helfen wollten, wurden niedergeschlagen. Dann trieben die Unmenschen mich und die anderen wie Vieh nach Alchaziche, wo man uns verkaufte.»
Schweigend sassen sie nebeneinander, bemüht, sich mit den Schultern nicht zu berühren. Zwei junge Menschen, sie neunzehn, er einundzwanzig Jahre alt, getrennt durch ihr Schicksal, ihre Herkunft und ihren Stand.
Nach einer Weile sagte sie hart: «Mein Besitzer, Menhügan Agha, hat mich zur Hure gemacht. In den vergangenen zwei Jahren hat er mich mit drei anderen Nebenfrauen in seinen Haremsgemächern eingeschlossen. Ich war seine Lieblingssklavin.» Sie lachte bitter. «Er hat mich erniedrigt und missbraucht. Ich musste jederzeit bereit sein, seiner bösen Lust zu dienen, und wurde von der Hausherrin, die eifersüchtig auf mich war, geschlagen. Ich habe meine Ehre verloren und bin es nicht mehr wert, die Frau eines aufrechten und frommen Mannes zu sein. Ich kann nur beten, dass mein Johannes zu mir steht. Was soll mit mir geschehen, wenn er mich nicht mehr zurücknimmt?»