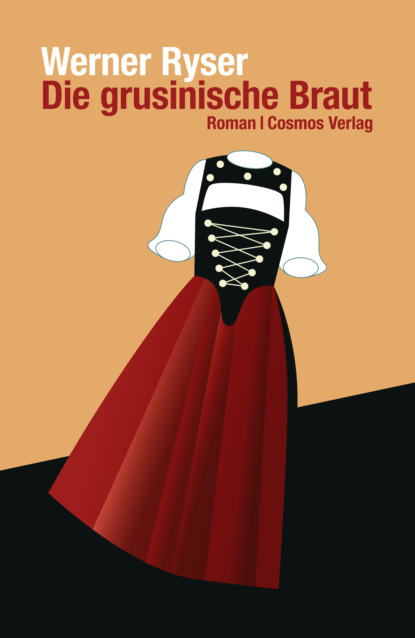- -
- 100%
- +
Darauf hatte Vitus keine Antwort. Kein Mann aus seinen Kreisen, der auf sich hielt, würde eine Frau zurücknehmen, die andere benutzt hatten. Je nach den Umständen würde man sie mit einem kleinen Geldbetrag abfinden.
Von Fenzlau suchte nach Worten. «Die Seele eines gläubigen Menschen kann auch in einem geschändeten Körper vor Gott bestehen», sagte er schliesslich. Er hatte diesen Satz vor Jahren einmal in einer Predigt des lutherischen Bischofs im Dom von Riga gehört. Das war vor seiner Zeit in der Kadettenanstalt gewesen. Er war damals noch fast ein Kind, und das Wort «geschändet» hatte ihn, ohne dass er wusste, was damit gemeint war, ausserordentlich beeindruckt. «Ja», bekräftigte er, «Gott sieht allein die Seele.»
«Gott schon, aber ein Ehemann?» Barbara erhob sich und schaute ihn verzweifelt an. Erneut füllten sich ihre Augen mit Tränen. «Verzeiht, dass ich Euch mit meinem Kummer behellige», stammelte sie. «Schaut mich an, schaut, was aus mir geworden ist!» Sie löste ihr Kopftuch. Ihr offenes, blondes Haar fiel auf ihre Schultern. Sie knöpfte den Uniformmantel auf und zog ihn aus. So stand sie vor ihm, eine kleine Gestalt in einem dunkelroten, mit Stickereien verzierten, hochgeschlossenen Kleid aus Musseline. Noch immer trug sie die Halsketten, Armreife und Ohrringe, die wohl Geschenke ihres Herrn waren. «Ich bin eine Hure», wiederholte sie flüsternd.
Sowohl in der Kadettenanstalt als auch später, unter den Offizieren der Kaukasusarmee, waren die Frauengemächer reicher Muselmanen Gegenstand schlüpfriger Diskussionen gewesen, welche die Phantasie der Jünglinge und Männer angestachelt hatte. Als Vitus jetzt zum ersten Mal eine Frau sah, die aus einem Harem kam, fühlte er sich unbehaglich und befangen. Ihm fiel Hanna Engist ein, die gesagt hatte, über den Schreckenstag von Katharinenfeld gebe es mehr als vierhundert verschiedene Geschichten. Wahrscheinlich war jene, die er soeben gehört hatte, nicht einmal die schlimmste. Er stellte fest, dass die junge Frau am liebsten vor Scham im Boden versunken wäre. Gleichzeitig sah er die Angst in ihren Augen und spürte, dass sie darauf wartete, dass er ihr etwas sagte, etwas, das ihr Hoffnung gab.
Er erhob sich und legte ihr die Hand auf die Schulter, zog sie aber sofort wieder zurück, als er spürte, wie sich ihr Körper versteifte. Offenbar missdeutete sie seine Geste. Glaubte sie, er wolle ihr zu nahe treten? Was bildete sie sich ein? Vitus war verletzt. Andererseits: Was verstand er schon von Frauen? Seine Mutter, Baronin von Fenzlau, und ihre Schwägerin, Leonore Dreyling, waren Damen: stolz, kühl, unnahbar. Er hatte nie herausgefunden, was sie dachten und fühlten. Dann gab es die Töchter aus adeligen Häusern, denen er in Sankt Petersburg an Bällen und Soireen im Haus des Onkels am Newskij Prospekt begegnet war. Sie trugen anmutige Abendkleider aus teuren Seidenstoffen, und ihre weiblichen Formen wurden durch ein Satinband betont, das unter der Brust zu einer Schleife gebunden war. Ausserdem rochen sie nach teuren Parfums. Ihr Daseinszweck schien einzig darin zu bestehen, darauf zu warten, dass ein meist deutlich älterer Gutsbesitzer, ein hoher Beamter oder ein Offizier um ihre Hand anhielt. Und schliesslich waren da noch die Mägde und Freudenmädchen, mit denen sich ein junger Mann aus gutem Haus gegen ein geringes Entgelt vergnügen konnte, wenn ihm danach der Sinn stand. So wie das Vitus von Fenzlau im Verlauf des Feldzugs der vergangenen zwei Jahre oft getan hatte.
Obwohl sie sich als Hure bezeichnet hatte, gehörte Barbara Grathwohl in keine dieser Kategorien. Doch was ging ihn ihr Schicksal an? «Ich bringe Euch zu den andern zurück», sagte er kühl. «Morgen werde ich Eure Rückkehr nach Katharinenfeld in die Wege leiten.»
5
Theodor Dreyling hatte seinen Neffen nach der Eroberung von Alchaziche zum Hauptmann befördert und dafür gesorgt, dass er als Kompaniekommandant in die Armee Iwan Fjodorowitsch Paskewitschs eintrat. Der Oberst war der Meinung, ein junger Offizier könne sich nicht mit Ruhm bekleckern, wenn er nichts anderes zu tun habe, als in einer eroberten Provinz für Ruhe und Ordnung zu sorgen. «Du brauchst Kampferfahrung und wirst lernen müssen, unter den Heiden Angst und Schrecken zu verbreiten. Später, wenn du einmal deine Hörner abgestossen hast», schloss er wehmütig lächelnd, «kannst du immer noch irgendwo im Hinterland als Militärstatthalter auf deinen Ruhestand warten.»
Und so war Vitus dabei gewesen, als der zum Marschall avancierte Graf von Jerewan in die Osttürkei vordrang, wo er die Bevölkerung drangsalierte, Dörfer in Flammen aufgehen liess, Kars, Dogubeyazit und Erzurum einnahm, die eroberten Gebiete Transkaukasien einverleibte und endlich dem gedemütigten Sultan im fernen Istanbul den erbetenen Frieden gewährte. Anschliessend folgte der frischgebackene Hauptmann seinem neuen Oberkommandierenden nach Dagestan.
In der Kadettenanstalt hatte man Vitus beigebracht, dass russische Truppen in Transkaukasien stünden, um die christlichen Georgier und Armenier vor der Tyrannei der Muslime zu schützen: den Bergtataren im Norden, den Persern im Süden und den Türken im Westen. Natürlich war das eine fromme Lüge. Die Zaren gierten nach dem fruchtbaren Land zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. Ausserdem bildete das Kaukasusgebirge die perfekte Grenze ihres Reichs aus Fels und Eis.
Aber auch wenn Alexej Petrowitsch Jermolow, der damalige Generalgouverneur der transkaukasischen Provinzen, bereits 1820 in schamloser Übertreibung der tatsächlichen Lage nach Sankt Petersburg gemeldet hatte, «die Unterwerfung des stolzen kriegerischen und bis dahin unbesiegten Landes liegt zu den geheiligten Füssen Eurer Majestät», mochten die Bergvölker unter ihrem Imam, Ghazi Muhammed, die Herrschaft Zar Niklaus’ noch immer nicht anerkennen. Sie verweigerten dem Feind eine offene Schlacht und fügten stattdessen den Russen empfindliche Verluste zu, indem sie deren Patrouillen aus dem Hinterhalt angriffen und die Festungen und Forts der kaukasischen Linie überfielen, welche die Zaren im Gebirge zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer hatten bauen lassen.
Derbent, die alte, von einem Kastell und hohen Mauern geschützte, orientalische Stadt am Kaspischen Meer, durch deren mächtige Tore Karawanen Richtung Russland zogen, wurde für von Fenzlau für ein paar Jahre zur neuen Heimat. Man wies ihm eine Wohnung im Haus der Frau eines gefallenen Offiziers zu. Sein Diener Wassilij wurde in einer Kammer unter dem Dach einquartiert. Der Russe war zwei Jahre älter als sein Herr. Er war als Leibeigener auf einem Gut in der Gegend von Kasan geboren und als Achtzehnjähriger von seinem Besitzer an die Armee verkauft worden, wo er den gnadenlosen Drill, mit dem man ihn zum Soldaten machte, über sich ergehen lassen musste, bevor er dem jungen Leutnant von Fenzlau als Offiziersbursche zugeteilt worden war. Wassilij hatte seinen Herrn auf den Feldzügen gegen die Perser und Türken begleitet und diente ihm auch jetzt, im Krieg gegen die aufständischen Bergtataren im Grossen Kaukasus.
Im Winter ruhte der Krieg. Aber wenn der Frühling die Bergweiden des Kaukasus in blühende Blumenteppiche verwandelte, kämpfte Vitus wieder gegen die Ungläubigen. Unter grauenhaften Verlusten erstürmte die Armee Paskewitschs Berg um Berg und verwandelte die weit verstreuten Dörfer im Gebirge in rauchende Trümmer.
Es war ein schmutziger Krieg. Was das bedeutete, erfuhr von Fenzlau schon bei seinem ersten Einsatz im Herbst 1830. Drei Tagesritte von Derbent entfernt lag ein dagestanisches Dorf, in dessen Nähe fünf russische Soldaten aus einem Hinterhalt erschossen worden waren und das nun dem Erdboden gleichgemacht werden sollte.
Mit der Exekution des Befehls wurde Major Pjotr Ivanowitsch Baranow betraut. Er galt als Haudegen – kompromisslos, brutal und schlau. Der Vierzigjährige, der aus Moskau stammte, war eine eindrucksvolle Gestalt: Gross und massig, mit kurzem dunklem Haar und einem Vollbart, der weit vor der Zeit weiss geworden war und ihm bei den Soldaten den Spitznamen «Sankt Nikolaus» eintrug. Seine Nase, ein mächtiger Zinken, spielte farblich ins Violette und zeugte von übermässigem Alkoholgenuss. Von Fenzlau kommandierte eine der vier Kompanien seines Bataillons, das durch eine Eskadron Kosaken und einen Trupp Artilleristen mit zwei leichten Kanonen verstärkt worden war.
Während die Soldaten am frühen Abend des 18. Oktobers ihr Lager aufschlugen, befahl der Major seine Offiziere zum Rapport. Sie standen am Rand einer Hochebene, von der ein steiler Hang in ein Tal abfiel. Mückenschwärme tanzten im milden Licht der tiefstehenden Sonne, die bald hinter den frisch verschneiten Gipfeln des Gebirges versinken würde. Von den silbernen, seidenhaarigen Fäden der verwelkten Weideröschen gingen Millionen von Samen ab, die wie Schneeflocken durch die klare Herbstluft segelten. Das Laub von Birken, Eichen und Buchen flammte rot und gelb zwischen den dunklen Tannen. Im Schutz des Waldes sahen die Offiziere unter sich in der Biegung eines Flusses eine tatarische Siedlung. Etwas mehr als drei Dutzend Hütten gruppierten sich um eine kleine Moschee. Zwischen den Behausungen, Ställen und Speichern tummelten sich spielende Kinder. Ein paar Frauen arbeiteten in den winzigen Gemüsegärten hinter dem Dorf. Andere knieten am Flussufer und wuschen Kleider im kalten Wasser. Etwas ausserhalb des Auls drosch ein Halbwüchsiger auf einem abgeernteten Äckerchen Getreide, indem er fünf eng aneinander gebundene Ochsen im Kreis über einen dicken Teppich aus Garben trieb. Ausser einem Alten, der sich auf einer Bank vor seiner Hütte an den letzten Strahlen der Sonne wärmte, waren keine Männer zu sehen.
«Wir werden das Dorf morgen früh angreifen», sagte Pjotr Ivanowitsch und wandte sich an den Artilleriehauptmann. «Bei Sonnenaufgang zerstört Ihr als Erstes die Moschee. Die vierte Kompanie und die Kosaken decken uns den Rücken, die erste, zweite und dritte halten sich dort, dort und dort in Bereitschaft.» Er wies mit der Rechten auf die entsprechenden Standorte. «Eine Viertelstunde nach Beginn des Bombardements werdet ihr den Aul von drei Seiten stürmen. Wer bis dahin nicht geflohen ist, wird niedergemacht.»
«Auch Frauen und Kinder?», wagte Vitus zu fragen.
Baranow schaute ihn stirnrunzelnd an. Dann lachte er dröhnend und schlug ihm seine Pranke auf die Schulter. «Unser Freund ist sich von den Feldzügen gegen die Perser und Türken an eine Kriegsführung gewohnt, in der sich zwei Armeen gegenüberstehen», erklärte er seinen Offizieren, die in sein Gelächter einstimmten. «Wenn Sie zum ersten Mal in einen tatarischen Hinterhalt geraten, Herr von Fenzlau», belehrte er seinen neuen Hauptmann, «wenn Leute von Ihnen getötet werden und sich der Feind blitzschnell zurückzieht, ohne sich dem Kampf zu stellen, werden Sie verstehen, dass das, was wir morgen dort unten tun, die einzige Sprache ist, welche dieses Geschmeiss versteht. Und was die Weiber betrifft: Die bringen kleine Tataren zur Welt, die einmal grosse Draginer, Awaren, Lesghier, Tschetschenen, Tscherkessen oder was auch immer werden, dazu erzogen, Russen zu töten. Es ist besser, wenn wir das Ungeziefer vorher zur Hölle schicken. Sonst noch Fragen?»
Als am nächsten Morgen die ersten Sonnenstrahlen das Tal in helles Licht tauchte, suchte der Major den Blickkontakt mit dem Artilleriehauptmann, dessen Leute die beiden Kanonen geladen und in Stellung gebracht hatten. Er hob die Hand und liess sie fallen. Von Fenzlau hörte den Knall und sah, dass die schwere Eisenkugel in einem Haus unmittelbar neben der Moschee einschlug. Pjotr Ivanowitsch schrie dem Artillerieoffizier etwas zu. Der war aber schon dabei, die andere Kanone zu justieren. Kurz darauf erfolgte erneut der Befehl zum Feuern, und das zweite Geschoss riss ein grosses Loch in die Lehmmauer des Gotteshauses. Inzwischen hatte man das erste Geschütz wieder geladen, und nun legten die Kanoniere Schuss für Schuss jenes Gebäude in Trümmer, in dem die Bewohner des Auls, wie schon ihre Vorfahren, täglich gebetet, in dem sie den Koran gelesen und in dem der Mullah Buben und Mädchen den Glauben an Allah und den Propheten gelehrt hatte.
Durch seinen Feldstecher beobachtete von Fenzlau, wie Frauen, Kinder und Alte aus ihren Hütten kamen, wie sie fassungslos vor ihrer Moschee standen, wie Mütter ihre Säuglinge an ihre Brust drückten, während die Grösseren sich an sie drängten. Es waren keine Männer da, die ihre Familien hätten verteidigen können. Er sah, wie zwei Kinder stürzten und liegenblieben, wie der Kopf des Alten, der sich gestern an der Sonne gewärmt hatte, vom Rumpf getrennt wurde und wie eine Blutfontäne aus dem entseelten Körper schoss. Eine Frau, vielleicht seine Tochter, warf sich über ihn. Von Fenzlau begriff, dass der Greis und die beiden Kinder Opfer eines Schrapnells waren, eines Geschosses, das mit bösartigen Kugeln und Eisenstücken gefüllt war, die, wie er in der Kadettenanstalt gelernt hatte, vor dem Aufschlag mittels einer Treibladung ausgestossen werden. Er hörte Schreie, und dann vernahm er das Trompetensignal, das die drei Kompanien, die in Bereitschaft lagen, losmarschieren liess, dreihundertsechzig Mann mit gefällten Gewehren, auf denen die aufgepflanzten Bajonette blitzten.
Unten im Aul liefen die Dorfbewohner panisch durcheinander. Viele ergriffen die Flucht, suchten sich talaufwärts in Sicherheit zu bringen, andere rannten in ihre Hütten zurück. Wollten sie ihre Habe retten? Dazu haben sie doch keine Zeit, dachte von Fenzlau. Sehen sie denn nicht, dass wir in wenigen Minuten über sie herfallen werden?
Inzwischen schwiegen die Kanonen. Der Major hatte das Bombardement einstellen lassen, damit seine Soldaten nicht Gefahr liefen, von der eigenen Artillerie beschossen zu werden. Der Aul wurde umzingelt. Es war ein tödlicher Ring, aus dem es kein Entkommen gab. Auf die Befehle ihrer Vorgesetzten, zu denen auch Vitus gehörte, drangen die Männer ins Dorf. Sie traten die Türen der Hütten ein. Schüsse fielen, Frauen und Kinder liefen schreiend aus ihren Behausungen, streckten flehend ihre Arme aus und wurden gnadenlos erschossen oder erstochen. Alle, ohne Ausnahme. Nach weniger als einer halben Stunde war es vorbei. Über dem Aul breitete sich eine unheimliche Stille aus.
Hauptmann von Fenzlau betrachtete die Gesichter der Mörder. Russische Soldaten: Leibeigene, ehemalige Bauern, wie ihre Opfer. Man hatte sie aus ihrem Leben gerissen, sie gezwungen, ihre Dörfer und ihre Familien zu verlassen, um dem Zaren im fernen Kaukasus als Soldaten zu dienen. Einige von ihnen machten jetzt Jagd auf Hühner und Gänse, die sich aufgeregt schnatternd vor ihrem Zugriff zu retten versuchten. Andere plünderten die Vorräte der Bewohner des Auls. Sie würden der Truppe als Verpflegung dienen.
Indessen sassen die Offiziere im Schatten der Weiden am Flussufer und liessen sich von ihren Dienern ein üppiges Frühstück servieren, das in der Feldküche zubereitet und herbeigeschafft worden war. Dazu gab es Wodka. Mit zahlreichen Trinksprüchen feierte man den Erfolg der Strafexpedition. Einer sprach sogar von einem siegreichen Feldzug. «Sieg?», sagte von Fenzlau. Seine Stimme zitterte ein wenig. «Gab es denn Gegner, gegen die wir gekämpft haben? Ich jedenfalls habe keine tatarischen Krieger gesehen.»
Es wurde still. Alle Augen richteten sich auf ihn. Auch sein Diener Wassilij sah seinen Vorgesetzten überrascht an. «Diese Kakerlaken, junger Freund», sagte schliesslich Pjotr Ivanowitsch, «haben sich in die Berge zurückgezogen. Sie wussten, dass wir kommen und zählten darauf, dass wir ihre Weiber und ihre Brut am Leben lassen würden. Sie haben sich getäuscht.» Er hob sein randvoll mit Wodka gefülltes Glas: «Auf das Ungeziefer», sagte er und trank es in einem Zug leer.
Zwei Jahre und zahllose Überfälle und Vergeltungsschläge später liess sich Paskewitsch, Graf von Jerewan, als Besieger der Bergvölker Dagestans feiern und reiste nach Warschau, wo er im Auftrag von Zar Nikolaus den Oberbefehl im Kampf gegen die Polen übernahm, die, ähnlich wie die Tataren, auf ihrer Unabhängigkeit bestanden.
Allerdings hatte der Marschall nicht viel mehr erreicht, als die Küstengebiete am Kaspischen Meer und damit die wichtige Handelsstrasse von Persien nach Russland zu sichern. Der Krieg im Gebirge aber ging unvermindert weiter. Anstelle des im Kampf gefallenen Ghazi Muhammed wurde der sufistische Imam Schamil Anführer der Aufständischen, die erst 1859 endgültig unterworfen werden sollten.
Hauptmann von Fenzlau blieb im Nordkaukasus. Als Baranow 1834 Oberst und Festungskommandant von Derbent wurde, avancierte er, protegiert von seinem Onkel, zum Major und übernahm Pjotr Ivanowitschs Bataillon. Für Vitus von Fenzlau war das Töten und Tötenlassen endgültig zum Beruf geworden.
6
Wenn im Winter Schnee und Eis den Zugang über die Pässe zu den Siedlungen der Aufständischen verunmöglichten, las von Fenzlau viel, und wenn er genug von geistiger Nahrung hatte, vertrieb er sich die Zeit mit Kartenspiel und Huren. Manchmal nahm er Urlaub und reiste nach Tiflis. Er gab sich städtischen Vergnügungen hin und liess sich zu rauschenden Festen in den Gouverneurspalast einladen. Ab und zu traf er dort seinen Onkel. Zusammen besuchten sie die Schwefelbäder. Umhüllt von Dampfwolken liessen sie sich von kundigen Frauenhänden massieren, suchten vornehme Bordelle auf, speisten anschliessend und redeten über dieses und jenes. Jeweils zum Geburtstag schrieben sie sich, berichteten von ihren Erlebnissen in Alchaziche respektive Derbent. Zwei einsame Männer, getrennt durch eine Generation, verbunden durch den gemeinsamen Beruf.
Im Frühjahr 1839 erhielt der Major einen Brief von seiner Mutter. Sie teilte ihm mit, sein Vater, Wernher von Fenzlau, sei im Januar gestorben. Er habe in seinem Testament verfügt, dass sein jüngerer Sohn Georg das Handelshaus in Riga weiterführen solle, wobei ein Drittel der Erträge aus dem Geschäft Vitus zustünden. Ausserdem vermache er ihm das Gut in Segewold. Vom liquiden Vermögen stünde ein Fünftel ihr zu, seinen beiden Söhnen je vierzig Prozent. Die Mutter bat ihren Ältesten, seinem Bruder mitzuteilen, wohin man sein Erbteil überweisen solle und was mit dem Hof in Segewold zu geschehen habe. Ich gehe davon aus, schrieb sie, dass Du weisst, dass mit dem Tod Deines Vaters jetzt Du der Baron von Fenzlau bist. Erweise Dich dieser Ehre würdig.
Vitus las das Schreiben mehrmals. Er hatte, abgesehen von wenigen, nichtssagenden Briefen, die in grossen Abständen zwischen Riga und Grusinien hin und her gingen, keinerlei Kontakt mehr mit seiner Familie. Er hatte auch nie das Bedürfnis gehabt, sie zu besuchen. Hatte er dem Vater, der inzwischen bereits seit drei Monaten in seiner Grube lag, bis heute nicht verziehen, dass er ihn als Vierzehnjährigen dem Zaren «geschenkt» hatte?
Onkel Theodor war der Einzige, der ihm von der Verwandtschaft geblieben war. Vor einem Jahr hatte er ihn aufgefordert, Urlaub zu nehmen und ihn nach Sankt Petersburg zu begleiten. Seine beiden Töchter, Charlotte und Caroline, seien im heiratsfähigen Alter, hatte er augenzwinkernd hinzugefügt. Vitus erinnerte sich amüsiert an Lini und Lotti, die Zwillinge. Aber dann war der Oberst zum Generalmajor befördert und nach Tiflis versetzt worden, so dass man die Reise verschieben musste.
Allmählich wurde Vitus bewusst, dass er jetzt reich war, reich und unabhängig vom Geld, das ihm der Baron einmal im Jahr durch einen Kurier der Armee hatte überbringen lassen. Der Baron? Mit dem Tod des Alten war jetzt er der Baron.
Er trat vor den Spiegel und betrachtete sich. «Baron von Fenzlau», sagte er zu seinem Spiegelbild, das darauf zu bestehen schien, kein vornehmer, baltischer Adeliger zu sein, sondern ausschliesslich ein Krieger, der Tod und Verderben über seine Feinde brachte.
«Baron von Fenzlau», wiederholte er. Lauter diesmal.
«Haben Durchlaucht nach mir gerufen?» Sein Diener, der Anweisung hatte, in seiner Kammer neben dem Wohnzimmer auf Befehle zu warten, wenn sein Herr zuhause war, stand in der Türe.
«Ich bin jetzt Baron, Wassilj», sagte der Major.
«Wie Durchlaucht meinen», antwortete der Russe.
Eine Woche später liess Pjotr Ivanowitsch Baranow Vitus von Fenzlau zu sich bitten. Als er die Amtsstube des Festungskommandanten betrat, stand der Oberst, die Arme auf dem Rücken verschränkt, am offenen Fenster und beobachtete, wie im Hafen ein Frachtensegler entladen wurde. «Sie bringen Vorräte und Waffen für unsere Sommerfeldzüge, Herr Major», sagte er und drehte sich um. «Ich wollte heute mit Ihnen über unsere diesjährigen Operationen im Gebirge sprechen. Aber höheren Orts hat man offenbar andere Pläne.» Er ging zu seinem Tisch und reichte ihm ein Blatt Papier. Der russische Doppeladler mit Krone, Zepter, Reichsapfel und auf dem Brustschild Sankt Georg, der den Lindwurm durchbohrt, wiesen den Brief als offizielles Schreiben aus. Herr Baron von Fenzlau werde gebeten, sich so bald als möglich im Stabsquartier der Kaukasusarmee zu melden, man benötige seine Dienste, stand da. Unterschrieben war es von Theodor Dreyling, Generalmajor.
«Herr Baron?» Baranow, dessen Haut grobporig und von roten Äderchen durchzogen war, sah ihn aus seinen entzündeten Augen an. Fragend? Vorwurfsvoll? Seine Hände zitterten. Als er von Fenzlaus Blick bemerkte, legte er sie auf die Lehne seines Stuhls.
«Mein Vater ist gestorben. Ich habe den Titel geerbt», sagte Vitus.
«Darauf müssen wir anstossen!» Nicht: «Mein Beileid!», sondern: «Darauf müssen wir anstossen.» Baranow holte aus der Tiefe seines Aktenschranks eine Flasche Wodka und füllte zwei Gläser bis zum Rand. «Auf Ihre Karriere!», sagte er. Er leerte sein Glas in einem Zug und schenkte sich nach. Er schien nicht zu bemerken, dass der Major den Schnaps nicht anrührte. «Man holt Sie in den Generalstab. Einem wie Ihnen steht die Welt offen, während unsereiner in diesem Dreckloch vermodert.»
Von Fenzlau schwieg. Was sollte er diesem verbitterten Menschen antworten, der nichts anderes als den schmutzigen Krieg im Nordkaukasus kannte und darüber zum Säufer geworden war? Es war ein Wunder, dass er selbst nicht der Versuchung erlegen war, das Entsetzen, das ihn manchmal angesichts brennender Dörfer und gemetzelter Frauen und Kinder packte, in Strömen von Alkohol zu ertränken. Der Major trat ans Fenster. Der Himmel war bedeckt. Hinter den Wolken liess sich die Sonne nur erahnen. Im diffusen Licht sah die See aus wie flüssiges Blei. Ihm schien, als liege eine düstere Melancholie über diesem Land am Ufer des Kaspischen Meers. Er war erleichtert, Derbent, wo sich Menschen wie Baranow zugrunde richteten, nach neun Jahren hinter sich lassen zu dürfen.
«Auf Befehl von Generalmajor Dreyling soll Euch die Eskadron von Rittmeister Jegorow nach Tiflis begleiten», unterbrach der Oberst Vitus’ Gedankengänge. Er schlug mit der Faust auf den Tisch. «So verliere ich nicht nur einen Bataillonskommandanten, sondern auch eine Einheit meiner fähigsten Leute!»
Damit hatte er recht. Die Männer von Juri Fedorowitsch Jegorow, einem Offizierskameraden, dem gegenüber von Fenzlau freundschaftliche Gefühle hegte, waren Kuban-Kosaken, Nachkommen geflohener Leibeigener und Gesetzloser, die sich in den südrussischen Steppen am Fuss des Grossen Kaukasus zu Gemeinschaften von Wehrbauern zusammengeschlossen hatten. Sie mussten sich gegen die Überfälle von muslimischen Tataren und asiatischen Reiternomaden verteidigen und erwarben sich dabei einen Ruf als gefürchtete Kämpfer, um deren Reitkünste sich Legenden rankten. Anders als die ins Militär gepressten Leibeigenen waren sie seit Generationen freie Krieger, die für ihren Einsatz mit Steuererleichterungen und einer gewissen Autonomie entschädigt wurden. Sie galten als wild und brutal. Spätestens nachdem sie beim Rückzug Napoleons aus Russland anno 1812 unter den Soldaten der Grande Armée Angst und Schrecken verbreitet hatten, waren ihre Reiterverbände für die Zaren unverzichtbar. Unter ihrem Schutz würde von Fenzlau auf dem Ritt durch das Gebiet der feindlichen Bergtataren so sicher sein wie in Abrahams Schoss.
7
Am späten Nachmittag des 22. Mai, zehn Tage nachdem er in Derbent aufgebrochen war, traf Juri Jegorows Eskadron mit Vitus von Fenzlau in Tiflis ein. Der Major und der Rittmeister speisten in einem Restaurant unweit der Metechi-Kirche. Es gehörte zu einer Häuserzeile, die wie Schwalbennester auf dem Felsen hoch über der Kura klebte. Man hatte sie an einen Tisch am Fenster gesetzt. Während sie assen, schauten sie immer wieder hinunter auf den Meidan, den Platz der Tataren am anderen Ufer des Flusses, wo Händler an ihren Ständen Waren aus der ganzen Welt feilboten.