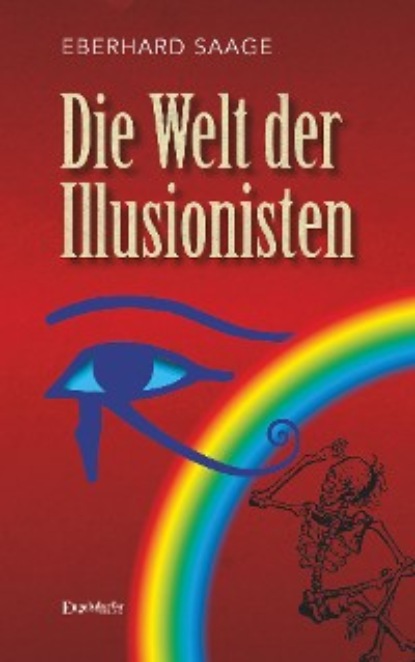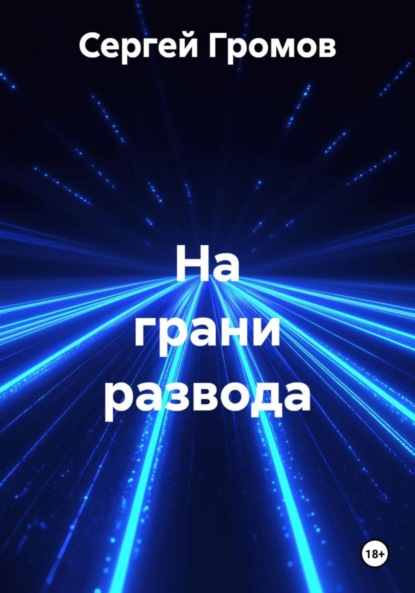- -
- 100%
- +
Sarah legte ihm vertraulich eine Hand auf die Schulter: »Nun weißt du es aber.«
»Und nun weiß ich auch von dir, dass er manches anders sieht als viele Politiker seiner Partei, wie zum Beispiel dieser unsägliche Haberecht.«
Er blickte Joseph direkt in die Augen, der tapfer standhielt. »Für eine lange Diskussion ist keine Zeit, auch nicht für detaillierte Erläuterungen, die können Sie von Sarah erhalten. Den Rat, den Sie benötigen, kann ich Ihnen geben.«
Wieder sah er Joseph direkt an und war wohl mit dessen Reaktion zufrieden. »Von Ihnen persönlich habe ich zu innerdeutschen Fragen noch keinen Kommentar gehört, die scheinen Sie nicht zu interessieren. Aber Ihre Parteifreunde setzen bewusst auf die Zweistaatentheorie. Die wollen denen, deren Grenzsoldaten Ihnen gerade so übel mitgespielt haben, zu internationaler Anerkennung verhelfen. Deshalb empfehle ich Ihnen, machen Sie es anders, setzen Sie das Thema Wiedervereinigung ganz oben auf Ihre Agenda.«
Josephs Gesicht verriet schon wieder seine Gefühle. Er wirkte enttäuscht.
Von Lenthe lächelte nachsichtig: »Junger Mann, Sie meinen, es hätte sich nicht gelohnt, dafür nach Berlin zu fahren und all diese Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen? Sprechen Sie mit Sarah und denken Sie darüber nach.«
Er erhob sich. »Es tut mir leid, Sarah, aber ich muss.«
Sarah begleitete ihn hinaus.
Als sie endlich zurückkam, hatte sich Joseph einen Kognak eingegossen. »Entschuldige, aber jetzt brauche ich einen.«
»Du bist enttäuscht?«
»Maßlos. Was soll dieser, dieser, entschuldige, dieser Unsinn?« Er trank einen großen Schluck. »Ich weiß ja, dass der Gott und alle Welt kennt. Der wird doch von Politikern und sogar anderen Topmanagern wie der Herrgott persönlich verehrt. Aber woher kennt der dich?«
»Wir sind uralte Freunde, schon seit dem Krieg. Er hatte damals deutsche Wirtschaftsinteressen im Ausland vertreten, aber seine Frau musste hier in Berlin bleiben, quasi als Geisel. Die Nazis haben ja niemand vertraut. Sie war sehr einsam und wurde meine beste Freundin. Ich habe mich um sie gekümmert, und er war mir deshalb sehr dankbar.«
»Seine Frau? Das ist doch die, na, ich komme nicht drauf.«
»Du meinst seine zweite Frau. Die erste hatte sich scheiden lassen. Nach dem Krieg ist er steil aufgestiegen und hat sie wieder vernachlässigt. Eines Tages reichte es ihr. Die Kontakte zu mir hat er danach einschlafen lassen. Aber vor einigen Jahren, du warst damals noch nicht hier, hat er seine eigene Schuld eingestanden, und seitdem treffen wir uns meist, wenn er in Berlin ist.«
»Aha.«
»Ja, ich verstehe, dich interessiert anderes. Also pass auf, der hat noch nie in seinem Leben Unsinn erzählt oder vorgeschlagen. Aus deiner Sicht ist seine Andeutung nur deshalb unverständlich, weil du den Hintergrund nicht kennst.«
»Dann erkläre ihn mir.«
»Ungern.«
»Na, Tante Sarah, du glaubst ja selbst nicht, dass ich mich so abspeisen lasse.«
»Eben.« Sie überlegte kurz. »Dir sagt der Name Bilderberger doch etwas?«
»Na hör mal, selbstverständlich.«
»Dann weißt du auch, dass deren Geheimtreffen jedes Jahr stattfinden. Und seit vielen Jahren gibt es nur einen Deutschen, der ständig dazu eingeladen wird, und das ist er.«
»In diesem Jahr auch?«
»Ja.«
»Und?«
»Erstmals seit Jahren«, Sarah stockte, »bitte, Joseph, sei nicht beleidigt. Du musst mich verstehen, das ist das allergrößte Staatsgeheimnis der Bundesrepublik seit dem Kriegsende. Noch in Jahrzehnten wird niemand offiziell darüber sprechen. Du musst mir hoch und heilig schwören, es niemanden weiterzusagen. Auch nicht Magda.«
»Gut, ich schwöre es, wenn es dir so wichtig ist.«
»Ist es, aber eben nicht mir. Also, erstmals seit Jahrzehnten stand das Thema Wiedervereinigung Deutschlands auf der Agenda.«
»Stand es? Das dachte ich mir ja nun schon. Und was wurde beschlossen?«
»Ach, Joseph, du verstehst die Tragweite dieser Information nicht. Du brauchst Zeit, um gründlich darüber nachzudenken. Aber, um deine Frage zu beantworten, die beschließen nichts offiziell, von diesen Treffen gibt es keine Protokolle. Aber trotzdem machen die danach Nägel mit Köpfen.«
Joseph wurde nun doch nachdenklich. Er erinnerte sich an sein Gespräch mit dem Rennsteigläufer. Der hatte ihm erzählt, dass auch in der DDR nicht mehr Friedhofsruhe herrschen würde. »Seitdem Honecker Perestroika und Glasnost ablehnt, gärt es sogar unter den Genossen. Die Zeitschrift Sputnik, die über viele Veränderungen in der Sowjetunion berichtet, wird von Hand zu Hand gereicht. Nicht die materiellen Versorgungsengpässe bestimmen die Diskussionen der Bevölkerung, wie man hier glaubt, sondern Gorbatschows neue Politik.«
Joseph erzählte das seiner Tante und sagte dann: »Ehrlich gesagt, ich habe mich für die DDR noch nie interessiert. Vielleicht bewegt sich in der tatsächlich etwas. Ohne Grund werden die Bilderberger nicht darüber diskutiert haben. Aber was könnten die denn konkret machen?«
»Einen kleinen Anstoß geben. Wenn die Situation für Veränderungen reif ist, genügt der oft. Das sagt mir meine Lebenserfahrung.«
»Und das sagt zu diesem konkreten Fall auch dein Herr von Lenthe?«
»Ach, Joseph, wir müssen nicht über alles reden. Wichtig ist doch jetzt, welche Schlussfolgerungen du ganz persönlich für deine Politik ziehst.«
Bis zur nächsten Bundestagswahl waren es noch fast zwei Jahre, aber Haberechts Gruppe wurde bereits unruhig. Die Umfrageergebnisse für »Die Anderen« sanken nach einem Zwischenhoch schnell unter die letzten Wahlergebnisse. Die Bevölkerung hatte die Angst nach dem Supergau schon vergessen und wehrte sich nur noch an lokalen Brennpunkten gegen die Atomkraftwerke. Haberechts Reden rüttelten niemand mehr auf und wirkten oberlehrerhaft wie bei der Parteigründung.
»Wir brauchen schon heute ein umfassendes Wahlprogramm«, entschied er, »wir müssen unsere Aussagen schärfen, insbesondere zu unseren traditionellen Themen Atomenergie, Frieden und Gleichberechtigung, um den Wählern wieder bewusst zu machen, dass wir die einzige Alternative zu den Altparteien sind.«
Als der Entwurf vorgelegt wurde, enthielt der natürlich auch einen Absatz zu den zwischenstaatlichen deutschen Beziehungen. Die Selbstständigkeit der DDR sollte international gestärkt werden.
Eine Diskussion über diese nebensächliche Aussage war nicht vorgesehen. Viele Vorstandsmitglieder wirkten deshalb irritiert, als Joseph Adam sie dazu aufforderte.
Aber er widersprach ihnen entschieden: »Um das Thema Wiedervereinigung dürfen wir uns nicht drücken. Der Wähler will auch dazu unsere Position erfahren.«
»Wiedervereinigung?«, fragte Haberecht erstaunt. »Dieses Wort nehmen doch sogar die Politiker der Altparteien kaum noch in ihren Sonntagsreden in den Mund, höchstens mal am 17. Juni. Ich frage mich, was du damit bezwecken willst.«
Nun begann eine heftige, nicht nur gegen Joseph Adams Vorschlag, sondern auch gegen ihn persönlich gerichtete Diskussion. Haberecht hielt es jedoch für überflüssig, die Rivalität gegen den wieder hochkochen zu lassen und fragte einlenkend: »Wie würdest du das denn formulieren?«
»Wir sollten zwar zum Ausdruck bringen, dass wir weiter für die Zweistaatlichkeit sind, sollte sich aber eine veränderte Situation ergeben und würden beide Seiten für eine Wiedervereinigung sein, würden wir uns nicht davor verschließen. Oder so ähnlich.«
»Veränderte Situation?«, lachte Einer auf, »die wird es nicht einmal im Traum geben.«
»Schon gut«, schnitt Haberecht eine neue Diskussion sofort ab, »wenn es dir, Joseph, so wichtig ist und du nicht mehr willst, könnten wir das mittragen.«
Er blickte zu seinen Anhängern. »Da würde uns kein Zacken aus der Krone fallen.«
Also stand im Wahlprogramm plötzlich eine Aussage zur Wiedervereinigung.
Erst als die Medien öfter darüber berichteten, interessierte sich Joseph Adam für die Friedensinitiative der Christen in der DDR, die sich auch von gewaltsamen Übergriffen der Stasi nicht stoppen ließen. Im Mai 1989 fanden Regimekritiker dann noch ein anderes Thema. Offensichtlich hatte die DDR-Führung die Wahlergebnisse gefälscht, um nicht viele Gegenstimmen ausweisen zu müssen. Jetzt versammelten sich am siebten Tag jeden Monats junge Ostberliner auf dem Alexanderplatz und protestierten dagegen.
Beim nächsten Treffen sprach Joseph mit seiner Tante Sarah auch darüber und fragte: »Ich weiß schon, keine Namen, keine Namen, aber hast du mit ihm noch einmal gesprochen? Hat er sich dazu geäußert?«
»Nein, selbstverständlich nicht. Seit damals war das nie ein Thema zwischen uns.«
»Ehrlich?«
»Natürlich ehrlich, was denkst du denn von mir?« Ihre Stimme wirkte kurz verärgert, sie fragte aber sofort zurück: »Was hälst du denn davon?«
»Ich denke an deine Worte, du weißt schon, ein kleiner Anstoß. Und ich habe mich über die deutschen Kirchen mal schlau gemacht. Der allgemeine Eindruck ist ja, dass auch die sich auseinander gelebt hätten, aber die arbeiten ja noch immer eng zusammen. Unsere finanzieren nicht nur deren Kirchenrestaurierungen, sondern, was meines Erachtens besonders schwer wiegt, zum Beispiel auch die Altersversorgung von Pfarrern und vieles andere.«
»Und was denkst du darüber?«
»Für konkrete Schlussfolgerungen sind meine Kenntnisse noch nicht ausreichend. Ich sage nur: Nachtigall, ick hör dir trapsen.«
Die Leipziger Demonstranten riefen im Oktober 1989: »Wir sind ein Volk.«
Und Joseph Adam verkündete im Parteivorstand: »Die wählen nächstes Jahr mit.«
Haberecht begriff nicht, was er damit meinte: »Was werden die mitwählen?«
»Die jetzigen DDR-Bürger werden im nächsten Jahr den Bundestag mitwählen.«
Haberechts Leuten blieben die Münder offen stehen, und für Adams Spion unter denen war das das Signal, nun seinen vereinbarten Part zu spielen:
»Unfassbar, was du hier absonderst, jetzt drehst du wohl völlig durch?«
Er wandte sich an Haberecht: »Jetzt müssen wir dieses Thema aber endgültig klären. Es war ein schwerer Fehler, diese Wischiwaschi-Formulierung zur deutschen Frage in unser Parteiprogramm aufzunehmen. Die trägt dazu bei, dass unsere Umfragewerte stagnieren. Wir müssen dem Wähler eindeutig sagen, was wir wollen, und das ist die Zweistaatlichkeit, gleichberechtigte Beziehungen zwischen beiden Staaten und eine normale zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Sollen die Altparteien über Deutschlands Zukunft schwadronieren, wir müssen über unsere Themen reden.«
Erregt wirkend sprang Joseph auf: »Vor allem brauchen die Wähler Visionen. Und wer soll die ihnen übermitteln, vielleicht die Altparteien? Die müssen wir ihnen übermitteln, klar und eindeutig, ohne Wischiwaschi, da gebe ich dir recht. Von der Regierung gewinnt man ja den Eindruck, dass die noch nicht begriffen hätte, welche einmalige Chance uns die DDR-Bürger bieten.«
»So!« Haberecht grinste zynisch. »Keiner begreift etwas, nur du. Du alleine hast den großen Durchblick, du bist, um dein Wort zu benutzen, der Visionär. Bravo!« Er klatschte höhnisch Beifall, und seine Anhänger fielen mit ein.
Joseph senkte tief den Kopf, um seinen Triumph zu verbergen, denn er verstand sofort, dass auch Haberecht dieses Mal nicht um des lieben Friedens Willen nachgeben wollte. Der suchte nun eine endgültige Entscheidung darüber, wer die Partei führen sollte. Nun gut, diesen Sieg gönnte er ihm, denn es würde ein Pyrrhussieg sein. Heute hatte Joseph nur das Ziel, dass er später tatsächlich als der große Visionär gelten würde. Das hatte er seinem Spion vorher gesagt, der sofort nachhakte.
»Ich höre immerzu Visionen, aber wer hat die denn wirklich? Das Haus eines wiedervereinigten Deutschlands, das Joseph unseren Wählern aufbauen will, würde sich schnell als Kartenhaus erweisen. Würden wir es als Partei mitbauen, würde dessen Zusammenbruch unseren nach sich ziehen. Deshalb muss ich dringend davor warnen, Josephs Weg mitzugehen. Auf die Wiedervereinigung dürfen wir nicht setzen. Das würde uns von unseren wirklichen Visionen ablenken, und die sind die Stillegung der Atomkraftwerke, Gleichberechtigung und, und, und. Mit einem Wort: Weitere Demokratisierung. Das sind, ich wiederhole es, die Visionen, mit denen wir beim Wähler punkten können.«
Joseph gab nicht klein bei und stritt weiter energisch für seinen Vorschlag. Er wollte eine Entscheidung, und er bekam sie. Der gesamte Parteivorstand stellte sich gegen ihn. Die vage Andeutung über die Wiedervereinigung wurde aus dem Parteiprogramm gestrichen und durch die Betonung der Zweistaatlichkeit ersetzt. Über eine Neuwahl des Parteivorstandes musste danach nicht diskutiert werden, denn Joseph trat von diesem Amt zurück.
Sie frühstückten auf dem Balkon des Aparthotels. An der gedrechselten Brüstung, die der Hausherr angefertigt hatte, hingen Kästen mit Geranien, deren dunkelrote Blüten mit denen auf den benachbarten Balkons wetteiferten. Unter ihnen lag eine breite Wiese, auf der vormittags sieben Kühe weideten.
»Sieben«, sagte Joseph, »eine Glückszahl.«
»Seit wann bist du abergläubig?«
»Seitdem ich Glück brauche.«
»Du glaubst doch, dass du gerade dein eigenes Glück schmiedest.«
»Ich habe aber sehr hoch gepokert.«
»Eben, das meine ich ja.«
»Ich werde aber siegen!«
»Na, abwarten.«
Frühmorgens versetzte der Bauer den Weidezaun um einige Meter und gab den Kühen saftige Kräuter und frische Gräser frei. Danach mähte er ein anderes Stück und fuhr das Futter für nachmittags in den nahen Stall.
Die Penkenbahn wurde in Betrieb gesetzt, und von oben näherten sich die ersten Gondeln der Talstation. Joseph Adam nahm sich schon die dritte Tasse Kaffee, er saß bequem und völlig entspannt und beobachtete den Bauern beim Mähen. Erst als Magda zum dritten Mal auf ihre Uhr blickte, reagierte er: »Wir haben doch Zeit, nichts drängelt uns.«
»Heute schon, wir müssen nach Hintertux fahren.«
»Müssen?«
»Müssen!«
»Ich dachte, wir wollten einfach mal zwei Wochen Urlaub machen, ganz gemütlich mit ein paar Wanderungen durch die Täler, bevor der Sommer endet.«
»Machen wir ja auch.«
»Aber ich sehe es dir an der Nasenspitze an, dass wir nicht nur deshalb hier sind.«
»Kann sein.«
»Also heute?«
»Ja, heute!« Sie blickte wieder auf die Uhr.
»Okay, okay, ich bin ja schon fertig.« Gespielt hastig schüttete Joseph den letzten Schluck Kaffee in sich rein. »Da bin ich aber mal gespannt!«
Sie verriet ihm nichts und genoss die Autofahrt bis Hintertux durch die schöne Bergwelt und die herausgeputzten Dörfer.
»Eins habe ich unserem Hausherrn schon gesagt, aber das hört der gar nicht so gerne, ich habe noch nie eine so stinkreiche Gegend gesehen wie hier im Zillertal.«
»Ich auch nicht, obwohl andere ja auf die Schweiz verweisen. Die Leute hier haben ein unglaubliches Schwein. Als vor etwa 140 Jahren der Tourismus begann, brauchte ein Ahne nur ein Haus mit Grundstück zu besitzen, und schon hatten alle nachfolgenden Generationen ausgesorgt.«
»Das solltest du dem Hauswirt aber nicht sagen.«
»I bewahre.«
In der Talstation der Hintertuxer Bergbahnen wollte Joseph gleich Tickets bis ganz nach oben kaufen. »Wenn wir schon mal hier sind, will ich auch den Gletscher erleben. Vielleicht haben wir ja auch eine gute Sicht bis zur Zugspitze.«
»Nein! Wir müssen nur bis zur Sommerbergalm.«
Magda verschwieg immer noch ihr Ziel und übersah die tiefe Falte, die sich zwischen seinen Augenbrauen bildete.
Mit ihnen betrat ein junges Paar die Kabine. Er war klein und schmächtig, hatte aber ein brutal wirkendes, feistes Gesicht mit unangenehmen Augen. Sie war einen Kopf größer als er, schlank, rassig, bildschön. Er redete in einer hart klingenden, slawischen Sprache auf sie ein, und sie senkte ihre Augen.
Oben blickte Magda auf ihre Uhr: »Wir haben noch etwas Zeit.«
Sie gingen zu dem Aussichtspunkt hinter der Station. Tief unter ihnen schlängelte sich die Straße durch das weite Tal mit den langgestreckten Dörfern. Am Südhang grasten viele Kühe auf den Almen, der Nordhang war unten bewaldet, darüber zeugten Lawinenschutzzäune von den Gefahren, denen die Bewohner im Winter ausgesetzt waren.
»Wunderschön!« Magda konnte nicht genug fotografieren. Dann wandte sie sich zurück zu dem steil aufragenden Olperer. Auf seinem tief herabhängenden Gletscher bewegten sich kleine dunkle Punkte nach unten. Einer verharrte kurz, war vielleicht gestürzt, während ein anderer noch wenige Meter weiterfuhr und dann wartete.
»Wenn das der Reiche war, wird er seiner Frau die Schuld geben«, meinte Joseph.
»Das müsste sie ertragen.«
Magda behielt nun den Ausgang der Bergbahn im Blick. Und dann kamen dort vier Personen heraus, ein älterer, graumelierte Herr, ein jüngeres Paar und ein kleines Mädchen.
Joseph hatte sie noch nicht entdeckt, aber Magda sagte: »Jetzt müssen wir gehen.«
Nur 50 Meter hinter der Gruppe erreichten sie den Wanderweg zum Tuxer Jochhaus. In diesem Moment blickte sich der ältere Herr um, und Joseph blieb abrupt stehen:
»Da, da, das ist …«
»Ja, das ist er.«
»Dann, dann ist das Mädchen …«
»Ja, das ist unsere Tochter.«
Er schwieg verwirrt und meinte dann: »Das wird dem Weinbauern aber nicht gefallen.«
»Dem nicht, aber der musste sich beugen. Seine Frau und seine Schwiegereltern sind schließlich Georgier. Für die ist die Familie das allerwichtigste. Die haben verstanden, dass ich meine Tochter noch einmal sehen will, wenn wir das auch anders vereinbart hatten.«
»Und deshalb habt ihr euch hier verabredet?«
»Ja, weitab vom Schuss. Wir treffen uns zufällig, gehen ein Stück miteinander, essen oben und gehen wieder auseinander. Keiner bemerkt etwas, auch Lena nicht.«
Am Wegrand standen zwei Kühe. Eine säuberte der anderen mit ihrer langen Zunge gründlich den Hals. Die andere blieb ganz ruhig stehen, ohne sich von den neugierigen Menschen stören zu lassen. Die Eltern stellten sich mit Lena davor, und der Opa wollte sie fotografieren.
»Möchten Sie mit auf das Foto?«, fragte Magda.
»Ja, danke, das ist nett.«
Jetzt bemerkte eine Kuh den Blumenstrauß, den Lena sich gepflückt hatte und fraß ihn auf, bevor Lena ihre Hand wegziehen konnte.
»Meine Blümchen, schade.«
»Guck mal dort«, Magda entdeckte in einer Felsspalte gelb leuchtende Arnikablüten und nahm ihre Tochter an die Hand, »komm, die holen wir dir.«
Ohne Scheu folgte Lena der fremden Frau.
»Sind die nicht schön?«
»Findest du noch mehr?«
»Ja, guck dort.«
Die Beiden pflückten zusammen viele Blumen, während die anderen weitergingen. Der Aufstieg zur Hütte wurde steiler als sie von unten vermutet hatten. Der Fürst fiel etwas zurück, und Joseph blieb bei ihm. Als die anderen sie nicht mehr hören konnten, blieb der Fürst stehen und sagte: »Sie haben sich sehr verändert.«
»So? Mit anderen Worten, Sie interessieren sich für meine Karriere?«
»Gelegentlich.«
»Natürlich habe ich mich seit Lenas Taufe verändert. Aber Sie haben mich damals auch in einer schlechten Situation kennengelernt. Ihr Schwiegersohn hatte mir absichtlich zu viel von diesem schweren Wein eingeschenkt.«
»Ich denke nicht nur daran.«
»Ja, klar, auch an Lena. Aber eins müssen Sie wissen, ich hatte bei der Entscheidung, sie zur Adoption frei zu geben, kein Mitspracherecht. Das haben mir Tante Sarah, von der Sie ja wissen, wie resolut sie sein kann, und Magda im gleichen Moment mitgeteilt, in dem ich von der Schwangerschaft erfuhr.«
Der Fürst nickte und hielt dieses Thema für abgeschlossen. »Noch einmal zu Ihrer Karriere. Ihre Partei fällt im Moment ja ins Bodenlose. Auch für die trifft Gorbatschows Spruch zu ›Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.‹ Sie waren der Einzige, der eine Vision hatte, aber Sie wurden dafür abgestraft.«
»Sie sind wirklich gut informiert. Aber«, Joseph lachte auf, »das macht nichts, ich werde wieder auf die Füße fallen.«
»Dann sind Sie im Wahlkampf wohl so wenig aktiv, weil Sie sich auf die Zeit danach vorbereiten?«
Joseph blickte ihn überrascht an. Nicht einmal im Traum hätte er es für möglich gehalten, dass sich der Fürst so für ihn interessieren könnte. Warum machte der das? Und was hatte der vor? Offensichtlich wollte der dieses Treffen für etwas Konkretes nutzen.
Zurückhaltend antwortete er: »Diese Schlussfolgerung haben noch nicht einmal meine Gegner gezogen, zumindest nicht mir gegenüber.«
Der Fürst ging schneller, um nicht zu weit zurückzufallen.
»Sie finden Ihren Weg«, sagte er dann, »Sie werden schneller aufsteigen als ich auf diesen Berg. Es wird Sie nun nicht mehr überraschen, dass ich Ihre Frau gebeten habe, Sie zu diesem Treffen mitzubringen. Als Politiker wissen Sie ja, dass es nicht nur in Osteuropa große Veränderungen geben wird, sondern auch in Asien. Haben Sie den Namen Berkel Zorbas schon einmal gehört?«
»Habe ich, manche nennen ihn den aufsteigenden Stern Asiens.«
»Ich würde eher sagen die aufsteigende Sonne. Ich kenne ihn gut. Er wird Abestan zu einer Großmacht entwickeln. Keine Frage. Aber«, er suchte direkten Blickkontakt mit Joseph Adam, »heute braucht er Hilfe aus Westeuropa, auch und gerade aus Deutschland. Weil er weiß, dass ich viele Kontakte habe, hat er mich gebeten, ihm dafür geeignete deutsche Politiker zu empfehlen. Aber mit den etablierten, die sich erdreisten, arrogant auf ihn herabzublicken, kann er nichts anfangen, er sucht neue, aufsteigende. Wenn sich Ihre Karriere so entwickeln würde, wie ich vermute, könnten auch Sie ihm bald helfen.«
»Das muss man abwarten«, wich Joseph aus.
»Selbstverständlich. Aber wenn es dann so weit ist, werden Sie ihn kennenlernen können.«
»Interessanter Vorschlag«, sagte Joseph, und er konnte in diesem Moment ja nicht ahnen, was dieses Gespräch für seine Zukunft bedeuten würde.
Ihren Gedanken nachhängend holten sie die anderen wieder ein, die an einer Weggabelung auf sie warteten.
»Hat sie dich erkannt?«, fragte Joseph leise.
»Nein.«
»Aber du hast sie doch so lange gestillt.«
»Das ist Jahre her. Ein Kind vergisst das.«
Als sie weitergingen, gab Lena Magda eine Hand und reichte die andere Joseph hin: »Holla hupp?«
»Du wirst lästig«, meinte der Weinbauer, aber Joseph ergriff die Hand seiner Tochter.
Sie nahmen Anlauf. »Eins, zwei, drei«, und sie schleuderten Lena weit hoch, »holla hupp.«
Das Kind quietschte vergnügt. »Noch mal.«
»Eins, zwei, drei, holla hupp.«
»Noch mal.«
»Eins, zwei, drei, holla hupp.«
Lenas Lachen schallte durch das weite Tal. Aber Magda drehte plötzlich ihr Gesicht weg.
Die DDR-Bürger werden mitwählen, hatte Joseph schon vor einem Jahr prophezeit. Sie taten es, und Haberecht erhielt für seine Strategie eine schallende Ohrfeige. Schon bei der ersten Wahlprognose lag die 5%-Hürde unerreichbar fern. Aber unbeirrt trat er nach der ersten Hochrechnung vor seine Parteifreunde und verteidigte diese Strategie, sprach von einer Wahlschlappe, die dem Zeitgeist geschuldet und zu überwinden wäre. Doch es klatschten nur wenige. Die Mehrheit der Zuhörer gehörte zu Adams Anhängern, und die buhten Haberecht so aus, dass es dem die Sprache verschlug und er ratlos und schweigend am Mikrofon stehen blieb.
Und plötzlich war aus dem Hintergrund ein leiser Ruf zu hören: »Joseph, Joseph, Joseph!«
Alle blickten sich um.
»Joseph, Joseph, Joseph!«, riefen nun schon mehrere und schließlich fast alle.
Und der ließ seine Freunde noch ein bisschen zappeln, betrat dann von hinten die Bühne und ging schnurstracks zum Mikrofon. Die Masse jubelte auf. Haberecht blickte ihn nur kurz an, senkte sein Haupt und schlich sich davon. Seine Anhänger folgten ihm in der gleichen Körperhaltung.
Joseph stand nun alleine auf der Bühne und genoss den Beifall. Erst als der ein bisschen nachließ, senkte er seine Hände beschwichtigend und stellte sich das Mikrofon ein. Dann blickte er in den Saal, der etwas leerer geworden war und lächelte breit. Ohne eine Erklärung zu benötigten, lachten die Zuhörer auf und klatschten wieder.