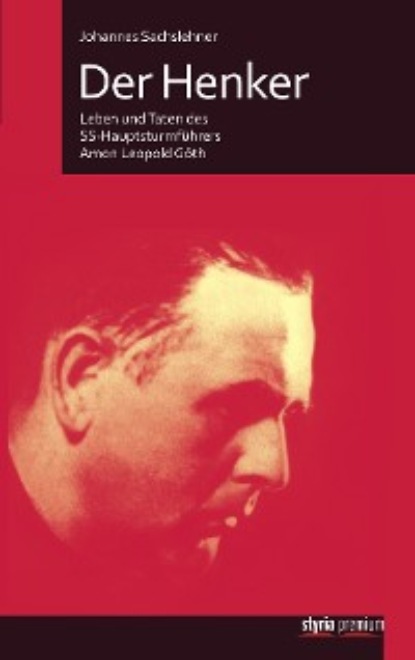- -
- 100%
- +
Ich muss auch als alter Nationalsozialist sagen: Wenn die Judensippschaft den Krieg in Europa überleben würde, wir aber unser bestes Blut für die Erhaltung Europas geopfert hätten, dann würde dieser Krieg doch nur einen Teilerfolg darstellen. Ich werde daher den Juden gegenüber grundsätzlich nur von der Erwartung ausgehen, dass sie verschwinden. Sie müssen weg.

Ein Motiv für den Propagandafeldzug: „König Hans“ Frank begegnet Mädchen in ukrainischer Tracht.

Übersiedlung ins Ghetto: Möbel und Hausrat werden auf Leiterwagen verladen.
Meine Herren, ich muss Sie bitten, sich gegen alle Mitleidserwägungen zu wappnen: Wir müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie treffen und wo es irgend möglich ist, um das Gesamtgefüge des Reiches hier aufrecht zu erhalten.
Die Juden sind auch für uns außergewöhnlich schädliche Fresser. Die 3,5 Millionen Juden können wir nicht erschießen, wir können sie nicht vergiften, werden aber doch Eingriffe vornehmen können, die irgendwie zu einem Vernichtungserfolg führen, und zwar im Zusammenhang mit den vom Reich her zu besprechenden großen Maßnahmen. Das Generalgouvernement muss genau so judenfrei werden, wie es das Reich ist.“
Die Planungen zum Mord an den Juden sind offenbar weiter fortgeschritten. Bereits einen Monat vor der Wannsee-Konferenz stimmt Hans Frank seine Mitarbeiter auf das Blutbad ein – in den Köpfen ist man bereit für die große „Aktion“. Das Generalgouvernement will sich als Musterschüler zeigen, der die Aufgabe bereits angeht, bevor sie noch offiziell ausgesprochen ist – diesen Rahmen für die „Endlösung“ steckt dann die berüchtigte Wannsee-Konferenz vom 20. Jänner 1942 ab – der Massenmord an den europäischen Juden ist beschlossene Sache …
Die Deportationen
Am 28. Mai 1942 umstellen Einheiten der SS, der Waffen-SS und der Sicherheitspolizei das Krakauer Ghetto. Die Schergen der „Endlösung“ beginnen ihre mörderische „Selektionen“: Bis 8. Juni werden drei Todeszüge mit 7.000 Juden „abgefertigt“; Ziel der „Transporte“: das Vernichtungslager Bełżec im Distrikt Lublin.
Vorbereitet wird die „Aktion“ durch eine weitere Schikane der Nazi-Bürokratie: den „Blauen Schein“. Die Kennkarte bietet ab nun den Bewohnern des Ghettos nicht mehr ausreichend Schutz vor Deportation, auch nicht dann, wenn sie mit dem Stempel einer offiziellen Arbeitserlaubnis versehen ist. Der Blaue Schein, den ebenfalls nur arbeitende Juden erhalten, teilt die Ghettobewohner auf bürokratischem Weg, er „selektiert“ für die „Endlösung“ vor: in jene, die arbeiten und vorläufig leben dürfen, und in jene, die bereits jetzt zum Tode verurteilt sind – vorgesehen für den Abtransport in eine der Todesfabriken im Osten.
Zahlreiche Juden werden von der SS noch im Ghetto erschossen; in wenigen Tagen fordert die Menschenjagd an die 600 Opfer. Höhepunkt des Massakers ist der 4. Juni 1942, der „Blutige Donnerstag“: Unter den Ermordeten dieses Tages sind auch der Dichter Mordechai Gebirtig, der Maler Abraham Neumann und Arthur Rosenzweig, der Vorsitzende des Judenrates. Etwa 12.000 Menschen bleiben noch im Ghetto zurück. Das Schicksal der noch lebenden Juden entscheidet sich Anfang Juni 1942: Hans Frank hat den Machtkampf mit Himmler um die Befugnisse in der Siedlungs- und Judenpolitik endgültig verloren; für die „Judenangelegenheiten“ ist nun der Höhere SS- und Polizeiführer Friedrich-Wilhelm Krüger zuständig. Krüger, daran lässt der von kaltem Ehrgeiz zerfressene Mann aus Straßburg keinen Zweifel, ist für den Massenmord: Mitte Juni verhandelt er bereits mit den führenden Verwaltungsbeamten der einzelnen Distrikte über die Ausdehnung der Massentötung auf das gesamte Generalgouvernement. Die zivilen Verwaltungsstellen stellen sich der „Herausforderung“ bereitwillig, sie sehen darin „eine harte Notwendigkeit“, die man im Interesse des „Endsiegs“ zu akzeptieren hat. Und so werden auch die Bewohner des Krakauer Ghettos unerbittlich weiter gequält: Am 20. Juni 1942 verkleinert man das Ghetto um den Streifen zwischen der Tarnowskastraße (heute Limanowskiegostraße) und Krzemionki; die nächste Verkleinerung erfolgt am 1. November 1942 mit der Abtrennung der so genannten „Ukraine“: Der Bereich Janowa-Wola-Straße, die Dąbrówkistraße und die linke Seite der Lembergstraße werden vom Ghetto abgelöst.

Deportation in den Tod: „selektionierte“ Opfer auf dem Marsch zu den Zügen am Krakauer Hauptbahnhof
Nach einer kurzzeitigen Unterbrechung fahren ab Mitte Juli 1942 wieder zwei Deportationszüge pro Woche aus dem Distrikt Krakau zum Vernichtungslager Bełżec. Die Aktion Reinhardt steuert ihrem Höhepunkt zu: Am 18. und 19. Juli 1942 ist Heinrich Himmler in Lublin; neben Bełżec sind jetzt auch die Vernichtungslager in Sobibór und Treblinka „einsatzbereit“, die „Reduzierung der überflüssigen Juden“ wird in fieberhaftem Tempo fortgesetzt. Bald erreicht der Massenmord unvorstellbare Dimensionen: Ab dem 22. Juli 1942 sterben in den Vernichtungslagern durch fast zehn Wochen hindurch jeden Tag bis zu 25.000 polnische Juden. Ende 1942 werden von den einst zwei Millionen Juden im Generalgouvernement nur mehr 300.000 leben.
Hans Frank, Chef des Gangster Gaus, der am 1. August auf einer Großkundgebung in der ostgalizischen Metropole Lemberg spricht, ist daher bestens aufgelegt. So kann er es sich nicht verkneifen, die laufenden Mordaktionen zumindest anzudeuten: „[M]it diesen Juden werden wir auch noch fertig. (…) Es soll doch in dieser Stadt einmal Tausende und Abertausende von diesen Plattfußindianern gegeben haben – es war keiner mehr zu sehen. Ihr werdet doch am Ende mit denen nicht böse umgegangen sein? (Das Protokoll verzeichnet „Große Heiterkeit“.)
(…) Wir haben das Glück, daß wir hier mit den Juden so umgehen können, wie sie mit dem deutschen Volk umgegangen sind. (…) Der Jude ist in diesem Land kein Problem mehr, sondern höchstens geeignet, uns artgemäß zu interessieren.“
Nach den ersten Wochen des Mordens zieht auch der Reichsführer-SS ein zufriedenes Zwischenresümee. In einem Brief an Odilo Globocnik vom 13. August 1943 schreibt Himmler: „Arbeiten Sie weiter so tatkräftig wie bisher und ich glaube sicher, daß Sie in dieser schönen Arbeit Befriedigung finden.“ Während Göth bei der „Aktion Reinhardt“ seine Erfahrungen mit dem Judenmord sammelt, holt das SS-Personalhauptamt offiziell nach, was de facto schon Realität ist: Am 13. August 1942 wird er für die Dauer seines Einsatzes beim Höheren SS- und Polizeiführer Ost zum „Fachführer der Waffen-SS“ ernannt; als Dienstgrad bleibt der SS-Untersturmführer, allerdings darf Göth jetzt ein „(S)“ dahinter setzen.
Im Herbst 1942 trifft Göth, angeblich auf Befehl von Globocniks Stabsführer Ernst Lerch, dem Sohn eines Klagenfurter Cafetiers, an seinem nächsten Einsatzort ein: Poniatowa südwestlich von Lublin. Im September 1941 hatte man hier ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene errichtet, das Stalag (Stammlager) 359, bewacht vom Landesschützenbataillon 709. 24. 000 Soldaten der Roten Armee brachte man bis Dezember 1941 hierher – bis zum Frühjahr 1942 waren 22.000 Gefangene tot, zugrunde gegangen an den entsetzlichen sanitären Bedingungen – es gab kein Wasser zum Waschen und keine Möglichkeiten zum Kleiderwechsel –, an Hunger und Krankheiten, vor allem Typhus. Zu Beginn des Jahres 1942 starben hier täglich (!) an die 1.000 Menschen. Die Toten hatte man in 32 Massengräbern außerhalb des Lagers verscharrt. 500 gefangene Sowjetsoldaten, hauptsächlich „Volksdeutsche“, rekrutierte man für den Wachdienst in den Lagern und brachte sie zur „Ausbildung“ ins berüchtigte „Trainingscamp“ der SS in Trawniki.
Göths Aufgabe ist auch hier der Aufbau eines Lagers für jüdische Sklavenarbeiter, und er zeigt sich wiederum als erfolgreicher „Campmanager“. Bereits im Oktober 1942 werden die ersten Juden aus dem „Transit-Ghetto“ von Opole Lubelskie nach Poniatowa gebracht, bis Jänner 1943 sind an die 1.500 Zwangsarbeiter im Lager, unter ihnen auch Juden aus Wien und der Slowakei. Göths Plan sieht eine Kapazität von 9.000 jüdischen Arbeitern vor; im Sommer 1943 werden es allerdings bereits an die 10.000 sein. Sie arbeiten in den Textilfabriken von Walter Toebbens, in denen vor allem Wehrmachtsuniformen hergestellt werden. Im Jänner 1943 werden die Betriebe von Walter Toebbens in Odilo Globocniks SS-Industriekomplex „Osti“ eingebracht; im August 1943 ist „Konzernchef“ Globocnik zu Besuch im Lager und überzeugt sich von der Produktivität seiner Sklaven. Die „Liquidierung“ des Lagers in Poniatowa sollte dann am 4. November 1943 im Rahmen des Blutbads „Aktion Erntefest“ erfolgen: Mehrere Tage vor der Massenexekution müssen die Häftlinge ihre eigenen Massengräber ausheben. Einige Gräben werden im Lager selbst gezogen, andere außerhalb des Lagers. Man sagt ihnen, dass dies „Splittergräben“ zum Schutz vor Luftangriffen wären. Am 4. November um fünf Uhr früh müssen die Häftlinge zu einem Zählappell antreten und werden dann in ein großes Geschäftsgebäude gepfercht. Dann holt die SS Gruppen von je 50 Häftlingen ab. Im Freien müssen sie ihre Schuhe ausziehen und eventuell verbliebene Wertsachen in Körbe geben, dann bringt man sie in eine nahe gelegene Baracke, wo sie sich nackt ausziehen müssen. Von hier treibt die SS sie zu den Gräben, in die sie hinabsteigen müssen und sich auf den Bauch legen, Gesicht nach unten. Dann werden sie erschossen. Während der Exekutionen spielt man dröhnende Musik aus Lautsprecherwagen, um die Schüsse und Schreie der Opfer zu übertönen.
In einer der Baracken, in der die Mitglieder der jüdischen Untergrundbewegung versammelt sind, kommt es zum Widerstand: Aus versteckt gehaltenen Waffen eröffnen Häftlinge das Feuer auf die SS. Diese setzt jedoch die Baracke in Brand und die jüdischen Kämpfer verbrennen bei lebendigem Leibe. An diesem 4. November werden an die 14.000 Menschen erschossen. Etwa 150 bis 200 Juden hat man am Leben gelassen – sie sollen die Kleider der Opfer sortieren und die Leichen verbrennen. Als die Häftlinge ablehnen, werden sie ebenfalls erschossen, ihre „Arbeit“ wird vom „Sonderkommando“ aus Majdanek und von jenen jüdischen Häftlingen übernommen, die man während der „Aktion Erntefest“ in Majdanek „ausselektiert“ hat. Wochenlang brennen in Poniatowa noch die Leichenfeuer …
Geschützt durch die Körper der Getöteten überleben das Massaker zwei Frauen, Estera Rubinsztajn und Ludwika Fiszer. Stundenlang Seite an Seite mit ihrer toten Tochter im Massengrab liegend, kann Ludwika Fiszer im Schutz der Dunkelheit fliehen.
Flucht aus dem Todeszug
Im Ghetto von Krakau haben inzwischen die Menschen die Hoffnung auf ein baldiges Ende ihrer Leiden nicht aufgegeben. Von ihren Peinigern zum Tode bestimmt, klammern sie sich an die Macht des Überirdischen. Von jenen Weisen, die um die Geheimnisse der alten Schriften wissen und in den Sternen zu lesen gelernt haben, hat man erfahren, dass noch in diesem Jahr sich ein großes Wunder ereignen würde und der Krieg dann sofort zu Ende wäre. Ja, es geht sogar das Gerücht, dass ein tzadik, ein Heiliger, im Ghetto lebe, der Tag und Nacht mit seinem Fernrohr nach einem Zeichen des Himmels suche, um dann die shofar, das Widderhorn, blasen und so das Erscheinen des Messias ankündigen zu können. Und ein anderes Gerücht will wissen, dass die Arbeiter in der Metallfabrik zufällig einen Wasserhahn in der Form des Davidsterns gegossen hätten, ein sicheres Zeichen dafür, so meint man, dass der Erlöser in Kürze die Mauern des Ghetto einreißen und jedem Hungrigen einen großen Laib Brot anbieten würde, jenen Hungrigen, die nun verzweifelt um ein Stück altes Brot beteten. Und man erzählt sich die neuesten Nachrichten, die der heimlich abgehörte Sender Voice of America verbreitet: Eine zweite Front würde durch die Alliierten bald eröffnet und die Nazis und ihre Verbündeten vernichtet werden. Nacht für Nacht wartet man so auf das Ertönen der shofar, auf das Zeichen der Erlösung und die Botschaft, dass Gott sein auserwähltes Volk in dieser schweren Stunde nicht im Stich lasse.

Eine jüdische Familie aus dem Krakauer Ghetto wartet auf die Deportation in ein Vernichtungslager.
Am 28. Oktober 1942 findet die zweite große Deportation aus dem Ghetto statt. Jeder der Ghettobewohner, so die Aufforderung durch die SS, habe sich am Plac Zgody mit seinen wichtigsten Besitztümern einzufinden, man würde das Ghetto „liquidieren“ und alle in Arbeitslager transportieren. Auf den Gesichtern der Menschen, die auf dem Platz mit Koffern und Bündeln zusammenströmen, spiegelt sich die Angst. Man spürt, dass sich hinter den nüchternen Anweisungen der Nazis etwas Furchtbares verbirgt. Etwa 4.500 Menschen werden in die Viehwaggons gepfercht; wieder tötet man in den Wohnungen Kinder und alte Menschen; im Spital erschießt man die Kranken mitsamt den Ärzten.
Betroffen davon ist auch die Familie Sternlicht, die im März 1941 gezwungen worden ist ins Ghetto zu gehen. Vater Szymon Sternlicht, ehemals Soldat der k. u. k. Armee und Inhaber eines metallverarbeitenden Unternehmens in Krakau, besitzt zwar eine Legitimation der Gestapo und spricht fließend Deutsch, aber auch das hilft ihm nichts – er muss den Todeszug ins Vernichtungslager Bełżec besteigen. Zurück bleiben seine Frau Lola, die sich bei einer Christin verstecken kann und so dem Transport entgeht, und die drei Töchter Bronia, Helen und Sydonia. Was mit den „ausgesiedelten“ Juden geschieht, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Von polnischen Eisenbahnern weiß man, dass die Menschen am Zielort spurlos „verschwinden“ und die Züge leer zurückkehren. Die Eisenbahner berichten von Schreien, die sie gehört hätten, Gerüchte von Gaskammern machen die Runde. Soll das Unvorstellbare, der fabriksmäßige Massenmord, tatsächlich Wirklichkeit sein? „Wir wussten es, aber wir wollten es nicht glauben“, wird Helen Sternlicht später über die Stimmung im Ghetto erzählen.
In diesem Todeszug nach Bełżec, zusammengepfercht in einem Viehwaggon, ohne Wasser und mit kaum ausreichend Luft zum Atmen, befindet sich auch die Familie Lezerkiewicz: Abraham und Bertha Lezerkiewicz und drei ihrer fünf Kinder: Leon, Victor und Greta. Zwei Kinder fehlen: Das jüngste, Sohn Jakub, ist bei einer polnischen Familie außerhalb des Ghettos versteckt, das älteste, Tochter Lola, ist bereits 1932 nach Palästina ausgewandert. Vater Abraham hat in der Targowastraße 1 in Kazimierz ein kleines Stoffgeschäft geführt, ins Ghetto ist er im Frühjahr 1942 aus Niepolomice, einem kleinen Ort in der Nähe Krakaus, gekommen. Keiner der Familie konnte einen Blauen Schein ergattern, auch die erwachsenen Söhne nicht, die beide immerhin über eine gültige Arbeitsbescheinigung als Kraftfahrzeugmechaniker verfügten – aber auch diese praktische Profession hatte sie nicht vor der „Aussiedlung“ retten können. Der 24-jährige Victor, der im Sanitätszweiglager Krakau der Waffen-SS tätig gewesen war, hatte sogar eine „Unabkömmlichkeits-Bescheinigung“ vorgezeigt, doch der die „Aktion“ leitende SS-Offizier, Hauptsturmführer Martin Fellenz, hatte sie ihm aus Hand genommen und ungelesen zerrissen; sein lapidarer Kommentar: „Nehmt ihn weg!“ – das Todesurteil.
Victor und sein Bruder Leon, genannt „Leszek“, waren vor der Okkupation Polens durch die Deutschen Mitglieder einer zionistischen Jugendorganisation gewesen und sind entschlossen, nicht alles ohne Gegenwehr hinzunehmen: Sie wollen fliehen. Das Blatt einer Bügelsäge, das Victor in seinem Stiefel immer mitträgt, kommt nun gerade recht: Er beginnt damit die Streben der Metallvergitterung des kleinen Fensters des Waggons durchzusägen – eine Nerven aufreibende Mühsal, da er immer wieder beschworen wird, doch damit aufzuhören, es würden alle erschossen, wenn die Wachen beim Zählappell am Ankunftsort bemerkten, dass jemand fehlte: Auch die bewaffneten SS-Leute am Dach könnten aufmerksam werden. Victor lässt sich jedoch nicht irritieren – „Fahren Sie zum Arbeiten oder in den Tod – was meinen Sie?“, ist seine Gegenfrage, „ich bin überzeugt davon, dass wir alle in die Gaskammer kommen!“ Selbst der Tod beim Sprung aus dem Fenster wäre ihm da noch lieber.
Als es dunkel wird, ist Victor mit dem Durchsägen der Fensterstreben fertig; jetzt geht es nur mehr darum, den günstigsten Moment zur Flucht abzuwarten. Schwester Greta, die zwei Jahre älter ist als Victor, will nicht springen, auch die Eltern fühlen sich dazu nicht imstande. Man nimmt voneinander Abschied. Vater Abraham gibt Victor Geld und seine goldene Schaffhausen-Uhr mit Kette; Leszek erhält von Muttter und Schwester Schmuck, um ihn zu Geld zu machen. Der Vater segnet Victor und Leszek, man umarmt sich ein letztes Mal, alle haben Tränen in den Augen. Gespannt beobachten die beiden Brüder das Gelände, das der Zug durchquert. Als neben der Bahntrasse der Wald von Niepolomice auftaucht, springen sie – zuerst Victor, dann Leszek. Victor schlägt mit dem Kopf auf den Schienen eines Nebengleises auf und verliert das Bewusstsein.
Es ist noch immer dunkel, als Victor zu sich kommt. Von Leszek keine Spur. Er entschließt sich trotz schmerzender Prellungen und Blutergüsse die Gleise entlang Richtung Krakau zurückzulaufen, immer in der Hoffnung, seinen Bruder zu finden. Am Bahnhof Kłaj steigt er in einen Zug nach Bochnia, seine Hoffnung, dass Leszek dort Zuflucht bei Verwandten im Ghetto von Bochnia gesucht hat, erfüllt sich jedoch nicht und so verlässt er das Ghetto in Richtung Bahnhof. Auf dem Weg dorthin kommen ihm SS-Sondertruppen entgegen, die ihn zum Glück unbehelligt lassen, da er kein Armband mit dem Davidstern trägt. Juden, die ohne Armband angetroffen werden, werden auf der Stelle erschossen, ebenso Juden, die es wagen, mit der Eisenbahn zu fahren. Erst später erfährt Victor, was die SS in Bochnia vorhatte: Sie „liquidierte“ an diesem Tag das Ghetto, auch von hier wird ein Transport nach Bełżec geschickt, unter den Opfern sind alle seine Verwandten, von denen er nie wieder etwas hören wird. Da ihm die Chance zu überleben dort größer scheint und er keine Verbindung zu Partisanengruppen hat, kehrt Victor schließlich nach Krakau ins Ghetto zurück – Leszek ist zu seiner Freude bereits vor ihm hier eingetroffen. Von den Tausenden von Menschen im Todeszug wird sonst niemand überleben; ihr Mörder Martin Fellenz wird es nach dem Krieg zum FDP-Ratsherren in Schleswig bringen, ehe 1965 er doch noch wegen Mordes an 39.000 Juden angeklagt wird – das Urteil: 7 Jahre Gefängnis.
Im Ghetto hat sich nun auch Jakub, genannt „Kuba“, der jüngste, eingefunden, er hielt es bei der polnischen Familie nicht mehr aus und wollte seine Familie wiedersehen – zu spät. Victor gelingt es, ihm durch Bestechung jenes Juden, der für die Liste der vorgesehenen jüdischen Arbeitskräfte zuständig ist, eine Anstellung in den „Kabelwerken“ zu beschaffen – ein begehrter Job, denn diese Fabrik wird von einem Deutschen namens Böhme geführt, der seine „Arbeitsjuden“, so erzählt man sich, wie Menschen und nicht wie Vieh behandelt.
Victor, der nun keine Kennkarte mehr besitzt und daher ständig in Gefahr schwebt, findet zunächst in einer Groß-Schneiderei Unterschlupf, dann holt ihn seine alte Dienststelle, das Krakauer Sanitätszweiglager, zurück. Als er hört, dass die Nazis Leute für den Aufbau des neuen Lagers in Płaszów suchen und dafür keine Kennkarte notwendig ist, meldet er sich zum „Barackenbau“ und wird prompt bereits beim Bau der ersten Baracken an der Straße nach Wieliczka eingesetzt. Anfangs kehren er und seine Kollegen, ein Trupp von fünfzig Männern, am Abend immer ins Ghetto zurück; der Weg von und zur Arbeit ist lang, etwa sechs Kilometer sind es von der Baustelle in Płaszów ins Ghetto. Nachdem die ersten drei Baracken fertig geworden sind, werden sie in einer davon einquartiert – das Ghetto sehen sie nie mehr wieder. Victor vermisst seine Freundin Regina Steiner, die mit ihrem Vater Israel im Ghetto lebt, und seinen Bruder Leon sehr. Dazu sind die Arbeitsbedingungen katastrophal: Die Tagesration Essen besteht aus einer Schnitte Brot und einer Tasse schwarzen Kaffees am Morgen, einer Tasse Suppe zu Mittag und einer Tasse Suppe am Abend. Für manche der Männer ist das zu wenig – sie verhungern oder werden von der SS getötet, wenn sie zu schwach sind, um zu arbeiten. Wer zu wenig energisch zupackt, wird mit 25 Peitschenhieben auf das nackte Gesäß bestraft.
Und bald wird in dieser trostlosen Barackenlandschaft jener Mann auftauchen, den er nie vergessen wird: Amon Göth …
Für lebende Leichen
Die Entscheidung ist gefallen: Das neue Zwangsarbeitslager für die noch lebenden Juden im Ghetto von Podgórze wird in Płaszów errichtet. Nach dem Eintreffen des Baubefehls aus Berlin hatten SS-Obersturmbannführer Haase und seine Berater noch Alternativen überlegt: das Dorf Bronowice im Westen Krakaus etwa oder den Krzemionki-Hügel, auf dem sich noch die Festungsanlagen der k. u. k. Armee befinden. Bronowice hat man dann ausgeschieden, weil es über keinen Anschluss an das städtische Wasser- und Kanalnetz verfügt, das Gelände am Krzemionki-Hügel bietet dagegen zu wenig Raum für ein großes Lager. So beginnt am 10. Oktober 1942 die Absiedlung der polnischen Bewohner aus ihren Häusern an der Jerozolimskastraße; Kanal- und Wasserrohre werden verlegt, Straßen errichtet und die jüdischen Friedhöfe zerstört. Neben der Straße nach Wieliczka schlägt man Pfähle ein und spannt Stacheldraht, Warntafeln in Polnisch und Deutsch weisen darauf hin, dass das Betreten des Geländes streng verboten ist, bald erhebt sich ein erster Wachturm über dem Terrain. Die Deutschen haben es eilig. Bereits im November beginnt auf dem Areal der beiden jüdischen Friedhöfe in Wola Duchacka der Bau von Baracken; auf eingeebneten, zerstörten Gräbern, zwischen den ausgegrabenen, in der Sonne bleichenden Knochen wächst nun ein hölzernes Städtchen für die „lebenden Leichen“, wie die Deutschen zynisch ihre jüdischen Arbeitskräfte nennen. Schritt für Schritt werden einzelne Arbeitsgruppen aus dem Ghetto hierher verlegt; insgesamt ist man auf deutscher Seite jedoch unzufrieden mit dem Tempo, in dem der Ausbau des geplanten „Zwangsarbeiterlagers für Juden“ voranschreitet.

Blutiger Terror: Ein deutscher Wachmann hetzt seine beiden Hunde auf einen jüdischen Zwangsarbeiter.
Erster Kommandant auf dem Baugelände ist der SS-Unterscharführer Horst Pilarzik, ein, wie Mietek Pemper ihn später charakterisieren sollte, „ziemlich primitiver Mensch“ mit Magenproblemen, der gerne trinkt und in alkoholisiertem Zustand völlig unberechenbar ist: Am 28. Oktober, dem Tag der letzten „Aussiedlungsaktion“ im Ghetto, erschießt er seine „ersten“ Juden.
Inzwischen bereitet man Schritt für Schritt die „Liquidierung“ des Ghettos vor. Am 14. Dezember ergeht ein Schreiben von Julian Scherner an die Rüstungsinspektion sowie an alle Heeresdienststellen und Privatfirmen mit „wehrwirtschaftlichen Aufträgen“, die jüdische Arbeitskräfte beschäftigen. Diese, so Scherner ohne Umschweife, müssten in Zukunft im „geschlossenen Judenarbeitslager“ Płaszów untergebracht werden. Bis zur Fertigstellung des Lagers verblieben „die Juden in einem besonders umzäunten und gesicherten Teil des bisherigen Krakauer Ghettos (Arbeitsghetto)“. Von hier seien die Arbeiter wie bisher von den Arbeitgebern zur Arbeit abzuholen, zur und von der Arbeitsstätte zu begleiten und wieder „abzuliefern.“ Jeder Arbeitgeber erhalte vom Kommandeur der Sicherheitspolizei „blaue Judenausweise“, die er mit den Personalangaben des betreffenden Juden und dessen Arbeitsverwendung zu versehen habe. Kennbuchstaben und Ordnungszahl dieses blauen Ausweises müssten mit dem Kennbuchstaben und der Zahl auf dem Abzeichen übereinstimmen, dass die jüdischen Arbeitskräfte von nun an auf der linken Brustseite angenäht tragen müssten.