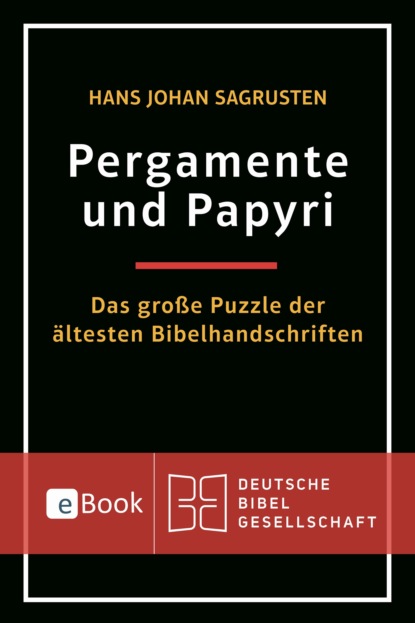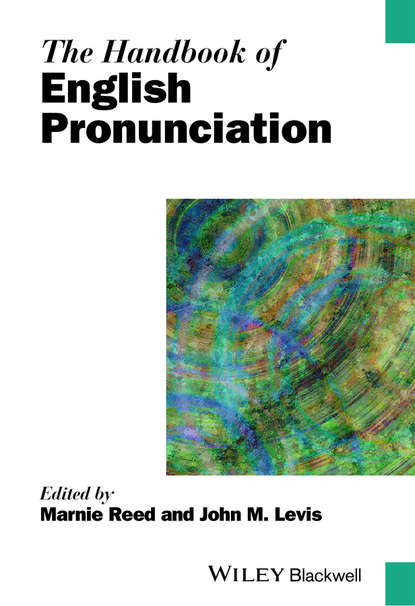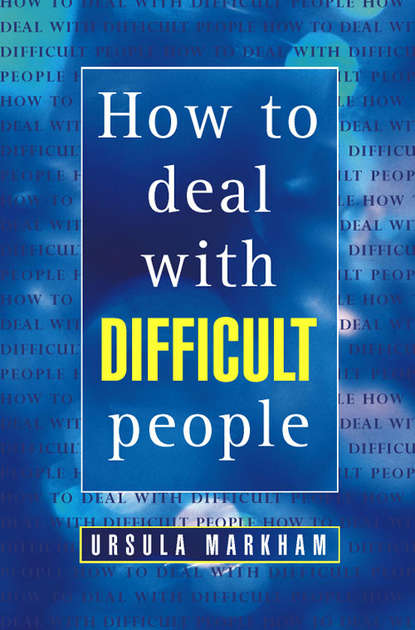- -
- 100%
- +
Tischendorf publizierte den Text des Neuen Testaments 1843 und den des Alten Testaments 1845. Aufgrund all der verwendeten Chemikalien ist es heute noch schwerer als damals, die Schrift zu deuten. Heute benötigt man Ultraviolettfotografie, um den darunterliegenden Text zu sehen, und selbst dann ist er schwer zu erkennen.
Die enorme Leistung der Deutung des Codex Ephraemi Rescriptus brachte Tischendorf bei anderen Forschern Ansehen ein, was leicht zu verstehen ist. Wie er es geschafft hat, alle 209 Bögen des Neuen Testaments zu lesen, ist ein Rätsel. Die Textmenge der erhaltenen Bögen macht über die Hälfte des Neuen Testaments aus.
Der Codex Ephraemi Rescriptus ist ein faszinierendes Beispiel für die Wiederverwertung von Pergament im Mittelalter. Hätte sich ein unbekannter Mönch nicht irgendwann die Mühe gemacht, das alte Pergament erneut zu verwenden, wäre dieses Exemplar des griechischen Neuen Testaments der Nachwelt vielleicht niemals erhalten geblieben. Das zeigt, wie viele Paradoxe die Textgeschichte oft ausmachen: Die augenscheinlich am meisten zerstörten Manuskripte können die größten und erfreulichsten Überraschungen verbergen.
Fakten über den Codex Ephraemi Rescriptus:
Symbol in der Textforschung: C.
Schreibmaterial: Pergament.
Bögen: Vom Alten Testament sind 64 Bögen bewahrt, vom Neuen Testament 145.
Seitengröße: 32 × 27 cm.
Text einspaltig.
Beinhaltet Teile vom Text aller Bücher des Neuen Testaments, abgesehen vom 2.Thessalonicherbrief und dem 2.Brief des Johannes. Ursprünglich enthielt das Buch die komplette Bibel.
Datierung: 5.Jahrhundert.
Der ursprüngliche Text wurde im 12.Jahrhundert abgewaschen und mit 38 Predigten von Ephräm ersetzt, einem syrischen Theologen aus dem 4.Jahrhundert.
Aufbewahrung in der Nationalbibliothek in Paris.
Das nächste Manuskript, dem wir uns widmen, lief Gefahr, zerstört zu werden, als es während der Religionskriege im 16.Jahrhundert aus einer Klosterbibliothek in Lyon geholt wurde. Es erwies sich als ein sehr spezielles Manuskript. Aber wie sollte man ein Manuskript mit einer recht freien Nacherzählung des Bibeltextes einordnen? Sollte man es besser im Verborgenen halten?
Das freie Manuskript: Codex Bezae Cantabrigensis
Überall in der Stadt sind die Geräusche von Zerstörung zu hören: Statuen werden auf dem steinigen Kirchenboden zertrümmert, Mäntel und Chorgewänder in Stücke gerissen, Grabsteine und Reliquien zermalmt – das dumpfe Dröhnen, wenn die Kirchenglocken zu Boden knallen. Protestanten verwüsten und plündern die französische Stadt Lyon. Immer mehr haben sich ihnen in den vergangenen Jahren angeschlossen, und nunmehr haben die protestantischen Hugenotten die alte Stadt eingenommen. Es ist der 2.Mai 1562. Im Zuge der Verwüstungen wird unter anderem das Grab des heiligen Irenäus zerstört.
In dem alten Kloster, das Irenäus’ Namen trägt, steht ein Mann um die vierzig, mit spitzem Bart und scharfem Blick. Tief im Inneren der Bibliothek der Mönche hat er ein altes Buch entdeckt, das sich von den anderen unterscheidet. Es ist Theodore Beza (1519–1605), einer der führenden protestantischen Theologen der in Europa wütenden Religionskriege. Er ist zum ersten Mal hier in der Hochburg der Katholiken der Stadt und blättert nun in dem alten, handgeschriebenen Manuskript von Seite zu Seite. Auch wenn mehrere Seiten fehlen, erkennt Beza umgehend den Wert des Buches: Es beinhaltet das Neue Testament sowohl in Griechisch als auch in Latein. Er schiebt das dicke Buch unter seinen Mantel und verlässt schnellen Schrittes das Kloster.
Ist es Plünderung? Ist es eine Rettungsaktion? Was wäre mit dem Manuskript geschehen, hätte Theodore Beza es nicht an sich genommen? Das wissen wir nicht. Heute jedoch kann das Manuskript in der Universitätsbibliothek Cambridge
studiert werden. Und es trägt noch immer den Namen Bezas, des Mannes, der
es an sich genommen – oder gerettet – hat, je nachdem wie man es betrachtet.
Die historischen Wege vieler Manuskripte sind verzweigt. Der Codex Bezae Cantabrigensis ist ein Beispiel dafür. Es ist an so vielen Orten gewesen, wurde von so vielen Händen berührt und wurde von so vielen Stiften vollgekritzelt, dass man ein ganzes Buch allein mit Erzählungen über dieses eine Manuskript füllen könnte. Das trifft auf alle Manuskripte zu, die so alt sind. Der Textforscher David C. Parker hat dieses Manuskript über viele Jahre genau studiert. Über das alte Buch schreibt er:
»Die Seiten eines geöffneten Manuskripts erscheinen uns zweidimensional. Sie verfügen jedoch auch über eine dritte Dimension, eine zeitliche Perspektive. Je interessanter und komplizierter die Textgeschichte des Manuskripts ist, desto stärker wird diese dritte Dimension für uns sichtbar.«3
Wir können versuchen, uns in diese dritte Dimension hineinzudenken: Wie verstand ein Mönch im 7.Jahrhundert das dort Geschriebene? Was brachte einen protestantischen Theologen in der Renaissance dazu, bei dem Buch innezuhalten? Und was würden uns die zierlich niedergeschriebenen Buchstaben mitteilen, wenn das Buch in diesem Moment direkt vor uns auf dem Tisch liegen würde? Würden wir denken, die roten und schwarzen Buchstaben hätten etwas mit uns und unserer Gegenwart zu tun? Oder würden wir das Manuskript als unzeitgemäß und unbrauchbar zurückweisen?
Diese letzte Möglichkeit – verworfen und zurückgewiesen zu werden – bestimmte in weiten Teilen seiner Existenz das Schicksal des Codex Bezae Cantabrigensis. Grund dafür ist sein ganz spezieller, selbstständiger Text. Viele Forscher und Theologen haben ihn still beiseitegelegt, weil er so viele eigene Formulierungen, so viele eigenartige Varianten und eine so große Freiheit in der Wortwahl aufweist. »Das muss ein Manuskript mit ungewöhnlich vielen Fehlern sein«, dachte man. Aber vielleicht ist es umgekehrt? Wurde der Text des Manuskripts vielleicht gerade mit besonderer Sorgfalt ausgearbeitet? Kann er das Resultat der Arbeit eines großen Künstlers sein – eines Theologen mit einem äußerst feinen Sinn für Stil, der jedes Wort genau abgewogen hat, bevor er die heiligen Texte nacherzählte?
Denn vielleicht gehört dieses Manuskript ins Genre Nacherzählung. Der unbekannte Theologe, der diesen freien Text seinerzeit in der Urkirche ausformuliert hat, war nicht daran interessiert, eine exakte Abschrift des vor ihm liegenden Manuskripts anzufertigen. Nein, er hatte ein vollkommen anderes Ziel vor Augen: Er wollte einen noch schöneren Text formulieren, einen Text, der besonders gut über die Lippen ging, wenn er laut gelesen wurde. Deshalb raufen sich Textforscher heute die Haare, wenn sie sich in fast jeder Zeile einem Schwarm kleiner Umschreibungen, Zusätze und sprachlicher Erweiterungen gegenübersehen. Es ist nicht so, dass der Inhalt ein ganz anderer ist, jedoch ist alles mit einem künstlerischen Sinn für Details erzählt. David C. Parker zufolge erscheint der Text als »eine separate und distinkte Nacherzählung der Geschichte«.
Besonders deutlich ist die freie Nacherzählung in der Apostelgeschichte des Lukas. Dort finden sich so viele Zusätze im Text, dass das Buch an dieser Stelle ungefähr zehn Prozent länger als bei anderen Manuskripten ist. Aber auch hier wurden keine vollkommen neuen Erzählungen hinzugefügt. Es ist der Detailreichtum der Sprache, der das Buch umfangreicher macht.
Einige Forscher diskutieren, ob der eigenartige Text in der Apostelgeschichte eine ganz einfache Erklärung haben kann: Haben von Beginn an zwei verschiedene Versionen dieser Schrift existiert? Hat der Verfasser einen ersten Entwurf an Freunde geschickt, die daraufhin antworteten: »Gut geschrieben, aber es ist viel zu lang. Kürze mindestens zehn Prozent des Textes!«? Hat daraufhin der Verfasser, der traditionell Lukas genannt wird, das Manuskript noch einmal überarbeitet und einige Formulierungen gestrichen? Anschließend wäre die gekürzte Version zu den Schreibern geschickt worden. Parallel dazu kann einer dieser Freunde einige Kopien des langen ersten Entwurfs verbreitet haben, wodurch auch dieser in Umlauf geriet. Kann es sich so zugetragen haben?
Wir wissen es nicht. Jedoch kann nie ausgeschlossen werden, dass Unterschiede zwischen Texten eine so einfache und natürliche Erklärung haben. Wie auch immer: Es ist spannend, sich in die möglichen Geschehnisse der langen und vielfältigen Textgeschichte hineinzudenken.
Der Codex Bezae Cantabrigensis ist in der Tat eines der merkwürdigsten Teile des großen Puzzles der Manuskripte. Er hat einige Ecken und Kanten, durch die er schwerlich ins Bild passt, auch wenn Farbe und Form im Großen und Ganzen mit den anderen Teilen übereinstimmen. Würden alle Manuskripte solche Eigenarten aufweisen, wäre es schwer, festzustellen, wie der ursprüngliche Text des Neuen Testaments gelautet hat. Nun ist es aber vielmehr so, dass dieser Codex eine Art eigensinniger Löwenzahn ist, der sich in ein ordentliches Blumenbeet eingeschlichen hat und dort für Abwechslung sorgt. Das Buch ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt: Die Variationen zwischen den Manuskripten sind meist sehr gering und drehen sich um Details, wobei dieses Manuskript zeigt, wie groß die Unterschiede sein könnten.
Der Codex Bezae Cantabrigensis ist das prächtigste Manuskript dieses eigenartigen Texttyps. Der Wortlaut ist aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch viel älter als das Manuskript. So kann diese freie Form bereits vor dem Jahr 200 entstanden sein. Grund zu dieser Annahme liefern die frühesten Übersetzungen in andere Sprachen, in denen sich ähnliche Textvarianten finden: Dies betrifft die alten lateinischen, syrischen und armenischen Übersetzungen. Diese Textform wird oft als westlich bezeichnet, ohne dass man sie heute mit einem bestimmten geografischen Gebiet verbindet.
Dem unbekannten Theologen als Verfasser dieser freien Textform muss ein altes und sehr genaues Exemplar des Neuen Testaments vorgelegen haben. An vielen Stellen beinhaltet der Codex Bezae Cantabrigensis Varianten, die als sehr alt angesehen werden. An anderen Stellen weist das Buch Varianten auf, die sich in keinem anderen Manuskript finden. Es bietet somit eine ungewöhnliche Mischung aus alten Formen und neuen Varianten.
Ein Beispiel für Änderungen am biblischen Wortlaut ist die Harmonisierung von Details, die in mehreren Evangelien behandelt werden. Denn viele Erzählungen der vier Evangelien ähneln sich. Das gilt unter anderem für die Erzählung, wie Jesus fünftausend Menschen mit zwei Fischen und fünf Broten sättigte. Dieser Text steht in vier verschiedenen Versionen im Neuen Testament. Diese vier Versionen ähneln einander, sind aber nicht vollkommen gleich. Zwischen ihnen gibt es mehrere Unterschiede, ungefähr so wie bei vier Augenzeugen, die mit verschiedenen Worten von ein und demselben Ereignis berichten.
Werden derartige Texte von Hand abgeschrieben, kommt es häufig vor, dass die Schreiber die Unterschiede harmonisieren. Das kann unbewusst geschehen, weil der Schreiber den Markus-Text, wie er ihn in seiner Kirche gehört hat, gewohnt ist und daher einige der Wendungen in ein anderes Evangelium einbaut. Oder es kann bewusst geschehen, indem der Schreiber innehält und denkt: Fehlt in diesem Zitat von Jesus nicht ein Satz? Daraus schließt er, der vorhergehende Schreiber müsse den Satz ausgelassen haben, und schon wird er hinzugefügt. Auf diese Weise gleichen sich Wortlaut und Schreibweise der Evangelien immer mehr an.
Harmonisierungen sind in nahezu allen Manuskripten zu finden. Keines jedoch verfügt über mehr als der Codex Bezae Cantabrigensis. Ganze 1278 Harmonisierungen haben die Forscher in diesem Manuskript entdeckt. Das belegt, dass sich der Schreiber dem Original gegenüber vollkommen frei verhalten hat und den Text an das anpasste, was er im Kopf hatte und was rein sprachlich betrachtet am besten klang.
Dem Textforscher Philip Comfort zufolge muss diese Person »ein Theologe gewesen sein mit einer Vorliebe dafür, historische, biografische und geografische Details hinzuzufügen. Mehr als irgendein anderer war er entschlossen, die Zwischenräume in den Erzählungen zu verdichten, indem er ausfüllende Details hinzufügte«.4 Dieser Umgang mit dem Bibeltext kann schon vor der Entstehung des Codex Bezae Cantabrigensis aufgekommen sein, jedoch ist dieses Manuskript das älteste bewahrte Exemplar dieser Textform.
Besonders zwei Abschnitte machen den Codex für Textforscher zu einem wichtigen Manuskript. Er ist das erste Manuskript, das die beiden längsten Texte beinhaltet, die in den ältesten Manuskripten fehlen: das Ende des Markusevangeliums (Mk 16,9–20) sowie die Erzählung über die Frau, die des Ehebruchs überführt wurde (Joh 7,53–8,11). Das Manuskript ist damit ein Beleg dafür, dass diese beiden Texte zumindest im 5.Jahrhundert ihren Platz gefunden hatten.
Heute erscheint das Manuskript als ein schönes Buch. Wo Seiten fehlten, wurden neue eingesetzt, die Bögen wurden am Rücken zusammengenäht und zwischen zwei Deckel eingebunden. Die Restaurierung erfolgte 1965. Das Buch ist nunmehr fast ebenso prächtig wie einst, als es neu war. In der digitalen Bibliothek der Universität Cambridge kann man durch gute Aufnahmen aller 856 Seiten blättern.
Der Name des Manuskripts ist verzwickt. »Cantabrigensis« verweist auf den Aufbewahrungsort, die Universitätsbibliothek von Cambridge. Dort liegt es schon lange, genauer gesagt seit 1581, als Theodore Beza es als Geschenk übergeben hat. Der erste Teil des Namens weist selbstverständlich auf Beza. Dieser hatte das Manuskript im Laufe der wenigen Monate, in denen die Protestanten 1562/63 die Herrschaft über Lyon innehatten, in seinen Besitz gebracht und es schließlich mit in die Schweiz nach Genf genommen.
Als Theodore Beza das Manuskript an sich nahm, hatte es sich seit vielen Hundert Jahren in der Obhut des Irenäus-Klosters in Lyon befunden. Allerdings behielt Beza das Manuskript nicht sehr lange, lediglich bis 1581, als er es der Universität Cambridge vermachte. Dennoch trägt es seither seinen Namen. Beza selbst scheint es nicht für besonders wichtig gehalten zu haben. Zumindest nutzte er es nicht sonderlich, als er seine eigene Ausgabe des Neuen Testaments auf Griechisch veröffentlichte. Dieses Neue Testament erschien in sechs Ausgaben, wobei die ersten beiden ungefähr zu der Zeit herausgegeben wurden, als sich das Manuskript in Bezas Besitz befand, 1565 und 1582. Befürchtete er, die Menschen würden seine Textausgabe nicht mögen, wenn er all die ungewöhnlichen Varianten des Codex aufgenommen hätte?
Das Manuskript muss sich seit dem 9.Jahrhundert in Lyon befunden haben. Dort wurde es zum ersten Mal restauriert. Beschädigte Bögen wurden durch neues Pergament ersetzt, auf das der betroffene Text geschrieben wurde. Dies ist nachweislich in Lyon erfolgt. Erstens deutet die Handschrift darauf hin: In der Stadt hatte das Fragezeichen zu dieser Zeit einen bestimmten Schwung, gleichzeitig weist die spezielle blaue Tinte nach Lyon. Zweitens ist ganz klar, wer die Restaurierung durchgeführt hat. Im 9.Jahrhundert gab es in Lyon einen tüchtigen Wissenschaftler namens Florus, der für die Restaurierung und Rettung vieler alter Texte und Manuskripte bekannt ist. Er muss auch die feine Arbeit am Codex Bezae Cantabrigensis ausgeführt haben. Florus starb im Jahr 860, wodurch die Restaurierung auf Mitte des 9.Jahrhunderts datiert werden kann.
Aber nicht nur Florus hat Spuren im Manuskript hinterlassen. Vom 6. bis zum 12.Jahrhundert sind zehn verschiedene Schreiber auszumachen, die Berichtigungen an die Ränder, zwischen die Zeilen oder über den alten Text geschrieben haben. Das ist die höchste bekannte Anzahl an Korrektoren bei einem Manuskript. Angesichts der vielen Abweichungen des Manuskripts vom üblichen Bibeltext überrascht es nicht, dass den Menschen daran gelegen war, Korrekturen einzufügen. Denjenigen, die die Berichtigungen einfügten, lagen oftmals andere Manuskripte mit einem »normaleren« Text vor.
Wie alt ist das Manuskript? Heute sind die Forscher aufgrund einer Analyse der Handschrift sowohl des lateinischen als auch des griechischen Textes der Ansicht, es könne auf Ende des 4.Jahrhunderts oder – am wahrscheinlichsten – auf Anfang des 5.Jahrhunderts datiert werden. Früher war es häufig auf die Zeit um das Jahr 500 datiert worden.
Wo kann es geschrieben worden sein? Die Fachliteratur wartet mit einer Unmenge unterschiedlicher Vorschläge auf, wobei jeder Forscher ganz sicher ist, im Recht zu sein: Einige behaupten, es müsse aus Nordfrankreich oder Italien stammen, andere geben an, es komme von der anderen Seite des Mittelmeers, aus Ägypten oder Nordafrika. Nach Meinung von David C. Parker, der heute als größter Experte bezüglich des Codex gilt, könne es aus Syrien oder dem Libanon stammen. Von dort aus kann es während der arabischen Invasion im 7.Jahrhundert nach Sizilien oder Süditalien in Sicherheit gebracht worden sein, bevor es letztendlich nach Lyon in Frankreich gelangte.
Näher kommen wir den Umständen nicht auf die Spur. Niemand weiß, wer das prächtige Manuskript auf Griechisch und Lateinisch geschrieben hat. Unbekannt ist auch, wer in der Urkirche einst Urheber dieses freien, nacherzählenden Textes war. Sicher ist: Als sich Theodore Beza im Kloster von Lyon befand, während die Protestanten in den Kirchen der Stadt wüteten, nahm er sich eines ganz besonderen Schatzes an. Noch heute fasziniert der Codex Bezae Cantabrigensis die Textforscher.
Fakten über den Codex Bezae Cantabrigensis:
Symbol in der Textforschung: D (DEA).
Schreibmaterial: Pergament.
Bögen: Erhalten sind 406 von ursprünglich ca. 534 Bögen.
Seitengröße: 26 × 21,5 cm.
Text einspaltig, Griechisch auf der linken Buchseite und Latein auf der rechten Buchseite.
Beinhaltet Teile des Textes der vier Evangelien und der Apostelgeschichte des Lukas sowie ein Stück aus dem 3.Brief des Johannes.
Datierung: Anfang des 5.Jahrhunderts.
Der Text der Apostelgeschichte des Lukas ist um zehn Prozent länger als bei anderen Manuskripten.
Aufbewahrung in der Universitätsbibliothek Cambridge.
Jetzt haben wir uns drei große Pergamentmanuskripte aus dem 5.Jahrhundert angesehen. Sie sind Belege dafür, dass die Schriften des Neuen Testaments vor dem 5.Jahrhundert verfasst worden sein müssen, da die Bücher zu dieser Zeit im gesamten Mittelmeerraum verbreitet waren. Zuvor, am Übergang vom 4. zum 5.Jahrhundert, war eine entscheidende Weiche gestellt worden: Es wurde endgültig festgelegt, welche Bücher Teil des Neuen Testaments sein sollen. Wie ist es dazu gekommen?
Welche Bücher lasen die ersten Christen?
»Auch wenn uns die Bücher der verschiedenen Evangelien unterschiedliche Dinge lehren, macht das für die Gläubigen keinen Unterschied. Denn in ihnen allen ist alles bekannt gemacht worden, durch den einen, souveränen Geist: alles über seine Geburt, seine Leiden und seine Auferstehung, sein Leben mit seinen Jüngern und sein doppeltes Erscheinen. Das erste, geschehen in Niedrigkeit und Verachtung; das zweite, das in der Zukunft geschehen soll, in strahlender königlicher Macht.«5
Dieses Zitat aus dem Jahr 180 n.Chr. sagt mindestens drei Dinge darüber, welche Bücher die Christen gelesen haben: Zum einen kannten und verwendeten sie mehrere Evangelien. Zum anderen waren sie sich der Unterschiede zwischen den Evangelien bewusst. Des Weiteren stellten diese Unterschiede kein Problem für sie dar, denn das Wichtigste war in ihnen allen enthalten.
Diese Haltung ist für Bibelleser seit jeher typisch: Sie sind die Verschiedenheit der Bücher und den ungleichen Erzählstil gewohnt – und finden das vollkommen in Ordnung. Gleichwohl wurde Ende des 2.Jahrhunderts n.Chr. ein Versuch unternommen, die vier Evangelien zu einem zusammenzuführen. Ein Syrer namens Tatian hatte die Idee, alle Geschichten der vier Bücher zu einem Riesenevangelium miteinander zu verbinden. So könnte vermieden werden, dass der Leser im falschen Evangelium zum Beispiel nach dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter sucht (das ausschließlich im Lukasevangelium steht). Alles würde an einem Ort zu finden sein, in einer zusammenhängenden Erzählung.
Die Idee war gut. Das Riesenevangelium des Tatian fand schnell weiträumig Verbreitung und war allem Anschein nach beliebt. Historisch betrachtet wurde es jedoch zu einem Fiasko. Keines der Manuskripte ist vollständig erhalten. Bekannt ist es heute lediglich durch Erwähnungen, durch Zitate in anderen Büchern, und weil kleine Teile davon gefunden wurden. Es trug den Namen Diatessaron, was so viel bedeutet wie »durch vier«. Wie dem Titel zu entnehmen ist, enthielt das Buch die gleichen Erzählungen, die in den vier Evangelien wiedergegeben sind.
Im 5.Jahrhundert endete die Verwendung des Buches. Viele Bischöfe wollten, dass die Gemeinden die vier individuellen Evangelien lasen. Mitte des 5.Jahrhunderts prahlte ein Bischof damit, zweihundert Exemplare des Diatessaron durch individuelle Evangelien ersetzt zu haben. Der wichtigste Grund aber war wohl, dass die Leser die vier Einzelbücher lieber mochten. Sie waren schlicht und einfach der Ansicht, es sei interessanter, vier unterschiedliche Porträts von Jesus zu lesen als ein standardisiertes. So ist es auch heute: Auch wir finden es spannend, die gleiche Person von vier unterschiedlichen Künstlern porträtiert zu sehen. Der Einsatz von Farben und Formen kann sehr unterschiedlich sein; dennoch sehen wir, dass alle Künstler in ihren Werken die gleiche Person porträtiert haben und lediglich eine bestimmte Seite von ihr besonders betonten.
Den ersten Lesern gefiel es also, dass es mehrere, unterschiedliche Erzählungen gab. So zieht es sich durch die gesamte Bibel. Die unterschiedlichen Bücher des Alten und des Neuen Testaments weisen große Unterschiede auf. Dennoch haben sich die Leser daran gewöhnt, eine Vielzahl unterschiedlicher Genre und Stilarten zu bewältigen. Wie aber kam es dazu, dass exakt diese Auswahl von Büchern zwischen zwei Umschlagseiten landete?
Weder Konzile noch eine zentrale Kirchenmacht haben entschieden, welche Bücher das Neue Testament bilden sollten. Es waren die Christen selbst, die die Bücher durch deren Nutzung auswählten. Bereits Ende des 2.Jahrhunderts hatte sich ein Kern von etwa zwanzig Büchern herauskristallisiert, die überall in Gebrauch waren. Es handelte sich um die vier Evangelien, die Apostelgeschichte des Lukas, dreizehn Paulusbriefe, den 1.Brief des Petrus sowie den 1.Brief des Johannes. Die letzten sieben Bücher waren noch nicht überall in Gebrauch: der Hebräerbrief, der Brief des Jakobus, der 2.Brief des Petrus, der 2. sowie der 3.Brief des Johannes, der Brief des Judas und die Johannesoffenbarung. Dieser Kern von zwanzig Büchern findet sich in zwei verschiedenen Dokumenten des 2.Jahrhunderts:
Im Jahr 1740 fand der Historiker Lodovico Antonio Muratori in der Bibliothek von Mailand ein altes Manuskript. Es ist eine Liste der Bücher, die in den christlichen Gottesdiensten verwendet wurden. Die Liste ist um das Jahr 180 n.Chr. in Rom verfasst worden und erwähnt 22 der Bücher des Neuen Testaments: die vier Evangelien, die Apostelgeschichte des Lukas, zwei Briefe des Johannes, dreizehn Paulusbriefe, den Brief des Judas sowie die Johannesoffenbarung. Das Manuskript bekam den Namen Kanon Muratori, nach dem Historiker, der es gefunden hat.
Ein zweites Beispiel finden wir weiter westlich in einem Gebiet, das heute zu Frankreich gehört. In den 180er-Jahren schrieb Irenäus sein drittes Buch »Gegen die Häresien« (Adversus Haereses). Darin hat er 23 Schriften aufgelistet, die für die Kirche verpflichtend sind. Neben jenen des Kanon Muratori benennt Irenäus den 1.Brief des Petrus sowie den Hebräerbrief, lässt jedoch den Brief des Judas aus. Noch immer ist die Außengrenze der Schriftensammlung also leicht fließend. Gleichzeitig ist ein fester Kern erkennbar: die Evangelien, die Apostelgeschichte des Lukas und die Paulusbriefe sind überall in Gebrauch und werden von niemandem angezweifelt. Irenäus spricht von den »Schriften der Wahrheit« im Gegensatz zu der »Menge an Apokryphen und unechten Schriften«, die es zu seiner Zeit offensichtlich auch gegeben hat.
Wenn wir das Mittelmeer überqueren und ins nordafrikanische Karthago segeln, begegnen wir dort Anfang des 3.Jahrhunderts dem großen christlichen Theologen Tertullian (ca. 160–225 n.Chr.). Er verwendet als Erster den Namen »Das Neue Testament« für eine Sammlung von Schriften. Mit diesem Namen scheint er eine abgegrenzte Sammlung von Büchern zu meinen, auch wenn er nicht angibt, welche Bücher er dazurechnet. Wahrscheinlich denkt auch er an die vier Evangelien, die Apostelgeschichte des Lukas und die verschiedenen Briefe.
Eine Generation später versucht auch Origenes (185–253 n.Chr.) den Umfang des Neuen Testaments zu definieren. Er hält sich in der Nähe des östlichen Mittelmeers, in Caesarea auf. Origenes hält alle 27 Schriften, die heute das Neue Testament ausmachen, für verpflichtend. Er fügt jedoch hinzu, dass der Hebräerbrief, der 2.Brief des Petrus, der 2. und 3.Brief des Johannes, der Brief des Jakobus und der Brief des Judas mancherorts umstritten sind. Zudem ordnet er einige Schriften als falsch ein, unter anderem das apokryphe »Thomasevangelium«.