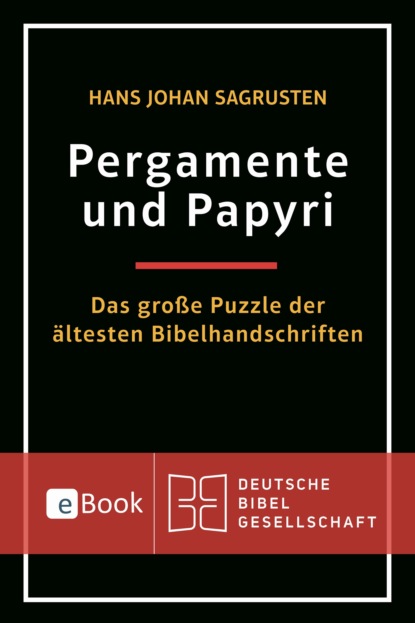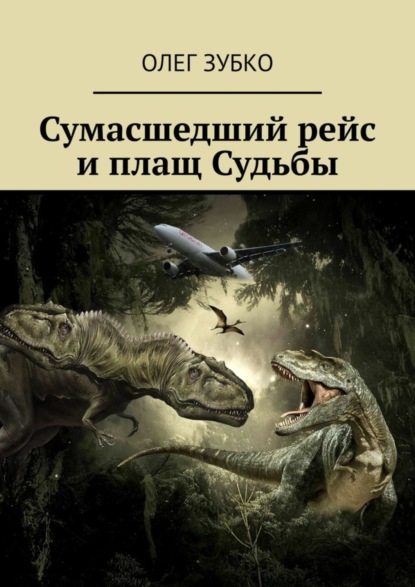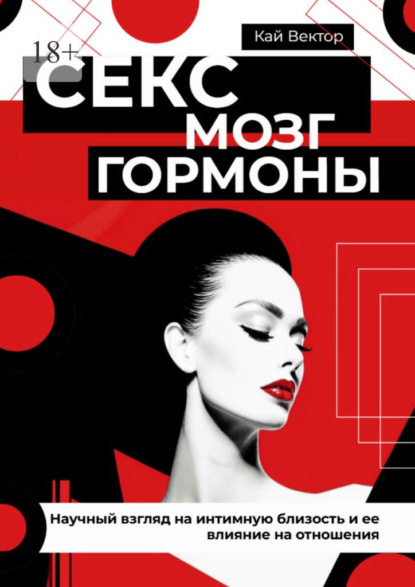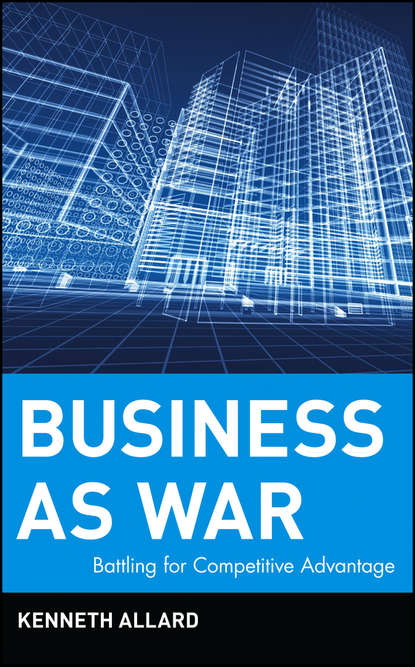- -
- 100%
- +
Einhundert Jahre später hält sich der große Kirchenhistoriker Eusebius (gest. 339 n.Chr.) in Caesarea auf. In seiner Kirchengeschichte beschreibt er die Bücher des Neuen Testaments und teilt sie in drei Gruppen ein: Die erste Gruppe bilden die allgemein anerkannten Bücher, wozu die vier Evangelien, die Apostelgeschichte des Lukas, die Paulusbriefe, der Hebräerbrief, der 1.Brief des Johannes, der 1.Brief des Petrus sowie die Johannesoffenbarung gehören; insgesamt 22 Bücher. In der zweiten Gruppe finden sich die umstrittenen Bücher, die nicht überall in Gebrauch sind: Das sind der Brief des Jakobus, der Brief des Judas, der 2.Brief des Petrus sowie der 2. und 3.Brief des Johannes – das heißt, die restlichen Bücher dessen, was wir als das Neue Testament bezeichnen. Die dritte Gruppe umfasst Bücher, die Eusebius als die unechten bezeichnet: der »Hirte des Hermas«, der Barnabasbrief und die »Lehre der zwölf Apostel«. Daneben gibt es einige Schriften, die es laut Eusebius nicht einmal verdienen, als »unecht« bezeichnet zu werden, wozu er unter anderem das Petrusevangelium und das Thomasevangelium zählt.
Einer der bedeutendsten Kirchenväter zur Zeit der Abgrenzung des Neuen Testaments war Augustinus (354–430 n.Chr.). Er war Bischof im nordafrikanischen Hippo. In seinem Buch »Über die christliche Lehre« benennt er die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Bücher des Neuen Testaments. Seine Aussagen können in drei Punkten zusammengefasst werden:
– Die Schriften mussten apostolischen Ursprungs sein:
Sie mussten von einem Apostel oder einem Mitarbeiter eines Apostels geschrieben worden sein.
– Ihr Inhalt musste apostolisch sein:
Sie mussten die gleichen Botschaften über Christus enthalten wie die anderen Schriften, die bereits in Gebrauch waren.
– Sie mussten allgemein verbreitet sein:
Es reichte nicht aus, eine Schrift vorzuschlagen, die lediglich an einigen wenigen Orten in Gebrauch war. Die Bücher mussten in der gesamten christlichen Kirche bekannt sein und genutzt werden.
Der endgültige Schlussstrich unter das Neue Testament wurde 397 n.Chr. während einer Synode in Karthago gezogen. Dort wurde festgelegt, dass keine anderen Schriften als die 27 des heute bekannten Neuen Testaments verwendet werden sollen. Diese Schriften hatte Bischof Athanasius (298–373 n.Chr.) im Jahr 367 n.Chr. in einem Osterbrief in Alexandria aufgelistet. Und so geschah es.
Diese Punkte belegen, dass die Bücher, die zum Neuen Testament wurden, sowohl im Norden und Süden als auch im Osten und Westen des Mittelmeerraums in Gebrauch waren. Auch wenn dieser lange und spannende Prozess seinen Abschluss letztendlich im Rahmen einer Synode fand, waren es doch die Leser, die entschieden, welche Bücher sie am meisten mochten. Man kann von einer demokratischen Volksbewegung sprechen, die durch Gebrauch über die Auswahl der Bücher entschied – am Ende des Prozesses erst wurden die Beschlüsse gefasst.
Bislang sind wir den Manuskripten des Neuen Testaments zurück bis zum Beginn des 5.Jahrhunderts gefolgt. Jetzt begeben wir uns in das 4.Jahrhundert und widmen uns den beiden prächtigsten und wichtigsten jemals gefundenen Manuskripten des Neuen Testaments. Beide wurden im 19.Jahrhundert erstmals von Forschern beschrieben – und in diese Zeit führt uns das nächste Kapitel.
Das Manuskript im Kloster: Codex Sinaiticus
Siehe Abbildung 2
»Schlafen fühlte sich wie ein Verbrechen an.«6
Das Zitat stammt aus dem Tagebuch des jungen Textforschers Konstantin von Tischendorf (1815–1874). Er hatte soeben eine ganze Nacht mit dem weltweit ältesten kompletten Manuskript des Neuen Testaments in den Händen verbracht. Kein Forscher wusste von der Existenz des Manuskripts, bevor der Verwalter des von Tischendorf besuchten Klosters es aus einem Schrank holte. Tischendorf hatte die Erlaubnis erhalten, es sich näher anzusehen, jedoch nur bis zum nächsten Tag. Er war sich vollkommen im Klaren darüber, wie einmalig diese Möglichkeit war, und blieb dafür die ganze Nacht wach. Zu schlafen wäre schlicht und einfach nicht richtig gewesen, fand er.
Die moderne Geschichte des Manuskripts, das den Namen Codex Sinaiticus bekam, beginnt fünfzehn Jahre vor dieser Nacht 1859. Bereits 1844 reist Konstantin von Tischendorf auf der Suche nach alten Manuskripten des Neuen Testaments in das alte Katharinenkloster am Fuße des Sinai. Er ist nicht einmal dreißig Jahre alt, hat aber bereits viele griechische Bibelmanuskripte studiert. Mithilfe von Chemikalien hat er bereits den Versuch unternommen, die verborgene Schrift des Codex Ephraemi Rescriptus zu deuten. Mit wachsender Spannung hat er zugesehen, wie die alten Buchstaben auf dem Pergament sichtbar wurden, nachdem sie viele Hundert Jahre verborgen waren.
Sein Interesse, die ältesten Manuskripte der Bibel zu finden, entwickelte sich bereits in den Jahren 1834 bis 1838 während seines Theologiestudiums in Leipzig. Der Unterricht bei Professor Johann G.B. Winer löste bei Tischendorf den glühenden Eifer aus, die frühesten Texte des Neuen Testaments ausfindig zu machen. Er beschloss, sich voll und ganz dieser Lebensaufgabe zu widmen und schrieb 1838 an seine Verlobte:
»Ich stehe vor einer heiligen Aufgabe, dem Kampf, den ursprünglichsten Text des Neuen Testaments wiederzufinden.«7
Tischendorf gab sich dieser Lebensaufgabe mit immensem Arbeitseifer hin. Er weihte sein Leben der Suche nach alten Manuskripten, und seine Verlobte musste bis 1845 auf die Hochzeit warten. Tischendorf fand und publizierte mehr Manuskripte des Neuen Testaments als irgendein anderer. Auf seinen vielen und langen Reisen in den Orient fand er insgesamt 21 Manuskripte, die der Forschung bis dahin unbekannt waren. Er schrieb über 150 Bücher und Artikel, vor allem über die Textgeschichte des Neuen Testaments. Und nicht zu vergessen: Acht Mal nahm er die unsagbar detailreiche Kleinstarbeit auf sich, eine neue Textausgabe des griechischen Neuen Testaments anzufertigen. Für diese Textausgaben verglich er Hunderte von Manuskripten bis ins kleinste Detail und erklärte die Unterschiede in Tausenden von Fußnoten. Noch heute zählen Tischendorfs Fußnoten zu den Standardwerken der Forschung zum Neuen Testament.
In den Textausgaben Tischendorfs nimmt der Codex Sinaiticus selbstverständlich einen wichtigen Platz ein. Seiner Meinung nach war das Manuskript das beste und zuverlässigste Exemplar der vorhandenen Bibeltexte. Auch wenn diese Auffassung nach den neuen Funden im 20.Jahrhundert etwas zu differenzieren ist, ist der Codex Sinaiticus für die Forscher noch immer eines der wichtigsten Manuskripte, wenn es darum geht, die älteste Textform auszumachen.
Lassen Sie uns zu seinem ersten Besuch im Katharinenkloster 1844 zurückkehren. Die Geschichte des Klosters reicht bis ins 6.Jahrhundert n.Chr. zurück. Mehr als eintausend Jahre lang haben sich hier Mönche der Abschrift biblischer Bücher gewidmet. In den Wänden steckt eine uralte Schrifttradition – buchstäblich gesprochen, wie sich 1975 herausstellen sollte. »Hier könnten sich alte, unentdeckte Manuskripte finden«, denkt Tischendorf. Er erhält die Erlaubnis, sich in der Bibliothek des Klosters umzusehen, entdeckt jedoch nichts von besonderem Interesse.
Wie sich später herausstellen sollte, wurden andernorts im Kloster weitere Manuskripte gelagert. Erst 1975 wurde ein geheimer, zugemauerter Raum entdeckt. Niemand weiß genau, wann und warum der Raum versiegelt wurde. Wahrscheinlich haben die Mönche den alten Brauch praktiziert, abgenutzte Manuskripte nicht wegzuwerfen, sondern sie zu begraben. Bei dem Einmauern kann es sich um eine solche Grablegung alter, nicht mehr in Gebrauch befindlicher Dokumente gehandelt haben.
Das muss so weit in der Zeit zurückgelegen haben, dass sich keiner der Mönche daran erinnerte, als Tischendorf an jenem Tag ins Kloster kam. Der Raum muss spätestens im 18.Jahrhundert versiegelt worden sein. In ihm wurden mehr als 1000 Manuskripte in unterschiedlichen Sprachen gefunden; 836 davon waren auf Griechisch verfasst. Zwölf der gefundenen Bögen stammen aus dem alttestamentlichen Teil des Codex Sinaiticus und waren den Forschern bis dahin unbekannt.
Überhaupt haben sich die Klöster im östlichen Teil der Christenheit als unglaublich wichtige Verstecke des griechischen Bibeltextes erwiesen. Als die westliche Kirche im 4.Jahrhundert n.Chr. dazu überging, Latein zu verwenden, lasen die Mönche im Osten die Texte weiterhin auf Griechisch. Als die meisten im Westen noch vorhandenen griechischen Manuskripte durch Kriege und Verfolgungen vernichtet wurden, wurde im Osten der griechische Text hinter dicken Klostermauern beständig von Hand kopiert. Als im Zuge der arabischen Invasion um 640 die Klöster und Kirchen in Nordafrika in Schutt und Asche gelegt wurden, fuhren die Mönche im Osten damit fort, ihre Manuskripte abzuschreiben. Bis sie im 15.Jahrhundert selbst von der muslimischen Invasion übermannt wurden, hielten sie an ihren Traditionen fest und überlieferten den Bibeltext – auf Griechisch. Durch die wechselnden Jahreszeiten der Geschichte hindurch hat der griechische Bibeltext hinter den Klostermauern schlicht und einfach überwintert, sicher verborgen vor Kriegen und Gefahren.
Während seines ersten Besuchs 1844 findet Tischendorf jedoch nichts von besonderem Interesse. Erst als er aus der Bibliothek kommt, hält er inne: In einem Korb mit altem Abfall, den die Mönche zum Feueranmachen verwenden, entdeckt er einige alte Pergamentbögen mit griechischen Buchstaben darauf. Tischendorf erkennt sofort, dass die Schrift darauf sehr alt ist und dass die Texte von der griechischen Übersetzung des Alten Testaments stammen. Er zieht 43 Bögen aus dem Korb. Ein Mönch berichtet ihm, dass sie bereits zwei Körbe voll solch alter Bögen verbrannt hätten. Auf der Suche nach alten Dokumenten, die sie zum Feueranzünden verwenden konnten, hatten sie offensichtlich die Bibliothek aufgeräumt. Der alte Brauch, die Manuskripte zu begraben, anstatt sie zu verbrennen, war zu dieser Zeit offenbar in Vergessenheit geraten. Tischendorf bittet die Mönche, fortan nicht mehr mit alten Manuskripten Feuer zu machen, und nimmt die 43 Bögen mit nach Europa. Diese 43 Bögen beinhalten Text vom 1.Buch der Chronik, Jeremia, Nehemia und Ester. Tischendorf veröffentlichte sie unter dem Namen Codex Frederico-Augustanus. Heute befinden sie sich in der Universitätsbibliothek Leipzig.
1853 kehrt Tischendorf in das Kloster zurück, jedoch sind die Mönche dieses Mal ihm gegenüber ein wenig misstrauisch; seine Begeisterung beim ersten Besuch war ihnen nicht entgangen. Daher bekommt er keine weiteren Manuskripte zu sehen. Auch als er 1859 ein drittes Mal zurückkehrt, scheint die Suche nach alten Manuskripten ergebnislos zu bleiben. Am Tag vor seiner geplanten Abreise zeigt er dem Verwalter des Klosters eine von ihm in Druck gegebene neue griechische Ausgabe des Alten Testaments. Der Verwalter entgegnet, dass auch er über eine griechische Bibel verfüge. Aus dem Schrank in seiner Klosterzelle holt er ein riesengroßes Manuskript, eingewickelt in rotes Tuch. Das Tuch wird zur Seite geschlagen und dort, vor den Augen des überwältigten Tischendorf, liegt ein Schatz der Art, wie er ihn die ganze Zeit gehofft hatte zu finden: 199 Bögen eines biblischen Manuskripts aus den ersten christlichen Jahrhunderten, mit uralter, griechischer Handschrift geschrieben. Die Seiten sind weder verblasst noch an den Rändern beschädigt, wie es bei vielen alten Funden der Fall ist. Diese Bögen befinden sich in einem guten Zustand. Das Pergament ist noch immer geschmeidig und hell, die Handschrift auf allen Seiten gut und leicht lesbar.
Tischendorf bemüht sich, seine enorme Begeisterung zu verbergen, und bittet darum, sich das Manuskript bis zum nächsten Tag ansehen zu dürfen. Dieser Wunsch wird ihm gewährt. Es ist diese Nacht, in der Konstantin von Tischendorf hellwach, mit weit aufgerissenen Augen im schlechten Licht einer flackernden Lampe dasitzt und Seite um Seite des alten griechischen Bibeltextes liest. In dem Manuskript findet er viel mehr, als er gehofft haben kann. Es beinhaltet nicht nur den Großteil des Alten Testaments, sondern auch das komplette Neue Testament sowie zusätzlich zwei frühe christliche Bücher aus dem 2.Jahrhundert: den Barnabasbrief, der zuvor ausschließlich in der lateinischen Übersetzung bekannt war, sowie einen Großteil des Buches Der Hirte des Hermas, von dem Forscher bisher nur durch dessen Erwähnung in anderen Schriften wussten.
Am nächsten Morgen versucht Tischendorf das Manuskript käuflich zu erwerben, die Antwort lautet jedoch Nein. Der Abt des Klosters erlaubt ihm einzig, das Manuskript zwecks Anfertigung einer Abschrift auszuleihen. Auf dem Rücken eines Kamels wird ihm das Manuskript nach Kairo gebracht, jedoch immer nur in Auszügen. Die Seiten sind in zusammengefalteten Stößen mit jeweils acht Bögen geordnet, wobei Tischendorf jeweils nur einen Stoß ausleihen darf. Mithilfe zweier anderer Deutscher, die sich zufällig in Kairo aufhalten und ein bisschen Griechisch können, einem Apotheker und einem Buchhändler, wird das komplette Manuskript von Hand abgeschrieben. Innerhalb von zwei Monaten erfassen sie 110.000 Zeilen mit griechischem Text.
Heute befindet sich der Codex Sinaiticus nicht mehr im Katharinenkloster. Nach Tischendorfs drittem Besuch wurde das Manuskript anlässlich des tausendjährigen Jubiläums des russischen Imperiums dem Zaren von Russland als Geschenk vermacht. Der Zar war der oberste Schutzherr der orthodoxen Kirche, und dem Kloster war es daran gelegen, die Verbindung zu Moskau zu pflegen, um schmerzlich benötigte Mittel für den Erhalt der alten Gebäude zu bekommen. 1862 wurde der Codex Sinaiticus daher dem Zaren als Geschenk überreicht, und Tischendorf publizierte die erste gedruckte Ausgabe des Manuskripttextes. Im Gegenzug erhielt das Kloster vom Zaren sowohl wertvolle Gegenstände als auch Geld, unter anderem 7000 Rubel zur Erweiterung der Klosterbibliothek.
Viele denken vermutlich, das Manuskript hätte dort verbleiben sollen, wo es herkam. Es waren die vielen Mönche im Osten, deren Namen wir nicht kennen, die über die vielen Jahrhunderte des Mittelalters hinweg in unfassbar mühevoller Schreibarbeit die heiligen Schriften auf Griechisch bewahrt haben. Heute jedoch sind es die großen Manuskriptsammlungen im Westen, die sich im Glanz der prächtigen Pergamentbücher sonnen. Das fühlt sich nicht richtig an.
Gleichzeitig haben die westlichen Sammlungen und Museen eine enorme Arbeit geleistet, die alten Manuskripte zu untersuchen, zu beschreiben und zu bewahren und sie sowohl Forschern als auch anderen Interessierten zugänglich zu machen. So kann man sagen, Westen und Osten haben beide auf ihre Weise dazu beigetragen, dass wir heute Nutzen aus den alten Büchern ziehen können: Die Mönche im Osten verfügten über die Treue und den Fleiß, den griechischen Text über Jahrhunderte mit Kriegen und Katastrophen hinweg zu bewahren, während die Sammler im Westen über die Ressourcen verfügten, die Manuskripte in der Gegenwart zugänglich zu machen. Dieser gemeinsame Einsatz ermöglicht es, dass wir uns heute über diese Manuskripte freuen und sie Menschen zeigen können, die sich für Geschichte und die alten griechischen Bibeltexte interessieren.
»Die Menschen zogen ihre Hüte …«
»Die Menschen zogen ihre Hüte, als sie zu dem Manuskript traten. Der bloße Anblick erfüllte sie mit Ehrfurcht.«8
So reagierten die Menschen, als sie den Codex Sinaiticus in London zum ersten Mal sahen. Denn die Geschichte des Manuskripts endet nicht in Russland. Nach der russischen Revolution 1917 ist der sowjetische Staat nicht sonderlich an der Bibel interessiert, außerdem braucht man Geld. Kurz vor Weihnachten 1933 kauft das British Museum das Manuskript für 100.000 Pfund und stellt es unter strenge Bewachung. Zur Finanzierung des Kaufs trägt auch eine große Sammelaktion unter Privatpersonen bei. Die bekannten Textforscher des Museums, H.J.M. Milne und T.C. Skeat, analysieren die Handschrift gründlich und veröffentlichen 1938 ihre Ergebnisse. Der Codex Sinaiticus wird auf Mitte des 4.Jahrhunderts n.Chr. datiert. Noch heute gilt er als das älteste komplette Manuskript des Neuen Testaments. Er hat sogar eine eigene Internetseite bekommen (www.codexsinaiticus.org), wodurch sich jeder diesen unglaublichen Fund ansehen kann. Er ist beinahe 1700 Jahre alt, aber die Seiten sind noch immer gut erhalten. Auf der Internetseite sieht man auch, wie das verwendete Pergament hergestellt wurde und wie gegenwärtig an dem Manuskript geforscht wird.
Was hat Konstantin von Tischendorf in dieser Nacht gesehen, als er das Manuskript allein studierte? Die alten Bögen vor ihm stammten aus einer großen Prachtbibel und waren aus feinstem Pergament, d.h. aus bearbeiteter Tierhaut. Pergament war das beständigste Schreibmaterial der Zeit. Im 4.Jahrhundert hatte es Papyrus als gängigstes Schreibmaterial abgelöst. Neuen Untersuchungen der British Library zufolge wurde der Großteil der Seiten des Codex Sinaiticus aus Kalbshaut hergestellt, was als feinstes Leder galt, während einige Seiten aus Schafsleder sind.
Am auffälligsten jedoch ist die hohe Qualität des Pergaments. Die Bögen sind extrem dünn; alle sind zwischen 0,1 und 0,2 Millimeter dick, das Leder ist hell, gleichmäßig und fein. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei der Herstellung des Buches die besten Pergamentbögen ausgewählt wurden, die aufzutreiben waren. Berechnungen zufolge war für die Fertigung der großen Lederbibel die Haut von etwa 360 Tieren vonnöten. Mit heutigem Geldwert gerechnet, muss allein das Pergament des Buches einen fünfstelligen Euro-Betrag gekostet haben.
Die Bögen sind groß; ganze 43 × 38 cm. Sie sind beidseitig beschrieben und waren in Stößen von je acht Bögen zusammengefaltet, in Buchform zusammengelegt und am Rücken zusammengenäht worden. Die Schrift verläuft über vier Spalten, mit ausreichend Platz zwischen den Spalten sowie entlang der Ränder. Aufgeschlagen macht das Buch einen imposanten Eindruck, mit acht schnurgeraden Spalten und einer Breite von 76 cm von Seitenrand zu Seitenrand. Die großzügigen Ränder belegen, dass bei der Fertigung des Manuskripts an nichts gespart wurde; das feine Pergament war äußerst kostbar, dennoch legten die Schreiber Wert auf ein schönes und luftiges Layout. Die Handschrift ist schön und gleichmäßig. Laut Untersuchungen haben vermutlich vier verschiedene Personen dieses Manuskript per Hand verfasst.
Aber waren die Schreiber vielleicht mehr daran interessiert, schön anstatt richtig zu schreiben? Der Codex Sinaiticus ist nämlich ein Manuskript mit ungewöhnlich vielen kleinen Schreibfehlern. Auf jeder Seite finden sich Korrekturen, bei denen der Schreiber selbst oder jemand aus seinem Umfeld vergessene Buchstaben und Wörter ergänzt hat. Zudem wurden in späteren Jahrhunderten viele Korrekturen und Änderungen an dem Manuskript vorgenommen. Jemand mit Zugang zu anderen Manuskripten, in denen Wörter und Sätze anders geschrieben waren, hat sie in den Text eingefügt. Viele dieser Stellen wurden ein weiteres Mal bearbeitet und die Korrekturen dabei zurückgenommen. Das verweist auf einen langen und spannenden Werdegang des Manuskripts. In modernen Ausgaben des griechischen Neuen Testaments werden alle diese verschiedenen Korrekturen und Änderungen mit den Zahlen 1,2,3 usw. in den Fußnoten markiert, während der ursprüngliche Text, vor all den Änderungen, mit einem Stern (*) markiert wird.
Tischendorf betrachtete den Codex Sinaiticus als das wichtigste und beste Manuskript des Neuen Testaments. Um dies zu unterstreichen, gab er ihm ein ganz besonderes Symbol, als er 1869 eine gedruckte Ausgabe des griechischen Textes anfertigte: Den ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, Aleph (

Auch heute noch hat der Codex Sinaiticus einen Ehrenplatz unter den alten Manuskripten des Neuen Testaments. Er ist das älteste, von der ersten bis zur letzten Seite komplett unbeschädigte Exemplar des Neuen Testaments. Einen Beitrag zur Stellung des Manuskripts leistete wohl auch die besondere Geschichte rund um dessen Auffinden durch Tischendorf sowie die Berühmtheit, die es danach erlangte. Später wurden viele Papyrusmanuskripte gefunden, die noch älter sind als der Codex Sinaiticus. Aber keines dieser Manuskripte ist so schön und unversehrt wie die große Bibel aus dem Kloster am Sinai.
Im Großen und Ganzen haben die neuen Papyrusfunde des 20.Jahrhunderts nur bestätigt, wie wichtig der Codex Sinaiticus ist. Sie belegen, dass es sich bei dem Manuskript vom Sinai um eine frühe Textform handelt und der Codex Sinaiticus somit noch immer ein wichtiges Zeugnis der Bibeltexte der ersten Jahrhunderte ist. Auch in Zukunft wird der Codex Sinaiticus für Forscher wichtig sein, wenn es darum geht, welche Textform den Ausgangspunkt für neue Bibelübersetzungen bilden soll.
Fakten Codex Sinaiticus:
Symbol in der Textforschung:
Schreibmaterial: Pergament.
Gefunden 1859, publiziert 1862.
346 Bögen (694 Seiten).
Seitengröße: 43 × 38 cm.
Text vierspaltig.
Erstellt von drei oder vier verschiedenen Schreibern.
Beinhaltet das gesamte Neue Testament (sowie den Barnabasbrief und Teile des Hirten des Hermas) und das Alte Testament ab dem 1.Buch der Chronik 9,27 (sowie einige Fragmente der Bücher des Mose).
Datierung: ca. 350 n.Chr.
Aufbewahrung in der British Library in London (347 Bögen), in der Universitätsbibliothek Leipzig (43 Bögen), in der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg (Teile von 6 Bögen) und im Katharinenkloster (mindestens 18 Bögen).
Online zu sehen unter: www.codexsinaiticus.org
Eine Entdeckung der Gegenwart rückt den Fund des Codex Sinaiticus in ein neues Licht. In einer Mauernische des Katharinenklosters wurden mehrere alte Manuskriptbögen entdeckt.
Der Manuskriptschatz in der Mauer
Im November 1971 brach im St.-Georg-Turm des Katharinenklosters ein Brand aus. Das Feuer war der Auftakt zu einem neuen und unerwarteten Kapitel der Geschichte. Denn niemand hatte geglaubt, dass sich in den hohen Klostermauern noch mehr Schätze verbargen. Nachdem der Codex Sinaiticus entdeckt worden war, hatten Forscher neben der Bibliothek auch jeden noch so abgelegenen Winkel des Klosters nach weiteren alten Manuskripten durchsucht. Keiner von ihnen hatte jedoch mit weiteren Funden gerechnet. Aber genau das ist passiert. Dazu wenden wir uns der Zeit zu, in der das Kloster drei, vier Jahre nach dem Brand restauriert wurde.
Arkimandritt Sofronius hat viele Jahre seines Lebens darauf verwendet, Geld für die Restaurierung des St.-Georg-Turms zu sammeln. Auch die Nordwand des Klosters war durch den Brand beschädigt worden und bedurfte der Reparatur. 1975 können die Arbeiten endlich beginnen. Am 25.Mai kommt es zu einer großen Entdeckung. Sie ist der Anfang eines der größten Manuskriptfunde des 20.Jahrhunderts.
Durch die Hitze des Feuers ist der Putz an einigen Stellen der Klostermauer aufgeplatzt. Als die Arbeiter den beschädigten Putz abschlagen, entdecken sie in der Mauer eine ehemalige Öffnung, die mit Holz, Erde und Steinen aufgefüllt worden war. Niemand weiß, was sich dahinter befindet. Denn soweit die Erinnerungen reichen, hat die Mauer so dagestanden; nicht einmal die ältesten Mönche erinnern sich, dass jemand von einem alten Raum an dieser Stelle der Mauer gesprochen hätte. Die Öffnung muss also schon sehr lange verschlossen sein. Als einer der Mönche ein Loch in die Wand schlägt, findet er dahinter, zwischen Erde und Gestein, einen alten Pergamentbogen. Liegen dort drin eventuell noch weitere Bögen?
Arkimandritt Sofronius entschließt sich, die einstige Öffnung mit den bloßen Händen freizugraben. Innerhalb von 44 Tagen füllt er 47 große Kartons mit Manuskripten und Manuskriptresten. Von seinem Fund erzählt Sofronius niemandem. Lediglich Erzbischof Damianos erstattet er regelmäßig Bericht über seine Arbeit. Einen Monat nach Beginn der Ausgrabungen, am 25.Juni 1975, macht Sofronius einen Fund, den niemand für möglich gehalten hatte. Es besteht kein Zweifel: Das Seitenformat, die geraden Spalten, die Form der Buchstaben, die hohe Qualität des Pergaments – alles weist in die gleiche Richtung: Er hat einen weiteren Bogen des Codex Sinaiticus gefunden, des ältesten kompletten Exemplars des Neuen Testaments. Direkt vor ihm liegt eine Seite des Alten Testaments, die zu dem Teil des Manuskripts gehört, von dem bisher angenommen worden war, die Mönche hätten ihn vor mehr als einhundert Jahren verbrannt.