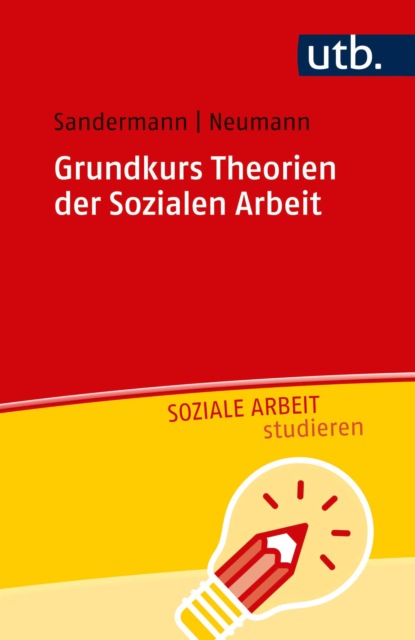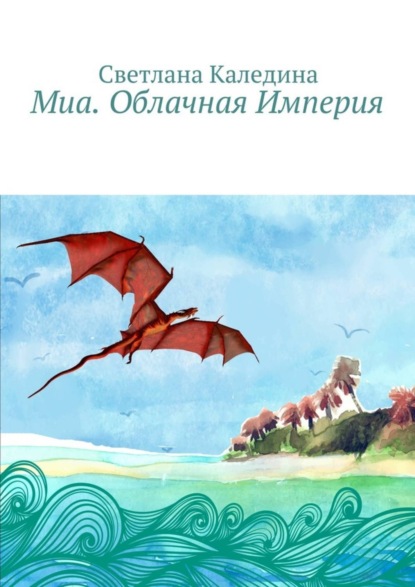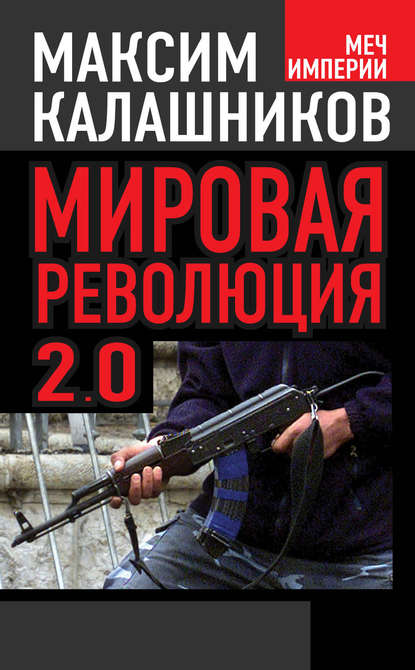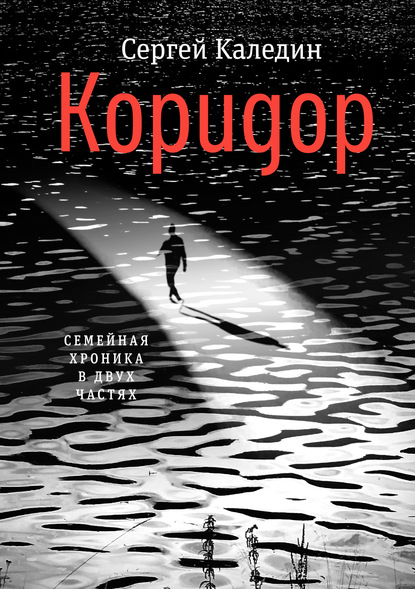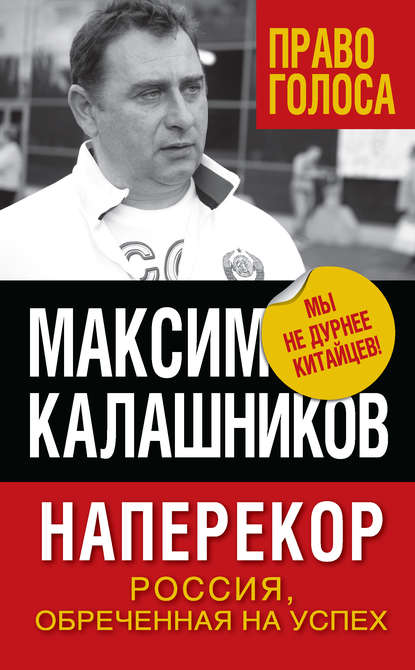- -
- 100%
- +
Die Vorstellung, wissenschaftliches Wissen – und demzufolge auch Theoriewissen – könnte Handlungsanleitungen für die Soziale Arbeit bieten, ist also durchaus verbreitet. Allerdings ist diese Vorstellung dort, wo es um „Theorien der Sozialen Arbeit im engeren Sinn“ (Füssenhäuser/Thiersch 2015, 1743) geht, in der Regel nicht zu finden. Diese zielen stattdessen auf etwas Anderes, und zwar
„auf die Klärung des Status der Sozialen Arbeit, ihres Gegenstandsund Aufgabenbereichs und ihrer gesellschaftlichen Funktion, ihrer geschichtlichen Selbstvergewisserung und ihrer Positionierung im Kontext anderer Disziplinen und der Anforderungen der Praxis“ (Füssenhäuser/Thiersch 2015, 1743).
Es wird deutlich: Der Abstraktionsgrad, mit dem Theorien der Sozialen Arbeit ansetzen, ist ziemlich hoch. Zu klären sind hier offenbar eher Fragen von recht allgemeinem Interesse, wo es um ein angemessenes Verständnis von Sozialer Arbeit geht. Somit wäre es zugleich ein Missverständnis davon auszugehen, man könnte in Theorien der Sozialen Arbeit Anweisungen finden, die sich in ganz konkreten, und damit hoch besonderen Situationen der Praxis wie Rezepte anwenden ließen. Auch wäre es ein Missverständnis, wenn man davon ausginge, dass Theorien der Sozialen Arbeit die konkrete, besondere Praxis in allen ihren Facetten und spezifisch lokalen Bedingungen überhaupt ganz exakt widerspiegeln, oder gar vorhersagen könnten. Stattdessen geht es in Theorien der Sozialen Arbeit eben genau darum, das Allgemeingültige (und nicht das Besondere) an „der Sozialen Arbeit“ begreifbar zu machen. Es geht ihnen – anders gesagt – darum, die Komplexität und Vielfältigkeit möglicher Beobachtungen zu Sozialer Arbeit weitestgehend zu reduzieren. Im Ergebnis zielen die Theorien damit auf weniger genaue, dafür aber breiter verallgemeinerbare Aussagen zur Sozialen Arbeit. Damit entfernen sie sich zugleich systematisch von möglichst exakten Technologien für Einzelfallprobleme, und interessieren sich stattdessen für „Soziale Arbeit als Ganzes“ (Borrmann 2016). In Anlehnung an den von C. Wright Mills (1959) geprägten Begriff der „Grand Theories“ haben wir Theorien der Sozialen Arbeit daher an anderer Stelle auch schon als „Großtheorien“ bezeichnet (Sandermann/Neumann i.E.; kritisch auch schon Winkler 2005, 19).
Es liegt somit keineswegs an schlichtem Unvermögen, wenn Theorien der Sozialen Arbeit keine Technologien liefern. Zum einen lässt sich mit guten Gründen behaupten, dass Theorien insgesamt und jenseits der in diesem Buch besprochenen Theorien wenig taugen für die Ableitungen von Technologien und Rezepten (Knorr-Cetina 2007). Viel entscheidender ist für die vorliegende Einführung jedoch, im Auge zu behalten, dass Theorien der Sozialen Arbeit solche Technologien eben gar nicht bieten wollen. Das heißt auch, dass jede Theorie, die im Rahmen des vorliegenden Buches dargestellt wird, am Ende vor allem möglichst verallgemeinerbare Aussagen zur Sozialen Arbeit bietet, und sich aus diesem Grund als Material für eine Suche nach möglichst exakten Rezepten für konkrete Einzelsituationen denkbar schlecht eignet.

Wir wollen das noch einmal auf unser anfängliches Beispiel aus der Schulstation übertragen. Sucht man in einer Theorie der Sozialen Arbeit nach Rezepten oder eindeutigen Hinweisen dazu, wie die Schulsozialarbeiterin X mit dem Schulverweigerer Y in der Schulstation Z verfahren soll, findet man hier höchstwahrscheinlich: Nichts. Stattdessen ist es schon wahrscheinlicher, dass man hier auf Antworten zur Frage stößt, ob Schulstationen eigentlich als Teil der Sozialen Arbeit zu verstehen sind, und falls ja oder nein, inwiefern und warum das so gesehen werden kann. Was die konkrete Rolle von Schulsozialarbeiterinnen im Umgang mit schuldevianten jungen Menschen angeht, könnte es indessen schon wieder schwieriger werden. Denn es ist wahrscheinlich, dass die Theorie der Sozialen Arbeit, in die man hineinliest, nur an äußerst wenigen oder sogar gar keinen Stellen Beispiele aus dem Bereich der Schulsozialarbeit nutzt, weil Schulsozialarbeit im Lichte dieser Theorie eben nur ein Teilgebiet dessen ist, wozu allgemeine Aussagen getroffen werden: Soziale Arbeit.
Heißt das nun aber im Umkehrschluss nicht doch, dass Theorien der Sozialen Arbeit letztlich völlig wertlos sind für jemanden, der sich für praktisches Handeln in der Sozialen Arbeit interessiert? Handlungssituationen kommen doch immer als konkrete und damit per se als einzelfallbezogene, und nicht als allgemeine Probleme daher. Was bringen dann Theorien, die sich scheinbar nicht für konkrete Lösungen, sondern nur für Allgemeines interessieren?
Diese Fragen sind durchaus berechtigt, und interessanterweise werden sie auch von WissenschaftlerInnen immer wieder gestellt. Das Gegenmodell, das gegen solche „Großtheorien“ ins Spiel gebracht wird, sind sog. „Middle Range Theories“, welche in ihrem Begriff auf den amerikanischen Soziologen Robert K. Merton (1968) zurückgehen.

Unter Middle Range Theories, im Deutschen meistens benannt als Theorien mittlerer Reichweite, versteht man Theorien, die bewusst ein nur mittleres Maß an Abstraktion anstreben und somit relativ nah an einer Beschreibung von empirischen Beobachtungen bleiben. Die Vorteile dieser Theorien mittlerer Reichweite bilden zugleich ihre Nachteile. Durch ihr höheres Maß an Konkretheit taugen sie einerseits für eine detailliertere Abbildung der beobachteten Zustände sowie für weitergehende Ableitungen von Prognosen und Technologien für den erforschten Bereich. Andererseits macht sie das weniger übertragbar auf andere als die konkret von ihnen erklärten Zustände.
Wir werden uns mit diesem Gegenmodell der Middle Range Theories und der Frage, ob Großtheorien für die Produktion von Wissen zur Sozialen Arbeit nicht letztlich überflüssig sind, im letzten Kapitel dieses Buches noch ausführlicher beschäftigen (Kap. 6). Um so viel bereits vorwegzunehmen: Großtheorien der Sozialen Arbeit sind wichtig, und zwar sowohl für die wissenschaftliche Forschung als auch für das Handeln von Studierenden und PraktikerInnen der Sozialen Arbeit. Es kommt aber darauf an, bei der Lektüre und Diskussion von Großtheorien das Richtige von ihnen zu erwarten.
Hierfür ist eine Differenzierung nötig. Zutreffend ist: Theorien der Sozialen Arbeit dienen als solche nicht dazu, direkte Lösungen für konkrete Handlungsprobleme in der Praxis anzubieten. Eben deshalb sind sie keine Technologien oder gar Rezepte. Das heißt jedoch im Umkehrschluss nicht, dass sie für eine Aufklärung konkreter Handlungsprobleme und Lösungen der Praxis nicht taugen würden. Mit Theorien der Sozialen Arbeit kann man sich durchaus für diese konkreten Momente interessieren. Allerdings nicht, um dann konkrete Lösungen aus der Theorie einfach abzuleiten, sondern um aus der Beobachtung konkreter Momente Sozialer Arbeit allgemeine Schlussfolgerungen ziehen zu können. Wie wir noch zeigen werden, wenn wir im Folgenden einige der einschlägigsten Theorien der Sozialen Arbeit genauer unter die Lupe nehmen werden (Kap. 3), sehen diese Schlussfolgerungen durchaus unterschiedlich aus. Entscheidend für den Moment aber ist: In allen Theorien der Sozialen Arbeit werden Schlussfolgerungen zum Allgemeingültigen gezogen, und damit letztlich zum aus Sicht der Theorie Entscheidenden der Sozialen Arbeit. Damit Theorien der Sozialen Arbeit dies leisten können, muss dort, wo in ihnen überhaupt direkte Hinweise auf so etwas wie „richtiges Handeln in der Sozialen Arbeit“ auftauchen, notwendigerweise auf einer allgemeinen Ebene argumentiert werden.
Aus der Perspektive von PraktikerInnen, die an einem besonderen Problem und dessen Lösung interessiert sind, könnte der zentrale Wert von Theorien der Sozialen Arbeit somit darin liegen, mithilfe dieser Theorien danach fragen zu können, was das Entscheidende an einer praktischen Situation ist. Mit anderen Worten hilft ihnen die Kenntnis einer – bzw. am besten: mehrerer! – Theorie(n) der Sozialen Arbeit dabei herauszufinden, was an der vorliegenden Situation diese eigentlich als eine Situation der Sozialen Arbeit ausweist. Hieraus wiederum lassen sich durchaus ganz konkrete Ableitungen für das dann in der jeweiligen Situation benötigte Wissen treffen. So z.B. Wissen darüber, welche Handlungen, welches Rollenverständnis und welche Organisationsprozesse angemessen wären, wenn man erstens die Situation im Sinne der jeweiligen Theorie verstehen möchte und sich zweitens infolge dessen auch dazu entscheidet, im Sinne der jeweiligen Theorie zu handeln. Ob man das jedoch (beides) möchte, und wie sich im Falle dessen die allgemein in der Theorie formulierten Kriterien „wahrer Sozialer Arbeit“ auf die im Einzelfall wahrgenommene „Praxissituation“ übertragen lassen, kann keiner allgemeinen Theorie der Sozialen Arbeit anheimgestellt werden, sondern bleibt logischerweise eine Aufgabe der konkreten Praxis.

1. Inwieweit unterscheiden sich ethische und/oder fachpolitische Leitlinien für das Handeln von PraktikerInnen innerhalb von Theorien der Sozialen Arbeit von Rezepten für richtiges Handeln in der Sozialen Arbeit?
2. Woran sind Theorien, die im engeren Sinn als Theorien der Sozialen Arbeit bezeichnet werden, maßgeblich interessiert?
3. Inwiefern lassen sich Theorien der Sozialen Arbeit auch als Großtheorien bezeichnen?
4. Wo liegen Nutzen und Grenzen von Theorien der Sozialen Arbeit, wenn es darum geht, Antworten auf eine konkrete praktische Handlungsfrage zu finden?
1.3 Zusammenfassung: Zum Theorieverständnis des vorliegenden Bandes

Das folgende Teilkapitel dient dazu, unsere bisherigen Überlegungen zum Wert einer Beschäftigung mit Theorie innerhalb des Studiums der Sozialen Arbeit zusammenzufassen. Dabei werden wir verdeutlichen, welche Besonderheiten von Theorien der Sozialen Arbeit in einer ersten Annäherung erkennbar sind, und darauf aufbauend herausarbeiten, welchen theoretischen Blick das vorliegende Buch auf Theorien der Sozialen Arbeit richtet. Auch dies erachten wir als notwendig, um unsere Argumentation transparent, und damit zugleich verständlich zu machen, warum die folgenden Kapitel dieses Buches so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind.
Wir haben im Kap. 1.1 dargestellt, dass Theorie und Praxis zwar als logische Gegensätze begriffen werden können, es aber gerade deshalb durchaus einen Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis gibt. Denn Theorie braucht, um überhaupt als Theorie auftreten zu können, immer auch ein Gegenüber, auf das sie beziehbar ist. Während das in vielen anderen Wissenschaften Momente sind, welche als „Empirie“ bezeichnet werden, dienen im Bereich der Sozialen Arbeit oft Momente der „Praxis“ als ein solcher Gegenpol. Für Theorien der Sozialen Arbeit im engeren Sinne gilt das in besonderem Maße.
Das gilt logischerweise auch umgekehrt, also auch für die Rede von der Praxis. Denn – so haben wir ebenfalls in Kap 1.1 herausgearbeitet – ohne Theorie wäre es keiner/m PraktikerIn möglich, sich überhaupt selbst als SozialarbeiterIn oder SozialpädagogIn zu bezeichnen, oder auch nur einfach von einer „Praxiserfahrung in der Sozialen Arbeit“ berichten zu können. An jeder Stelle, an der man das tut, braucht man sowohl eine theoretische Vorstellung von „Praxis“, als auch noch eine – bewusste oder unbewusste – „Theorie der Sozialen Arbeit“, die ein generelles Bild davon liefert, was Soziale Arbeit ist. Denn erst so kann man die konkret gemachte Erfahrung überhaupt als „Soziale Arbeit“ fassen.
Dieser Theoretisierungsprozess ist (wir erinnern noch einmal an die Erkenntnisse des in Kap. 1.1 zitierten Philosophen Charles S. Peirce) notwendig für jedwede Art der Thematisierung einer bestimmten Beobachtung. Theoretisierungsprozesse geschehen also ständig und überall, und zwar gerade auch da, wo von „Praxis“ die Rede ist. Am ausführlichsten, geduldigsten und damit in der Regel auch am gründlichsten werden solche Theoretisierungsprozesse jedoch in wissenschaftlichen Theorien vollzogen.
Es lohnt sich daher aus unserer Sicht gerade auch für praktisch interessierte Studierende und engagierte PraktikerInnen, sich mit wissenschaftlichen Theorien auseinanderzusetzen. Für Theorien der Sozialen Arbeit gilt das in besonderem Maße, da mit ihnen explizit darauf gezielt wird, ein Bild von der Praxis der Sozialen Arbeit zu entwerfen.
Wie wir in Kap. 1.2 deutlich gemacht haben, sollte man daraus jedoch keine Hoffnung ableiten, mithilfe von Theorien der Sozialen Arbeit auf konkrete Handlungsrezepte für einzelne Situationen zu stoßen. Denn diejenigen Theorien, die in der Regel als Theorien der Sozialen Arbeit im engeren Sinne verhandelt werden und somit auch im Rahmen unseres Buches Berücksichtigung finden (Kap. 3), werden zwar durchaus auf konkrete Phänomene hin ausgerichtet, die als „Praxis Sozialer Arbeit“ beschrieben werden. Dies geschieht jedoch nicht, um mithilfe der Theorien dann selbst Lösungen für die beschriebenen Situationen anzubieten, sondern um aus der Beobachtung konkreter Momente Sozialer Arbeit allgemeine Schlussfolgerungen für „den Zusammenhang des Ganzen, seiner Beschreibung, Begründung und Aufklärung“ ziehen zu können (Füssenhäuser/Thiersch 2015, 1743). Das gilt selbst für diejenigen Theorien, deren Interessensfokus auf ein im Großen und Ganzen „richtiges“ Handeln in der Sozialen Arbeit gelegt wird: Auch hier geschieht das in der Regel in Form von Aussagen zu „fachlichem“ oder „professionellem“ Handeln.Auch diese Art von Theorien der Sozialen Arbeit trifft damit nicht systematisch Aussagen zu konkret richtigem Handeln in allen möglichen Situationen, die einem „in der Praxis“ begegnen können. Eher finden sich hier etwa Umschreibungen von grundsätzlichen Haltungen, die dann an seltenen Stellen auch einmal beispielhaft illustriert werden.
Damit liefern Theorien der Sozialen Arbeit bewusst allgemein gehaltene Analysen der Sozialen Arbeit. Will man sie nutzen für konkrete Situationsanalysen in der eigenen Praxis, muss man sie gewissermaßen in Gebrauch nehmen, und dabei konkrete Ableitungen für die eigene Praxisreflexion mehr oder minder selbst vornehmen. Eine solche Eigentätigkeit beim Gebrauch von Theorien bietet dann zugleich die Möglichkeit, sich die Frage zu stellen, ob man die Annahmen der Theorie auf der allgemeinen Ebene überhaupt teilt und als nachvollziehbar empfindet.
Die Annahmen unterschiedlicher Theorien der Sozialen Arbeit zu ihrem Gegenstand ähneln sich teilweise. Sie unterscheiden sich jedoch teilweise auch deutlich voneinander. Denn – um dies noch einmal ins Gedächtnis zu rufen – Theorien der Sozialen Arbeit stehen zu ihrem zentralen Gegenstand, der Sozialen Arbeit, im Grunde in einem ähnlichen Verhältnis wie Studierende der Sozialen Arbeit.

Auf den ersten Blick liegt das Erkenntnisinteresse aller Theorien der Sozialen Arbeit, ähnlich wie bei Studierenden der Sozialen Arbeit, auf ein und demselben – nämlich Sozialer Arbeit. Erst ein differenzierterer Blick lässt deutlich werden, dass dieses Interesse jenseits des gemeinsam genutzten Begriffs auf etwas sehr Unterschiedliches zielen kann. Für einen Nachvollzug von Studierendeninteressen im Studium ist es somit nicht allein entscheidend, dass alle Studierenden denselben Begriff der Sozialen Arbeit benutzen, wenn sie ihr übergreifendes Interesse betiteln. Es kommt vielmehr darauf an nachzuvollziehen, welche konkreten Vorstellungen sich bei unterschiedlichen Studierenden jeweils mit der Nutzung des Begriffs „Soziale Arbeit“ verbinden, und wofür der Begriff somit in ihren Augen jeweils steht. Ähnliches gilt, wenn man ein genaueres Verständnis von Theorien der Sozialen Arbeit erlangen möchte. Auch hier kommt es zunächst auf eine Rekonstruktion des jeweiligen Verständnisses von Sozialer Arbeit an, welches sich in einzelnen Theorien der Sozialen Arbeit findet. Dass sie dabei alle denselben Begriff der Sozialen Arbeit nutzen, ist erst im zweiten Schritt entscheidend, nämlich dann, wenn man vergleichen möchte, wo sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Theorien erkennen lassen, um hierüber das Gesamtbild der Diskussion um Theorien der Sozialen Arbeit besser zu verstehen.
Ein solches Vorgehen ist unseres Erachtens gewinnbringend, da sich Theorien der Sozialen Arbeit noch in einem weiteren Punkt nicht sonderlich von Studierenden der Sozialen Arbeit unterscheiden: So wie jede/r Studierende von Beginn des Studiums an bestimmte Vorannahmen, Ideale, besondere Aufmerksamkeiten und Sozialisationserfahrungen mitbringt und kein „unbeschriebenes Blatt“ ist, was die eigenen Wahrnehmungen angeht, startet auch keine Theorie in ihren Annahmen über Soziale Arbeit bei null. Auch hier wird auf je besonderen Vorannahmen und Idealen aufgebaut, es werden jeweils besondere Aufmerksamkeitsschwerpunkte gesetzt und damit spezifische Perspektiven auf Soziale Arbeit entwickelt.
Theorien der Sozialen Arbeit sind so gesehen alle ähnlich, aber eben auch alle sehr verschieden. Welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede einem in ihrer Beobachtung auffallen, liegt vor allem auch daran, auf welche Weise man sich ein Bild von ihnen macht. Und d.h. genauer: Es kommt darauf an, welche Theorie man in Gebrauch nimmt oder entwirft, um sich ein Bild von Theorien der Sozialen Arbeit zu machen. Damit sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir in eine kurze Gedankenschleife zum theoretischen Blick, den das vorliegende Buch entwirft, einsteigen wollen.
Wir möchten m.a.W. die Gelegenheit nutzen, unseren eigenen Blick auf Theorien der Sozialen Arbeit noch einmal etwas systematischer auszuweisen. Die Begründung dafür lautet, dass die LeserInnen dieser Einführung nicht nur implizit – durch den Gang unserer Argumentation – sondern auch explizit – durch eine Reflexion unserer Argumentation – darauf aufmerksam gemacht werden sollen, welcher Perspektive auf Theorien der Sozialen Arbeit sie sich anvertrauen, wenn sie dieses Buch lesen. Das scheint uns für das weitere Verständnis des vorliegenden Buches hilfreich zu sein, soll die LeserInnen aber zugleich auch offen dazu anregen, die in diesem Buch aufgemachte Perspektive auf Theorien der Sozialen Arbeit als nicht einfach selbstverständlich zu begreifen, sondern kritisch zu hinterfragen.
Damit übertragen wir das, was wir bisher allgemein zum Wechselverhältnis von Theorien und ihren Gegenständen dargestellt haben, auf den Gegenstand des vorliegenden Buches – Theorien der Sozialen Arbeit. Und hier wird etwas deutlich, was auf den ersten Blick verwirrend, auf den zweiten aber nachvollziehbar ist. Es wird deutlich, dass man Theorie benötigt, um sich mit Theorien der Sozialen Arbeit beschäftigen zu können. Denn auf welche Weise man Theorien der Sozialen Arbeit rekonstruiert, entscheidet sich im Wechselspiel zwischen dem Material (hier also den Theorie-Texten, die in die Übersicht einbezogen werden) und der Art und Weise, wie man dieses Material in der Übersicht zugänglich macht.
Im vorliegenden Buch stellt sich dieses Wechselspiel her, indem wir die oben angestellten Überlegungen auf unsere eigene Perspektive hin reflektieren. Damit schließen wir an das breite Programm einer sog. „reflexiven Sozialwissenschaft“ an, das inzwischen in den meisten Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften etabliert ist.

Reflexive Sozialwissenschaft kann als ein Label für im Einzelnen unterschiedlich vorgehende wissenschaftliche Ansätze gesehen werden (Langenohl 2009), deren Gemeinsamkeiten jedoch darin liegen, wie sie ihre eigene Wissenschaftlichkeit gegenüber ihrem Publikum legitimieren. Als bedeutende Wegbereiter reflexiver Sozialwissenschaft kann zum einen der französische Soziologe Pierre Bourdieu gesehen werden (Schultheis 2007), zum anderen sind hier auch WissenschaftsforscherInnen wie z. B. Steve Woolgar (1988) zu nennen. Das Wort „reflexiv“ verweist dabei auf ein zusätzlich gesteigertes Maß an Reflexion, was das Zustandekommen der eigenen Beobachtung und Argumentation als „wissenschaftlich“ angeht. Dies drückt sich z. B. dadurch aus, dass diese Ansätze oftmals Reflexionsschleifen einbauen zu dem, was gerade im Akt des wissenschaftlichen Beobachtens und Aufschreibens passiert, und wie damit einerseits der Blick derjenigen LeserInnen geleitet wird, welche die wissenschaftliche Studie am Ende rezipieren, und wie sich damit andererseits das verändert, was wissenschaftlich beobachtet wird. Anhand des letztgenannten Punktes wird deutlich, dass Ansätze reflexiver Sozialwissenschaft zu guten Teilen auf Erkenntnissen des Konstruktivismus aufbauen.
Konstruktivistische Perspektiven rücken die „Gemachtheit“ von Beobachtungen in den Mittelpunkt. Das heißt, dass mit ihnen davon ausgegangen wird, dass Tatsachen nicht einfach da sind und dann besser oder schlechter, vollständiger oder weniger vollständig beobachtet werden können, sondern dass sich Tatsachen erst im Zuge ihrer Beobachtung konstituieren. Diese Annahme bezieht der Konstruktivismus ausdrücklich auch auf solche Beobachtungen, die als wissenschaftliche Beobachtungen gelten. Wie stark einzelne Ansätze reflexiver Sozialwissenschaft sich zugleich explizit als konstruktivistisch verstehen, variiert allerdings. Das hängt damit zusammen, dass einige dieser Ansätze nach wie vor von einem objektiven Kern derjenigen Dinge, die beobachtet werden, ausgehen, während andere Ansätze auch diesen Kern als gänzlich „durch Beobachtung hergestellt“ betrachten, und zwar zumindest im Sinne einer Mehrdimensionalität des „Kerns der Dinge“, welcher dann je nach Beobachtungsperspektive unterschiedlich aussieht. Die gesamte Auseinandersetzung um diese Fragen von „Existenz“ vs. „Gemachtheit“ von wissenschaftlich beobachteten Sachverhalten bezeichnet die Philosophie als „Universalienstreit“.
Darüber hinaus gehen wir in diesem Buch von folgenden, schon in Kap. 1.1 und Kap. 1.2 skizzierten Vorannahmen aus, um eine Überblicksperspektive auf Theorien der Sozialen Arbeit erarbeiten zu können:
1. Nicht jede Theorie, der man im Studium der Sozialen Arbeit begegnet, ist eine Theorie der Sozialen Arbeit. Theorien der Sozialen Arbeit zielen im Gegensatz zu anderen Theorien wesentlich auf die Darstellung von etwas Allgemeinverbindlichem der Sozialen Arbeit.
2. In ihren jeweiligen Antworten auf die Frage, was Soziale Arbeit ist, kommen unterschiedliche Theorien der Sozialen Arbeit zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. Das gilt auch für die Vorstellung von Praxis der Sozialen Arbeit, denn Theorie- und Praxisvorstellungen zur Sozialen Arbeit stellen sich in einer Theorie der Sozialen Arbeit wechselseitig her. Das heißt, jede Theorie entwickelt zugleich ihre jeweils eigene Vorstellung von Praxis der Sozialen Arbeit.
3. Eine Übersicht zu Theorien der Sozialen Arbeit, die sich an den Ergebnissen der einzelnen Theorien orientiert, bleibt darauf begrenzt, die Unterschiedlichkeit dieser Ergebnisse zusammenfassend zu reproduzieren. Damit kann eine solche Übersicht Informationsverdichtung, aber noch keine systematische Wissensproduktion leisten.
4. Eine zusätzliche Möglichkeit der im engeren Sinn vergleichenden Wissensproduktion besteht, wenn man die Arten und Weisen genauer in den Blick nimmt, wie unterschiedliche Theorien der Sozialen Arbeit zu Antworten auf die Frage danach gelangen, was Soziale Arbeit ist. Ein solcher Ansatz erlaubt es, allen Theorien der Sozialen Arbeit dieselben Fragen zu stellen und damit hinreichend fokussiert Wissen zu Theorien der Sozialen Arbeit aufzubereiten.
Aus den oben benannten Punkten ergibt sich bereits eine Argumentationslinie für den weiteren Aufbau dieses Buches. Man kann daran auch noch einmal erkennen, inwiefern wir im Folgenden nicht „völlig objektiv“ vorgehen. Zugleich ist unser Vorgehen aber eben auch nicht „völlig willkürlich“ oder zufällig. Stattdessen ist es theoriegeleitet – bzw. genauer: reflexiv-theoriegeleitet – und damit zugleich notwendigerweise von Vorannahmen, man könnte sogar sagen: von „Vor-Urteilen“ geprägt (Gadamer 1990). Diese Vor-Urteile ermöglichen es, eine Perspektive zu entwerfen, die im Ergebnis der Einführung zu Wissen über Theorien der Sozialen Arbeit führt, also ein systematischeres Verständnis von Theorien der Sozialen Arbeit ermöglicht.