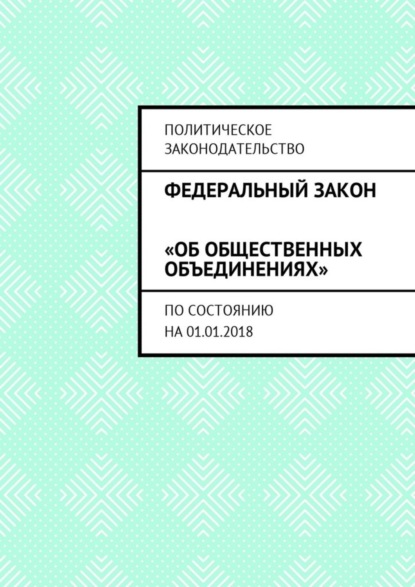Die Familiensaga der Pfäfflings

- -
- 100%
- +
So wurde äußerlich die Ruhe in der Klasse hergestellt, und es war nicht zu bemerken, wie dem einen Schüler das Herz klopfte vor innerer Entrüstung, dass er allein zur Strafe gezogen werden sollte, dem anderen vor Angst darüber, dass sein Betrug an den Tag kommen würde.
Kurz vor elf Uhr verließ Wilhelm auf einen leisen Wink des Professors das Zimmer. Unheimlich still kam es ihm vor auf den sonst so belebten Gängen und auf der breiten Treppe, die nicht für so ein einzelnes Bürschlein berechnet war, sondern für einen Trupp fröhlicher Kameraden. Heute begleitete ihn keiner, den sauern Gang auf die Polizei musste er ganz allein tun. Und nun betrat er das große Gebäude, in dem er ganz fremd war, hielt sein Vorladungsformular in der Hand und las: Erster Stock, Zimmer Nr. 12. Leute gingen hin und her, keiner kümmerte sich um ihn; vor mancher Zimmertüre standen Männer und Frauen und warteten. Nun war er bei Nr. 10, die übernächste Türe musste die richtige sein, Nr. l2. Vor diesem Zimmer stand ein Mann – und das war Herr Pfäffling.
»Vater!« rief Wilhelm, »o Vater!« und in diesem Ausruf klang die ganze Qual, die Angst und die ganze Wonne der Erlösung. Herr Pfäffling fasste ihn bei Hand. »Ich habe mich doch auf eine Viertelstunde los gemacht,« sagte er, »jetzt komm nur schnell herein, dass wir bald fertig werden!«
Im Zimmer Nr. 12 saß ein Polizeiamtmann.
Nach einigen Fragen und Antworten kam die Hauptsache zur Sprache: Wilhelm war angezeigt worden, weil er Herrn Sekretär Floßmann mit Schneeballen getroffen, darnach in frecher Weise gelacht und das Schneeballenwerfen in unmittelbarer Nähe fortgesetzt habe.
»So hat sich's verhalten, nicht wahr?« fragte der Amtmann.
»Getroffen habe ich einen Herrn aus Versehen,« sagte Wilhelm, »aber weiter nichts.« Nun mischte sich Herr Pfäffling ins Gespräch: »Du hast mir erzählt, dass du dich ausdrücklich entschuldigt habest und sofort heimgegangen seiest.« Da lächelte der Amtmann und sagte: »Damit sollte wohl der Vater besänftigt werden, in Wahrheit verhielt sich's aber, nach der Aussage des Herrn Sekretärs und des Schutzmanns ganz anders, und Sie werden begreifen, dass ich diesen mehr Glauben schenke als dem Angeklagten; es liegt auch gar nicht in der Art des Herrn Sekretär Floßmann, einen Jungen zur Anzeige zu bringen, der sich wegen eines Vergehens entschuldigt hat.«
»Ich darf wohl behaupten,« sagte Herr Pfäffling, »dass sowohl Frechheit als Lüge auch nicht im Wesen dieses Kindes liegen. Ich wäre sonst nicht mit ihm gekommen, sondern hätte mich seiner geschämt. Wäre es nicht möglich, den Herrn Sekretär oder den Schutzmann zu sprechen?«
»Gewiss,« sagte der Amtmann, »Herr Sekretär hat seine Kanzlei oben und der Schutzmann Schmidt war eben erst bei mir.« Er rief einen Polizeidiener. »Bitten Sie Herrn Sekretär Floßmann, einen Augenblick zu kommen und rufen Sie den Schutzmann Schmidt herein.«
»Wir machen zwar gewöhnlich nicht so viel Umstände, wenn es sich um solch eine Bubengeschichte handelt,« sagte der Amtmann, »aber wenn Sie es wünschen, können Sie von den beiden selbst hören, wie der Verlauf der Sache war.«
Ein paar Minuten später trat der Sekretär Floßmann und gleich darnach der Schutzmann ein. »Da ist der Junge,« sagte der Amtmann, »der wegen der Schneeballengeschichte aufgeschrieben wurde,« aber ehe der Beamte noch weiter sprechen konnte, fiel ihm Herr Sekretär Floßmann ins Wort, indem er sich an den Schutzmann wandte: »Aber warum haben Sie denn gerade diesen Jungen aufgeschrieben, den einzigen, der sofort aufgehört hat zu werfen, und der sich in aller Form entschuldigt hat, der mir selbst noch den Schnee abgeschüttelt hat?« und indem er auf Wilhelm zuging, sagte er ganz vertraulich zu ihm: »Wir zwei sind in aller Freundschaft auseinandergegangen, nicht wahr, dich wollte ich nicht anzeigen.« Da wandte sich der Amtmann ärgerlich an den Schutzmann: »Haben Sie Ihre Sache wieder einmal so dumm wie möglich gemacht?« Der rechtfertigte sich: »Das ist nicht der Wilhelm Pfäffling, den ich aufgeschrieben habe. Der meinige hat einen dicken Kopf und ein rotes Gesicht. Sag' selbst, habe ich dich aufgeschrieben?«
»Nein, aber es heißt keiner Wilhelm Pfäffling außer mir.«
»Oh,« sagte der Amtmann, »da kommt es auf eine falsche Namensangabe hinaus, das muss ein frecher Kamerad sein. Kannst du dir denken, wer dir den Streich gespielt hat?« fragte er Wilhelm. Der besann sich nicht lange. »Jawohl,« sagte er, »es ist nur ein solcher Gauner in unserer Klasse.«
»Wie heißt er?« Da sah Wilhelm seinen Vater an und sagte zögernd: »Ich kann ihn doch nicht angeben?«
»Nein,« sagte Herr Pfäffling, »du weißt es ja doch nicht gewiss, und deine Menschenkenntnis ist nicht groß.«
»Den Schlingel finde ich schon selbst heraus, den erkenne ich wieder,« sagte der Schutzmann, »ich fasse ihn ab um 12 Uhr, wenn die Schule aus ist.«
Nun wandte sich der Amtmann an Herrn Pfäffling: »Ich bedaure das Versehen,« sagte er, und Wilhelm entließ er mit den Worten: »Du kannst nun gehen, aber halte dich an bessere Kameraden und pass auf mit dem Schneeballenwerfen, in den Straßen ist das verboten, dazu habt ihr euren Schulhof!«
Vater und Sohn verließen miteinander das Polizeigebäude. »O Vater,« rief Wilhelm, sobald sie allein waren, »wie bin ich so froh, dass du gekommen bist! Mir allein hätte der Polizeiamtmann nicht geglaubt.«
»Du hast dich auch nicht ordentlich verteidigt, hast ja nicht einmal erzählt, wie der Verlauf war. Bei uns zu Hause hast du deine Sache viel besser vorgebracht.«
»Mir geht das oft so, Vater, wenn ich spüre, dass man mir doch nicht glauben wird, dann mag ich gar nichts zu meiner Verteidigung sagen. Oft möchte ich etwas erzählen oder erklären, wie es gemeint war, dann denke ich: ihr haltet das doch nur für Schwindel und Ausreden, und dann schweige ich lieber.«
»Ich kenne das, Wilhelm, es kommt daher, weil es so wenig Menschen genau mit der Wahrheit nehmen, dann trauen sie auch den andern keine strenge Wahrhaftigkeit zu. Aber da darf man sich nicht einschüchtern lassen. Wer recht wahrhaftig ist, darf alles sagen und Glauben dafür fordern. Halte du es so, und wird dir etwas angezweifelt, so sage du ruhig zu demjenigen: ›Habe ich dich schon einmal angelogen?‹ Aber freilich musst du sicher sein, dass er darauf ›nein‹ sagt.«
Die Beiden waren inzwischen dem Marktplatz nahe gekommen, wo ihre Wege auseinandergingen.
»War es dir recht ungeschickt, Vater, aus der Probe wegzukommen?« fragte Wilhelm. »Höllisch ungeschickt!« sagte Herr Pfäffling, »ich mochte den Grund nicht angeben, ich sagte nur schnell den Nächstsitzenden etwas von Familienverhältnissen und lief davon; wer weiß, was sie sich gedacht haben. Der junge Lehrer wird mich inzwischen vertreten haben, so gut er es eben versteht.«
»Ich danke dir, Vater,« sagte Wilhelm, als er sich trennte, und ganz gegen die Gewohnheit der Familie Pfäffling griff er rasch nach des Vaters Hand, küsste sie und lief davon.
Als Herr Pfäffling zu der musikalischen Jugend zurückkam, sah er viele freundlich lächelnde Gesichter und dachte sich: Die haben es doch schon erfahren, dass du mit deinem Wilhelm auf der Polizei warst, es bleibt nichts verborgen. »Darf man gratulieren?« fragte ihn leise eine Bekannte, als er nahe an ihr vorbeiging. »Jawohl,« sagte er, »es ist gut vorübergegangen.« Nach ein paar Minuten war er mit vollem Eifer bei der Musik, und Wilhelm in gehobener Stimmung bei seinem griechischen Schriftsteller.
»Dir ist es offenbar gnädig gegangen auf der Polizei,« sagte der Professor nach der Stunde zu Wilhelm.
»Ja, Herr Professor, es war eine Verwechslung, ich war gar nicht aufgeschrieben worden, ein anderer hat meinen Namen statt seinem angegeben.«
»Wer? Einer aus meiner Klasse?«
»Wer das war, will der Schutzmann erst herausbringen,« antwortete Wilhelm.
Der Professor hatte kaum das Schulzimmer verlassen, als alle Kameraden sich um Wilhelm drängten und näheres erfahren wollten, auch Baumann war unter ihnen. Der eine, der schon am Morgen behauptet hatte, dass Baumann aufgeschrieben worden sei, sagte ihm frei ins Gesicht: »Du hast den falschen Namen angegeben.« Da versuchte er nimmer zu leugnen, sondern fing an, sich zu entschuldigen: »Dem Pfäffling hat das doch nichts geschadet, für mich wäre es viel schlimmer gewesen. Du musst mir's nicht übel nehmen, Pfäffling, ich habe ja vorher gewusst, dass dir das nichts macht.«
»So? frage einmal meinen Vater, ob ihm so etwas nichts macht?« rief Wilhelm, »du bist ein Tropf, ein Lügner, das sage ich dir; aber dem Polizeiamtmann habe ich dich nicht verraten. Wenn dich der Schutzmann nicht wieder erkennt, dann kann es ja wohl sein, dass du dich durchgeschwindelt hast.« Nun sprang einer der Kameraden die Treppe hinunter, um zu sehen, ob ein Polizeidiener unten stehe. Richtig war es so. Da wurde verabredet, Baumann in die Mitte zu nehmen, einige Größere um ihn herum und dann in einem dichten Trupp die Treppe hinunter und bis um die nächste Straßenecke zu rennen. So geschah es. Die meisten Klassen des Gymnasiums hatten sich schon entleert; der Schutzmann stand lauernd am Tor. Da, plötzlich tauchte ein Trupp von Knaben auf und schoß an ihm vorbei, in solcher Geschwindigkeit, dass er auch nicht ein Gesicht erkannt hatte. Ärgerlich ging er seiner Wege, aber hatte er den Übeltäter auch noch nicht fassen können, das war ihm jetzt sicher, dass er zu dieser Klasse gehörte, und er sollte ihm nicht entgehen.
Wie war für Frau Pfäffling dieser Vormittag daheim so lang und so peinlich! Immer musste sie an Wilhelm denken. ›Er hat gewiss nichts getan, was strafwürdig ist,‹ sagte sie sich und dann fragte sie sich wieder: ›warum ist er dann vorgeladen?‹ Gestern hatte sie in fröhlicher Stimmung alles vorbereitet für das Weihnachtsgebäck, heute hätte sie es am liebsten ganz beiseite gestellt, alle Lust dazu war weg. Sie mühte sich sonst so gern den ganzen Vormittag im Haushalt und dachte dabei: ›Wenn Mann und Kinder heimkommen von fleißiger Arbeit, sollen sie es zu Hause gemütlich finden.‹ Aber wenn die Kinder nicht ihre Schuldigkeit taten, wenn sie draußen Unfug trieben, sollte man dann daheim Zeit und Geld für sie verwenden?
In dieser Stimmung sah Frau Pfäffling diesen Morgen manches, was ihr nicht gefiel. Im Bubenzimmer lagen Hausschuhe, nur so leichthin unter das Bett geschleudert; hässlich niedergetreten waren sie auch, wie oft hatte sie das schon verboten! Im Wohnzimmer lag ein Brief, den hätten die Kinder mit zum Schalter nehmen sollen, alle sechs hatten sie ihn sehen müssen, alle sechs hatten ihn liegen lassen, sogar Marianne, die doch als Mädchen allmählich ein wenig selbst daran denken sollten, ob nichts zu besorgen wäre! Das waren lauter Pflichtversäumnisse, und wer daheim die Hausgesetze nicht beachtete, der konnte leicht auch draußen gegen die Ordnung verstoßen. Aber freilich müsste die Mutter ihre Kinder fester dazu anhalten, strenger erziehen, als sie es tat! Sie selbst war schuld.
Elschen, die nicht wusste oder nimmer daran dachte, was die Mutter heute bedrückte, kam in der fröhlichsten Weihnachtsstimmung herbeigesprungen. Walburg hatte ihr die Teigschüssel ausscharren lassen. »Mutter,« rief die Kleine, »die Backröhre ist schon geheizt!« Aber die Mutter hatte heute einen unglückseligen Blick. An dem ganzen kleinen Liebling sah sie nichts als drei Streifen, Spuren von Teig an der Schürze.
»Else, dahin hast du deine Finger gewischt,« sagte sie mit ungewohnter Strenge, »gestern erst habe ich dir gesagt, du sollst deine Hände waschen, und nicht an die Schürze wischen,« und sie patschte fest auf die kleinen Hände. Das Kind zog leise weinend ab, und die Mutter sagte sich vorwurfsvoll: ›Deine Kinder sind alle unfolgsam!‹ Darnach ging sie aber doch zum Backen in die Küche, das angefangene musste trotz allem vollendet werden. Sie wollte den Schlüssel zum Küchenschrank mit hinausnehmen, fand ihn nicht gleich und dachte bekümmert: ›Wo die Hausfrau selbst ihre Ordnung nicht einhält, muss freilich die ganze Wirtschaft herunterkommen!‹ In dieser schwarzsichtigen Stimmung vergingen ihr langsam die Stunden, und gegen Mittag sah sie in ängstlicher Spannung nach den Kindern aus. Diese hatten sich alle auf dem Heimweg zusammengefunden und in der Frühlingsstraße holte auch Herr Pfäffling sie ein. Die Losung war nun: »Nur schnell heim zur Mutter, sie allein ist noch in Angst, hat keine Ahnung, wie gut sich alles gelöst hat. Wie wird sie sorgen und warten, wie wird sie sich freuen!«
Aber nicht nur Frau Pfäffling passte auf die eilig Heimkehrenden, auch Frau Hartwig sah heute Mittag nach ihnen aus, freilich aus einem ganz andern Grund. Sie hatte diesen Morgen an die Haustüre einen großen Bogen Papier genagelt, auf dem mit handgroßen roten Buchstaben geschrieben stand:
Man bittet die Türe zu schließen!
Darüber lachte ihr Mann sie aus und versicherte, es würde gar nichts helfen, die Pfäfflinge würden die Türe offen stehen lassen.
Die Hausfrau nahm ihre Mietleute in Schutz. »Sie sind viel ordentlicher, als du denkst. Wilhelm und Otto sind ja ein wenig flüchtig, aber Karl ist immer aufmerksam und auch die Mädchen sind manierlich; der kleine Frieder sogar wird zumachen, wenn er hört, dass es mich sonst friert. Du wirst sehen, die Haustüre wird geschlossen.«
Um das zu beobachten stand nun die Hausfrau am Fenster, sah wie die Familie Pfäffling sieben Mann hoch heim kam – eifriger sprechend als sonst, hörte sie die Treppe hinauf gehen – noch flinker als gewöhnlich, ging dann hinaus, um nachzusehen und fand die Haustüre offen stehend, so weit sie nur aufging.
Kopfschüttelnd schloss sie selbst die Türe. Aber sie verlor nicht den guten Glauben an ihre Mietleute. Sie hatte ihnen ja wohl angemerkt, dass heute etwas besonderes los war.
Im Zimmer fragte Herr Hartwig: »Nun, wer hat denn zugemacht?« Etwas kleinlaut erwiderte sie: »Zugemacht habe ich.«
Droben herrschte nach überstandener Angst große Freude; auch Frau Pfäffling war es wieder leicht ums Herz, glücklich und dankbar saß die ganze Familie am Essen. Aber doch – zwischen Suppe und Fleisch – sagte die Mutter: »Marianne, warum habt ihr den Brief nicht in den Schalter geworfen?«
»Vergessen!«
»So geht jetzt und besorgt ihn.«
»Aber doch nach dem Essen?« fragte fast einstimmig der Kinderchor.
»Nein, nein, eben zwischen hinein, damit ihr es merkt. Ich kann euch nicht helfen, ich hätte gar kein gutes Gewissen, wenn ich es nicht verlangte.« Da widersprach niemand mehr, die Mutter konnte man sich nicht mit schlechtem Gewissen vorstellen. Die Mädchen gingen mit dem Brief, Herr Pfäffling sah seine Frau verwundert an.
Sie ging nach Tisch mit ihm in sein Zimmer. Da sagte sie ihm, wie schwer es ihr den ganzen Vormittag zumute gewesen sei, und es kamen ihr fast jetzt noch die Tränen. Sie sprachen lange miteinander, dann kehrte Herr Pfäffling in das Wohnzimmer zurück, wo die Großen noch beisammen waren.
»Hört, ich möchte euch dreierlei sagen: Erstens: sorgt jetzt, dass vor Weihnachten nichts mehr vorkommt, gar nichts mehr, denn bis man weiß, wie die Sachen hinausgehen, sind sie doch recht unangenehm, besonders für die Mutter. Zweitens: Sagt dem Baumann: er solle sich bei Herrn Sekretär Floßmann entschuldigen, sonst werde es schlimm für ihn ausgehen. Drittens: Walburg soll eine Tasse Kaffee für die Mutter machen, es wird ihr gut tun, oder zwei Tassen.«
Einer von Herrn Pfäfflings guten Ratschlägen konnte nicht ausgeführt werden, denn Wilhelm Baumann wurde noch an diesem Nachmittag aus der Schule weg und auf die Polizei geholt und war von da an aus dem Gymnasium ausgewiesen.
Am Abend überbrachte ein Dienstmädchen einen schönen Blumenstock – eine Musikschülerin ließ Frau Pfäffling gratulieren.
»Ich werde morgen hinkommen und mich bedanken,« ließ Herr Pfäffling sagen.
Ja, es gibt allerlei Freuden, zu denen man gratulieren kann! Warum nicht auch, wenn ein unschuldig Verklagter freigesprochen wird? Oder war etwas anderes gemeint?
6. Kapitel Am kürzesten Tag.
Es war der 21. Dezember, der kürzeste Tag des Jahres. Um dieselbe Tageszeit, wo im Hochsommer die Sonne schon seit fünf Stunden am Himmel steht, saß man heute noch bei der Lampe am Frühstückstisch, und als diese endlich ausgeblasen wurde, war es noch trüb und dämmerig in den Häusern. Allmählich aber hellte es sich auf und die Sonne, wenn sie gleich tief unten am Horizont stand, sandte doch ihre schrägen Strahlen den Menschenkindern, die heute so besonders geschäftig durcheinander wimmelten. Es war ja der letzte Samstag vor Weihnachten, zugleich der Thomastag, ein Feiertag für die Schuljugend. Jedermann wollte die wenigen hellen Stunden benützen, um Einkäufe zu machen. Wieviel Gänse und Hasen wurden da als Festbraten heimgeholt und wieviel Christbäume! Auf den Plätzen der Stadt standen sie ausgestellt, die Fichten und Tannen, von den kleinsten bis zu den großen stattlichen, die bestimmt waren, Kirchen oder Säle zu beleuchten.
Mitten zwischen diesen Bäumen, von ihrem weihnachtlichen Duft und Anblick ganz hingenommen und im Anschauen versunken, stand unser kleiner Frieder. Er hatte für den Vater etwas in der Musikalienhandlung besorgt, kam nun heimwärts über den Christbaummarkt und konnte sich nicht trennen. Nun stand er vor einem Bäumchen, nicht größer als er selbst, saftig grün und buschig. Sie mochten vielleicht gleich alt sein, dieser Bub und dies Bäumchen und sahen beide so rundlich und kindlich aus. Sie standen da, vom selben Sonnenstrahl beleuchtet und wie wenn sie zusammen gehörten, so dicht hielt sich Frieder zum Baum.
»Du! dich meine ich, hörst du denn gar nichts; so wirst du nicht viel verdienen!« sagte plötzlich eine raue Stimme, und eine schwere Hand legte sich von hinten auf seine Schulter. Frieder erwachte wie aus einem Traum, wandte sich und sah sich zwei Frauen gegenüber. Die ihn angerufen hatte, war eine große, derbe Person, eine Verkäuferin. Die andere eine Dame mit Pelz und Schleier. »Pack an, Kleiner, du sollst der Dame den Baum heimtragen, du weißt doch die Luisenstraße?« sagte die Frau und legte ihm den Baum über die Schulter.
»Ist der Junge nicht zu klein, um den Baum so weit zu tragen?« fragte die Dame.
»O bewahre,« meinte die Händlerin, »der hat schon ganz andere Bäume geschleppt, sagen Sie ihm nur die Adresse genau, wenn Sie nicht mit ihm heim gehen.« »Luisenstraße 43 zu Frau Dr. Heller,« sagte die Dame. »Sieh, auf diesem Papier ist es auch aufgeschrieben. Halte dich nur nicht auf, dass dich's nicht in die Hände friert.« Da Frieder immer noch unbeweglich stand, gab ihm die Verkäuferin einen kleinen Anstoß in der Richtung, die er einzuschlagen hatte.
Frieder, den Baum mit der einen Hand haltend, den Papierzettel in der andern, trabte der Luisenstraße zu. Er hatte so eine dunkle Ahnung, dass er mehr aus Missverständnis zu diesem Auftrag gekommen war, er wusste es aber nicht gewiss. Die Damen konnten die Bäume nicht selbst tragen, so mussten eben die Buben helfen. Er sah manche mit Christbäumen laufen, freilich meist größere. Er war eigentlich stolz, dass man ihm einen Christbaum anvertraut hatte. Wenn ihm jetzt nur die Brüder begegnet wären oder gar der Vater!
Wie die Zweige ihn so komisch am Hals kitzelten, wie ihm der Duft in die Nase stieg und wie harzig die Hand wurde! Allmählich drückte der Baum, obwohl er nicht groß war, unbarmherzig auf die Schulter, man musste ihn oft von der einen auf die andere legen, und bei solch einem Wechsel entglitt ihm das Papierchen mit der Adresse und flatterte zu Boden, ohne dass die steife, von der Kälte erstarrte Hand es empfunden hätte. Nun schmerzten ihn die beiden Schultern, er trug den Baum frei mit beiden Händen. Aber da wurde Frieder hart angefahren von einem Mann, der ihm entgegen kam: »Du, du stichst ja den Menschen die Augen aus, halte doch deinen Baum hinter dich, so!« und der Vorübergehende schob ihm den Baum unter den Arm. Nach kürzester Zeit kam von hinten eine Stimme: »Du, Kleiner, du kehrst ja die Straße mit deinem Christbaum, halte doch deinen Baum hoch!« Ach, das war eine schwierige Sache! Aber nun war auch die Luisenstraße glücklich erreicht. Freilich, die Adresse war abhanden gekommen, aber Frieder hatte sich das wichtigste gemerkt, Nr. 42 oder 43 und im zweiten Stock und bei einer Frau Doktor, das musste nicht schwer zu finden sein. In Nr. 42a wollte niemand etwas von dem Baum wissen, aber in Nr. 42b bekam Frieder guten Bescheid, das Dienstmädchen wusste es ganz gewiss, der Baum gehörte nach Nr. 47, die Dame war zugleich mit ihr auf dem Markt gewesen und hatte einen Baum gekauft. Also nach Nr. 47. Als man ihm dort seinen Baum wieder nicht abnehmen wollte, kamen ihm die Tränen, und eine mitleidige Frau hieß ihn sich ein wenig auf die Treppe setzen, um auszuruhen.
»In der Luisenstraße wohnt nur ein Doktor,« sagte sie, »und das ist Dr. Weber in Nr. 24, bei dem musst du fragen.« Unser Frieder hätte nun lieber in Nr. 43 angefragt, denn er meinte sich zu erinnern, das sei die richtige Nummer, aber Frieder traute immer allen Leuten mehr zu als sich selbst, und so folgte er auch jetzt wieder dem Rat, ging an Nr. 43 vorbei bis an Nr. 24 und hörte dort von dem Dienstmädchen der Frau Dr. Weber, sie hätten längst einen Baum und einen viel schöneren und größeren. Jetzt aber tropften ihm die dicken Tränen herunter, und als er wieder auf der Straße stand, wurde ihm auf einmal ganz klar, wo er jetzt hingehen wollte – heim zur Mutter. Es musste ja schon spät sein, vielleicht gar schon Essenszeit. Kam er da nicht heim, so hatte die Mutter Angst, und der Vater hatte ja gesagt, es dürfe nichts, gar nichts mehr vorkommen vor Weihnachten. Also nur schnell, schnell heim!
Und es war wirklich höchste Zeit.
Niemand hatte bis jetzt Frieders langes Ausbleiben bemerkt, als nun aber Marie und Anne anfingen, den Tisch zu decken, sagte Elschen: »Frieder hat versprochen, mit mir zu spielen, und nun ist er den ganzen Vormittag weggeblieben!«
»Er ist gewiss schon längst bei den Brüdern, im Hof, auf der Schleife. Sieh einmal nach ihm,« sagten die Schwestern.
Aber Frieder war verschollen und die Geschwister fingen an, sich zu ängstigen, nicht sowohl für den kleinen Bruder – was sollte dem zugestoßen sein – , aber wenn er nicht zu Mittag käme, würden sich die Eltern sorgen und darüber ärgern, dass doch wieder etwas vorgekommen sei. »Er wird doch kommen bis zum Essen,« sagten sie zueinander und, als nun die Mutter ins Zimmer trat, sprachen sie von allerlei, nur nicht von Frieder. Elschen stand an der Treppe, nun kam der Vater heim, fröhlich und guter Dinge und fragte gleich: »Ist das Essen schon fertig?«
»Es ist noch nicht halb ein Uhr,« entgegnete Karl, der die Frage gehört hatte. »Es wird gleich schlagen,« meinte der Vater, ging aber doch noch in sein Zimmer. Im Vorplatz berieten leise die Geschwister: »Wenn man nur das Essen ein wenig verzögern könnte,« sagte Karl.
»Das will ich machen,« flüsterte Marie, ging in die Küche, zog Walburg zu sich und rief ihr dann ins Ohr: »Frieder ist noch nicht daheim, der Vater wird so zanken, und die Mutter wird Angst haben, kannst du nicht machen, dass man später isst?« Walburg nickte freundlich, ging an den Herd, deckte ihre Töpfe auf und sagte dann: »Du kannst der Mutter sagen, den Linsen täte es gut, wenn sie noch eine Weile kochen dürften.« Da sprang Marie befriedigt hinaus, Walburgs Ausspruch ging von Mund zu Mund, und bis es der Mutter zu Ohren kam, waren die Linsen ganz hart.
»So?« sagte sie verwundert, »mir kamen sie weich vor, aber wir können ja noch ein wenig mit dem Essen warten.«
»Ja, harte Linsen sind nicht gut, sind ganz schlecht,« sagten die Kinder.
So vergingen fünf Minuten. Inzwischen lief unser Frieder, so schnell er es nur mit seinem Baum vermochte. Jetzt trabte er die Treppe herauf, und bei seinem Klingeln eilten alle herbei, um aufzumachen. Frau Pfäffling merkte jetzt, dass etwas nicht in Ordnung war und ging auch hinaus. Da stand Frieder ganz außer Atem, mit glühenden Backen, den Christbaum auf der Schulter und fragte ängstlich: »Isst man schon?«
Als er aber hörte, dass die Mutter ihn nicht vermisst hatte, und sah, wie man seinen Baum anstaunte und die Mutter so freundlich sagte: »Stell ihn nur ab, du glühst ja ganz,« da wurde ihm wieder leicht ums Herz. Sie meinten alle, der Christbaum gehöre Frieder. »Nein, nein,« sagte dieser, »ich muss ihn einer Frau bringen, ich weiß nur nimmer, wie sie heißt und wo sie wohnt.« Da lachten sie ihn aus und wollten alles genau hören, auch Herr Pfäffling war hinzu gekommen und hörte von Frieders Irrfahrten, nahm ihn bei der Hand und sagte: »Nun komm nur zu Tisch, du kleines Dummerle, du!«