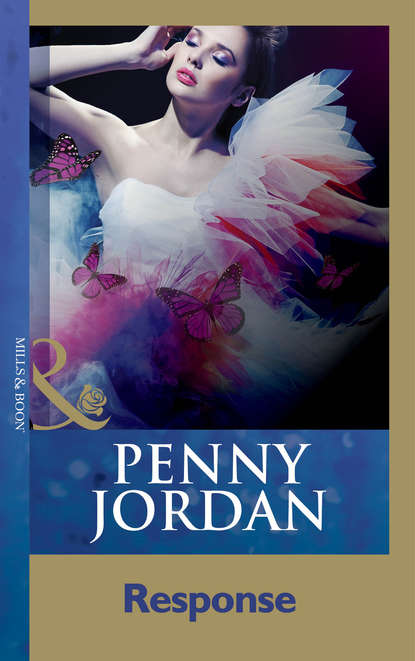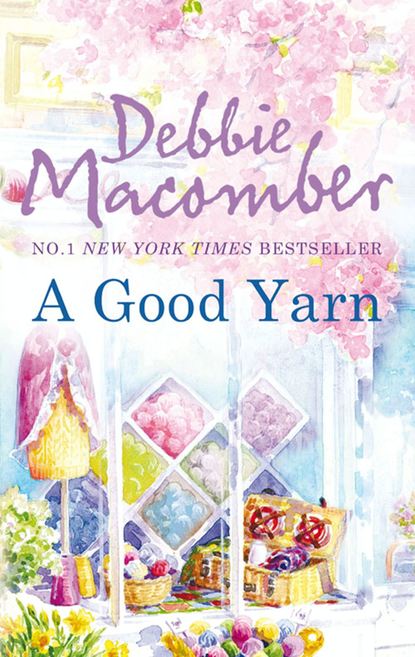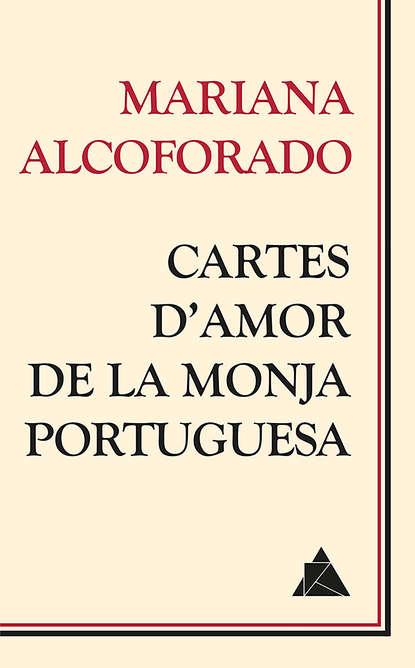Die Familiensaga der Pfäfflings

- -
- 100%
- +
Die Linsen waren nun plötzlich weich, und wie es Frieder schmeckte, lässt sich denken.
Beim Mittagessen wurde beraten, wie man den Christbaum zu seiner rechtmäßigen Besitzerin bringen könne. »Einer von euch Großen muss mit Frieder gehen, ihm helfen den Baum tragen,« sagte Frau Pfäffling.
»Aber wir Lateinschüler können doch nicht in der Luisenstraße von Haus zu Haus laufen, wie arme Buben, die die Christbäume austragen,« entgegnete Karl.
»Wenn mir da z.B. Rudolf Meier begegnete,« sagte Otto, »vor dem würde ich mich schämen.«
»So, so,« sagte Herr Pfäffling, »seid ihr zu vornehm dazu? Dann muss wohl ich meinen Kleinen begleiten,« und er nahm den Baum, der in der Ecke stand, hob ihn frei hinaus, dass er die Decke streifte und sagte spassend: »So werde ich durch die Luisenstraße ziehen, eine Schelle nehmen und ausrufen: ›Wem der Baum gehört, der soll sich melden.‹«
»Ich denke doch,« sagte Frau Pfäffling, »einer von unseren dreien wird so gescheit sein und sich nicht darum bekümmern, wenn auch je ein Kamerad denken sollte, dass er für andere Leute Gänge macht.« Sie schwiegen aber. Da setzte Herr Pfäffling den Baum wieder ab und sagte sehr ernst: »Kinder, fangt nur das gar nicht an, dass ihr meint: dies oder jenes passt sich nicht, das könnten die Kameraden schlecht auslegen. Mit solchen kleinlichen Bedenken kommt man schwer durchs Leben, fühlt sich immer gebunden und hängt schließlich von jedem Rudolf Meier ab.«
Nach dem Essen wurde Herr Hartwig um das Adressbuch gebeten und mit Hilfe dessen und Frieders Erinnerung war bald festgestellt, dass der Baum in die Luisenstraße Nr. 43 zu Frau Dr. Heller gehörte.
Die drei großen Brüder standen beisammen und berieten. »Ich mache mir nichts daraus, den Baum zu tragen,« sagte Wilhelm, »ich hätte gar nicht gedacht, dass es dumm aussieht, wenn ihr es nicht gesagt hättet.«
»Aber wenn du hinkommst, musst du dich darauf gefasst machen, dass man dir ein Trinkgeld gibt,« sagte Karl.
»Um so besser, wenn's nur recht groß ist, ich habe ohnedies keinen Pfennig mehr.«
Die Beratung wurde unterbrochen durch die Mutter, die mit Frieder ins Zimmer kam und sagte: »Die Dame wird gar nicht begreifen, wo ihr Baum so lang bleibt, tragt ihn jetzt nur gleich fort. Otto, du gehst mit, deinem alten Mantel schadet es am wenigsten, wenn der Baum wetzt.«
Diesem bestimmten Befehl gegenüber gab es keinen Widerspruch mehr. Otto musste sich bequemen, Frieder zu begleiten.
Sie gingen nebeneinander und waren bis an die Luisenstraße gekommen, als Otto plötzlich seinem Frieder den Baum auf die Schulter legte und sagte: »Da vorn kommen ein paar aus meiner Klasse, die lachen mich aus, wenn sie meinen, ich müsse den Dienstmann machen. Das letzte Stück kannst du doch den Baum selbst tragen? Und kannst dich auch selbst entschuldigen, nicht?«
»Gut kann ich,« sagte Frieder und ging allein seines Weges. Wie einfach war das nun. Am Glockenzug von Nr. 43 stand angeschrieben: »Dr. Heller«, das stimmte alles ganz gut mit dem Adressbuch und oben im zweiten Stock stand noch einmal der Name. Diesmal war Frieder an der rechten Türe.
Otto hatte sich inzwischen seinen Kameraden angeschlossen und war ein wenig mit ihnen herumgeschlendert, denn er wollte nicht früher als Frieder nach Hause kommen. Als er sich endlich entschloss, heim zu gehen, war es ihm nicht behaglich zumute; es reute ihn doch, dass er den Kleinen zuletzt noch im Stich gelassen hatte. In der Frühlingsstraße wollte er mit dem Bruder wieder zusammentreffen. Er wartete eine Weile vergeblich auf ihn, dann ging ihm die Geduld aus, vermutlich war Frieder schon längst daheim. Er hoffte ihn oben zu finden, aber es war nicht so, das konnte er gleich daran merken, dass er von allen Seiten gefragt wurde: wie es mit dem Baum gegangen sei? Nun musste er freilich erzählen, dass er nur bis in die Nähe des Hauses Nr. 43 den Baum getragen, und dann mit einigen Freunden umgekehrt sei. Aber nun hörte man auch schon wieder jemand vor der Glastüre, das konnte Frieder sein, und dann war ja die Sache in Ordnung. Sie machten auf: da stand der kleine Unglücksmensch und hatte wieder seinen Christbaum im Arm! Sie trauten ihren Augen kaum. »Ja Frieder, hast du denn die Wohnung nicht gefunden?« riefen sie fast alle zugleich. Da zuckte es um seinen Mund, er würgte an den Tränen, die kommen wollten, und presste hervor: »Neunmal geklingelt, niemand zu Haus!« Sie waren nun alle voll Mitleid, aber sie konnten auch nicht verstehen, warum er nicht oben oder unten bei anderen Hausbewohnern angefragt hätte. Daran hatte er eben gar nicht gedacht. »Deshalb gibt man solch einem kleinen Dummerle einen größeren Bruder mit,« sagte Frau Pfäffling, »aber wenn der freilich so treulos ist und vorher umkehrt, dann ist der Kleine schlecht beraten.«
»Jetzt wird der Sache ein Ende gemacht,« rief Wilhelm, »ich gehe mit dem Baum und das dürft ihr mir glauben, ich bringe ihn nicht mehr zurück,« und flink fasste er den Christbaum, der freilich schon ein wenig von seiner Schönheit eingebüßt hatte, und sprang leichtfüßig davon.
In der Luisenstraße Nr. 43 wurde ihm aufs erste Klingeln aufgemacht und sofort rief das Dienstmädchen: »Frau Doktor, jetzt kommt der Baum doch noch!« Eine lebhafte junge Frau eilte herbei und rief Wilhelm an: »Wo bist du denn so lang geblieben, Kleiner? Aber nein, du bist's ja gar nicht, dir habe ich keinen Baum zu tragen gegeben, der gehört nicht mir.«
Wilhelm erzählte von den Wanderungen, die der Baum mit verschiedenen jungen Pfäfflingen gemacht hatte.
»Der Kleine dauert mich,« sagte die junge Frau. »Das zweite Mal, als er kam, war ich wohl mit meinem Mädchen wieder auf dem Markt, ich habe nämlich nicht gedacht, dass er noch kommt, und habe einen andern geholt, ich brauche ihn schon heute abend zu einer kleinen Gesellschaft, da konnte ich nicht warten. Was mache ich nun mit diesem Baum? Habt ihr wohl schon einen zu Haus? Ich würde euch den gern schenken.«
»Wir haben noch keinen,« sagte Wilhelm.
»Also, das ist ja schön, dann nimm ihn nur wieder mit, und dem netten kleinen Dicken, der so viel Not gehabt hat, möchte ich noch einen Lebkuchen schicken, den bringst du ihm, nicht wahr?«
Auch dazu war Wilhelm bereit, und kurz nachher rannte er vergnügt mit seinem Baum heimwärts.
Der kurze Dezembernachmittag war schon zu Ende und die Lichter angezündet, als Wilhelm heim kam. Die Schwestern, welche die Ganglampe geraubt hatten, kamen eilig mit derselben herbei, als Wilhelm klingelte, und ließen sie vor Schreck fast aus der Hand fallen, als sie den Baum sahen. »Der Baum kommt wieder!« schrien die Mädchen ins Zimmer. »Unmöglich!« rief die Mutter. »Ja doch,« sagte Karl, »der Baum, der unglückselige Baum!« »Gelt,« rief Frieder, »es wird nicht aufgemacht, wenn man noch so oft klingelt!«
Aber Wilhelm lachte, zog vergnügt den Lebkuchen aus der Tasche, und gab ihn Frieder: »Der ist für dich von deiner Frau Dr. Heller, und der Baum, Mutter, der gehört uns, ganz umsonst!« Als Herr Pfäffling heim kam, ergötzte er sich an der Kinder Erzählung von dem Christbaum, aber er merkte, dass es Otto nicht recht wohl war bei der Sache, und wollte sie eben deshalb genauer hören. »Also so hat sich's verhalten,« sagte er schließlich, »vor dem Lachen der Kameraden hast du dich so gefürchtet, dass du den Bruder und den Baum im Stich gelassen hast? Dann heiße ich dich einen Feigling!«
Weiter wurde nichts mehr über die Sache gesprochen, aber dies eine Wort »Feigling«, vom Vater ausgesprochen, vor der ganzen Familie, das brannte und schmerzte und war nicht einen Augenblick an diesem Abend zu vergessen. Es war auch am nächsten Morgen, an dem vierten Adventssonntag, Ottos erster Gedanke. Es trieb ihn um, er konnte dem Vater nicht mehr unbefangen ins Gesicht sehen. Da trachtete er, mit der Mutter allein zu sprechen, und sie merkte es, dass er ihr nachging, und ließ sich allein finden, in dem Bubenzimmer. »Mutter,« sagte er, »ich kann gar nicht vergessen, was der Vater zu mir gesagt hat. Soll ich ihn um Entschuldigung bitten? Was hilft es aber? Er hält mich doch für feig.«
»Ja, Otto, er muss dich dafür halten, denn du bist es gewesen und zwar schon manchmal in dieser Art. Immer abhängig davon, wie die anderen über dich urteilen. Da hilft freilich keine Entschuldigung, da hilft nur ankämpfen gegen die Feigheit, Beweise liefern, dass du auch tapfer sein kannst.«
Am Montag nachmittag, als die Kinder alle von der Schule zurückkehrten, fehlte Otto. Er kam eine ganze Stunde später heim und dann suchte er zuerst den Vater in dessen Zimmer auf. Herr Pfäffling sah von seinen Musikalien auf. »Willst du etwas?«
»Ja, dich bitten, Vater, dass du das Wort zurücknimmst. Du weißt schon welches. Ich bin deswegen heute nachmittag lang auf dem Christbaummarkt gestanden und habe dann für jemand einen Baum heimgetragen. Drei von meiner Klasse haben es gesehen. Und da sind die 20 Pfennig Trinkgeld, die ich bekommen habe.« Da sah Herr Pfäffling mit fröhlichem, warmem Blick auf seinen Jungen und sagte: »Es gibt allerlei Heldentum, das war auch eines; nein, Kind, du bist doch kein Feigling!«
7. Kapitel Immer noch nicht Weihnachten.
Der letzte Schultag vor Weihnachten war gekommen. Wer sich von der Familie Pfäffling am meisten freute auf den Schulschluss, das war gerade das einzige Glied derselben, das noch nicht zur Schule ging, das Elschen. Ihr war die Schule die alte Feindin, die ihr, solange sie zurückdenken konnte, alle Geschwister entzog, die unbarmherzig die schönsten Spiele unterbrach, die ihre dunkeln Schatten in Gestalt von Aufgaben über die ganzen Abende warf und die auch heute schuld war, dass die Geschwister, statt von Weihnachten, nur von den Schulzeugnissen redeten, die sie bekommen würden.
Sie saßen jetzt beim Frühstück, aber es wurde hastig eingenommen, die Schulbücher lagen schon bereit, und gar nichts deutete darauf hin, dass morgen der heilige Abend sein sollte. Die Kleine wurde ganz ungeduldig und missmutig. »Vater,« sagte sie aus dieser Stimmung heraus, »gibt es gar kein Land auf der ganzen Welt, wo keine Schule ist?«
»O doch,« antwortete Herr Pfäffling, »in der Wüste Sahara zum Beispiel ist zurzeit noch keine eröffnet.«
»Da musst du Musiklehrer werden, Vater,« rief die Kleine ganz energisch. Aber da alle nur lachten, sogar Frieder, merkte sie, dass der Vorschlag nichts taugte, und sie sah wieder, dass gegen die Schule ein für allemal nichts zu machen war.
Heute sollte sie das besonders bitter empfinden. Als sie nach der letzten Schulstunde den großen Brüdern fröhlich entgegenkam, wurde sie nur so beiseite geschoben; die Drei waren in eifrigem, aber leise geführtem Gespräch und verschwanden miteinander in ihrem Schlafzimmer. Es waren nämlich die Zeugnisse ausgeteilt worden, und da zeigte es sich, dass Wilhelm in der Mathematik die Note »4« bekommen hatte, die geringste Note, die gegeben wurde. Das war noch nie dagewesen, die Zahl 4 war bisher in keinem Zeugnisheft der jungen Pfäfflinge vorgekommen. »So dumm sieht der Vierer aus,« sagte Wilhelm, »was hilft es mich, dass ein paar Zweier sind, wo das letzte Mal Dreier waren, der Vater sieht doch auf den ersten Blick den Vierer.«
»Ja,« sagte Karl, »gerade so wie unser Professor auch in der schönsten Reinschrift immer nur die eine Stelle sieht, wo etwas korrigiert ist.«
»Wenn wir es nur einrichten könnten, dass wir die Zeugnishefte erst nach Weihnachten zeigen müssten. Meint ihr, das geht?«
»Nein,« sagte Karl, »man hat sonst jeden Tag Angst, dass der Vater darnach fragt. Aber es kann freilich die Freude verderben; hättest du es nicht wenigstens zu einem schlechten Dreier bringen können?«
Wilhelm blieb darauf die Antwort schuldig. Die Schwestern waren inzwischen auch mit ihren Zeugnissen heimgekommen und suchten die Brüder auf. Marie warf nur einen Blick auf die Gruppe, dann sagte sie: »Gelt, ihr seid schlecht weggekommen?« und da keine Antwort erfolgte, fuhr sie fort: »Unsere Zeugnisse sind gut, besser als das letzte Mal, und der Frieder hat auch gute Noten. Dann wird der Vater schon zufrieden sein.«
»Nein,« sagte Wilhelm, »er wird nur meinen Vierer sehen.«
»O, ein Vierer?« »O weh!« riefen die Schwestern.
»So jammert doch nicht so,« rief Wilhelm, »sagt lieber, was man machen soll, dass der Vater die Zeugnisse vor Weihnachten nicht ansieht?«
Sie berieten und besannen sich eine Weile, ein Wort gab das andere und zuletzt wurde beschlossen, die Noten sollten alle zusammengezählt und dann die Durchschnittsnote daraus berechnet werden. Diese musste, trotz des fatalen Vierers, ganz gut lauten, so dass die Eltern wohl befriedigt sein konnten. Die Mutter hatte überdies selten Zeit, die Heftchen anzusehen, und dem Vater wollte man die schöne Durchschnittsnote in einem geschickten Augenblick mitteilen, dann würde er nicht weiter nachfragen; erst nach Neujahr mussten die Zeugnisse unterschrieben werden, bis dahin hatte es ja noch lange Zeit, so weit hinaus sorgte man nicht. Wilhelm war sehr vergnügt über den Gedanken, Otto, der das beste Zeugnis hatte, war zwar weniger damit einverstanden, wurde aber überstimmt, und sie machten sich nun an die Durchschnittsberechnung.
Wilhelm holte Frieder herbei, der hatte der Mutter schon sein Zeugnis gezeigt, nun wurde es ihm von den Brüdern abgenommen. »Seht nur,« sagte Wilhelm, »wie der sich diesmal hinaufgemacht hat!«
»Dafür kann ich nichts,« sagte Frieder, »die Mutter sagt, das kommt nur von der Harmonika. Wahrscheinlich, wenn ich eine neue zu Weihnachten bekomme, werden die Noten wieder schlechter. Gibst du mir mein Heft wieder, Karl?«
»Nein, das brauchen wir noch, sei nur still, dass ich rechnen kann.«
»Geh lieber hinaus, Frieder,« sagte Marie mütterlich, »das Elschen hat sich so gefreut auf dich,« und sie schob den Kleinen zur Türe hinaus.
Es ergab sich eine gute Durchschnittsnote, und Marie wollte es übernehmen, sie dem Vater so geschickt mitzuteilen, dass er gewiss nicht nach den Heften fragen würde. Sie wartete den Augenblick ab, wo Herr Pfäffling sich richtete, um zum letztenmal vor dem Fest in das Zentralhotel zu gehen. An seinen raschen Bewegungen bemerkte sie, dass er in Eile war. »Vater,« sagte sie, »wir haben alle unsere Zeugnisse bekommen und die Noten zusammengezählt. Dann hat Karl berechnet, was wir für eine Durchschnittsnote haben, weißt du, was da herausgekommen ist? Magst du raten, Vater?«
»Ich kann mich nicht mehr aufhalten, ich muss fort, aber hören möchte ich es doch noch gerne, eine Durchschnittsnote von allen Sechsen? Zwei bis drei vielleicht?«
»Nein, denke nur, Vater, eins bis zwei, ist das nicht gut?«
»Recht gut,« sagte Herr Pfäffling; er hatte nun schon den Hut auf und Marie bemerkte noch schnell unter der Türe: »Die Zeugnisheftchen will ich alle in der Mutter Schreibtisch legen, dass du sie dann einmal unterschreiben kannst.« »Ja, hebe sie nur gut auf,« rief Herr Pfäffling noch von der Treppe herauf.
Die kleine List war gelungen, die Heftchen wurden sehr sorgfältig, aber sehr weit hinten im Schreibtisch geborgen; ungesucht würden sie da niemand in die Hände fallen.
Herr Pfäffling freute sich jedes Mal auf die Stunden im Zentralhotel, denn es war dort mehr ein gemeinsames Musizieren als ein Unterrichten und so betrat er auch heute in fröhlicher Stimmung das Hotel. Diesmal stand die große Flügeltüre des untern Saales weit offen, Tapezierer waren beschäftigt, die Wände zu dekorieren, der Besitzer des Hotels stand mitten unter den Handwerksleuten und erteilte ruhig und bestimmt seine Befehle. »Das ist auch ein General,« dachte Herr Pfäffling, nachdem er einige Augenblicke zugesehen hatte. Große Tätigkeit herrschte in den untern Räumen. An der angelehnten Türe des Speisezimmers stand ein kleiner Kellner, die Serviette über dem Arm, einige Flaschen in der Hand und sah zu, wie eben zwei hohe Tannenbäume in den Saal getragen wurden. Aber plötzlich fuhr der kleine Bursche zusammen, denn hinter ihm ertönte eine scheltende Stimme: »Was stehst du da und hast Maulaffen feil, mach dass du an dein Geschäft gehst!« Es war Rudolf Meier, der den Säumigen so anfuhr. Als er Herrn Pfäffling gewahrte, grüßte er sehr artig und sagte: »Man hat seine Not mit den Leuten, heutzutage taugt das Pack nicht viel.« Eine Antwort erhielt Rudolf nicht auf seine Rede, ohne ein Wort ging Herr Pfäffling an ihm vorbei, die Treppe hinauf.
Rudolf sah ihm nachdenklich nach. Es kam ihm öfters vor, dass er auf seine verständigsten Reden keine Antwort bekam, und zwar gerade von den Leuten, die er hoch stellte. Andere rühmten ihn ja oft und sagten ihm, er spreche so klug wie sein Vater; ob wohl solche Leute, wie Herr Pfäffling noch größere Ansprüche machten? Rudolf stellte sich die Brüder Pfäffling vor. Wie kindisch waren sie doch im Vergleich mit ihm, sogar Karl, der älteste; diesen Unterschied musste ihr Vater doch empfinden, es musste ihm doch imponieren, dass er schon so viel weiter war! Der kleine Kellner konnte es wohl noch bemerkt haben, wie geringschätzig Herr Pfäffling an ihm vorübergegangen war: so etwas erzählten sich dann die Dienstboten untereinander und spotteten über ihn, das wusste er wohl. Ja, er hatte keine leichte Stellung im Haus.
Indessen war Herr Pfäffling die ihm längst vertraute Treppe hinaufgesprungen. Droben empfing ihn schon das flotte Geigenspiel seiner Schüler, und nun wurde noch einmal vor Weihnachten ausgiebig musiziert.
»Es wird ein Ball im Hotel arrangiert zur Weihnachtsfeier,« erzählte ihm die Generalin am Schluss der Stunde, »es soll sehr schön werden.«
»Ja,« sagte der General, »der Hotelier gibt sich alle Mühe, seinen Gästen viel zu bieten, er ist ein tüchtiger Mann und versteht sein Geschäft ausgezeichnet, aber sein Sohn spricht nur von Arbeit und tut selbst keine! Der Sohn wird nichts.«
Als Herr Pfäffling sich für die Weihnachtsferien verabschiedet hatte und hinausging, sah er am Fenster des Korridors eben den Sohn stehen, über den einen Augenblick vorher das vernichtende Urteil gefällt war: »Er wird nichts.« Kann es ein traurigeres Wort geben einem jungen Menschenkind gegenüber? Herr Pfäffling konnte diesmal nicht teilnahmslos an ihm vorübergehen. Rudolf Meier stand auch nicht zufällig da. Er wusste vielleicht selbst nicht genau, was ihn hertrieb. Es war das Bedürfnis, sich Achtung zu verschaffen von diesem Mann. Ein anderes Mittel hierzu kannte er nicht, als seine eigenen Leitungen zur Sprache zu bringen.
»Wünsche fröhliche Feiertage,« redete er Herrn Pfäffling an. »Für andere Menschen beginnen ja nun die Ferien, für uns bringt so ein Fest nur Arbeit.«
Herr Pfäffling blieb stehen. »Ja,« sagte er, »ich sehe, dass Ihr Vater sehr viel zu tun hat, aber wenn die Gäste versorgt sind, haben Sie doch wohl auch Ihre Familienfeier, Ihre Weihnachtsbescherung?«
»Ne, das gibt es bei uns nicht. Früher war das ja so, als ich klein war und meine Mutter noch lebte, aber ich bin nicht mehr so kindisch, dass ich jetzt so etwas für mich beanspruchte. Ich habe auch keine Zeit. Sie begreifen, dass ich als einziger Sohn des Hauses überall nachsehen muss. Die Dienstboten sind so unzuverlässig, man muss immer hinter ihnen her sein.«
»Lassen sich die Dienstboten von einem fünfzehnjährigen Schuljungen anleiten?«
Rudolf Meier war über diese Frage verwundert. Wollte es ihm denn gar nicht gelingen, diesem Manne verständlich zu machen, dass er eben kein gewöhnlicher Schuljunge war?
»Ich habe keinen Verkehr mit Schulkameraden,« sagte er, »in jeder freien Stunde, auch Sonntags, bin ich hier im Hause beschäftigt.«
»Sie kommen wohl auch nie in die Kirche?«
»Ich selbst nicht leicht, aber ich bin sehr gut über alle Gottesdienste unterrichtet. Wir haben oft Gäste, die sich dafür interessieren, und ich weiß auch allen, gleichviel ob es Christen oder Juden sind, Auskunft zu geben über Zeit und Ort des Gottesdienstes, über beliebte Prediger, feierliche Messen und dergleichen. Man muss allen dienen können und darf keine Vorliebe für die eine oder andere Konfession merken lassen. Wir dürfen ja auch Ausländer nicht verletzen und müssen uns manche spöttische Äußerung über die Deutschen gefallen lassen. Das bringt ein Welthotel so mit sich.«
Herr Pfäffling sagte darauf nichts und Rudolf Meier war zufrieden. Das »Welthotel« war immer der höchste Trumpf, den er ausspielen konnte, und der verfehlte nie seine Wirkung, auch auf Herrn Pfäffling hatte er offenbar Eindruck gemacht, denn der geringschätzige Blick, den er vor der Stunde für ihn gehabt hatte, war einem andern Ausdruck gewichen.
Unten, im Hausflur, stand noch immer die Türe zu dem großen Saal offen, die Dekoration hatte Fortschritte gemacht, Herr Rudolf Meier sen. stand auf der Schwelle und überblickte das Ganze, und im Vorbeigehen hörte Herr Pfäffling ihn zu einem Tapezierer sagen:
»An diesem Fenster ist noch Polsterung anzubringen, damit jede Zugluft von den Gästen abgehalten wird.«
Unser Musiklehrer, dem sonst, wenn er von seinen russischen Schülern kam, die schönsten Melodien durch den Kopf gingen, war heute auf dem Heimweg in Gedanken versunken. Er sah vor sich den tüchtigen Geschäftsmann, der in unermüdlicher Tätigkeit sein Hotel bestellte, der von seinen Gästen jeden schädlichen Luftzug abhielt, und der doch nicht merkte, wie der einzige Sohn, dem dies alles einst gehören sollte, in Gefahr war, zugrunde zu gehen. Herr Pfäffling war eine Straße weit gegangen, da trieben ihn seine Gedanken wieder rückwärts. »Sprich mit dem Mann ein Wort über seinen Sohn,« sagte er sich, »wenn seinem Haus eine Gefahr drohte, würdest du es doch auch sagen, warum nicht, wenn du siehst, dass sein Kind Schaden nimmt, dass es höchste Zeit wäre, es den schlimmen Einflüssen zu entziehen? Es sollte fortkommen vom Hotel, von der großen Stadt, in einfache, harmlose Familienverhältnisse!« Während sich Herr Pfäffling dies überlegte, ging er raschen Schritts ins Zentralhotel zurück, und nun stand er vor Herrn Meier, in dem großen Saal.
Der Hotelbesitzer meinte, der Musiklehrer interessiere sich für die Dekoration und forderte ihn höflich auf, alles zu besehen. »Ich danke,« sagte Herr Pfäffling, »ich sah schon vorhin, wie hübsch das wird, aber um Ihren Sohn, Herr Meier, um Ihren Sohn ist mir's zu tun!«
Äußerst erstaunt sah der so Angeredete auf und sagte, indem er nach einem anstoßenden Zimmer deutete: »Hier sind wir ungestört. Wollen Sie Platz nehmen?«
»Nein,« sagte Herr Pfäffling, »ich stehe lieber,« eigentlich hätte er sagen sollen, »ich renne lieber,« denn kaum hatte er das Gespräch begonnen, so trieb ihn der Eifer im Zimmer hin und her.
»Ich meine,« sagte er, »über all Ihren Leistungen als Geschäftsmann sehen Sie gar nicht, was für ein schlechtes Geschäft bei all dem Ihr Kind macht. Ist's denn überhaupt ein Kind? War es eines? Es spricht wie ein Mann und ist doch kein Mann. Ein Schuljunge sollte es sein, der tüchtig arbeitet und dann fröhlich spielt. Er aber tut keines von beiden. In dem Alter, wo er gehorchen sollte, will er kommandieren, den Herrn will er spielen und hat doch nicht das Zeug dazu. Er wird kein Mann wie Sie, er wird auch kein Deutscher, wird kein Christ, denn er dünkt sich über alle dem zu stehen. Der sollte fort aus dem Hotel, fort von hier, in ein warmes Familienleben hinein, da könnte noch etwas aus ihm werden, aber so nicht!«
Herr Pfäffling hatte so eifrig gesprochen, dass sein Zuhörer dazwischen nicht zu Wort gekommen war. Er sagte jetzt anscheinend ganz ruhig und kühl: »Ich muss mich wundern, Herr Pfäffling, dass Sie mir das alles sagen. Wir kennen uns nicht und meinen Sohn kennen Sie wohl auch nur ganz flüchtig. Mir scheint, Sie urteilen etwas rasch. Andere sagen mir, dass mein Sohn der geborene Geschäftsmann ist und schon jetzt einem Haus vorstehen könnte. Wenn er Ihnen so wenig gefällt, dann bitte kümmern Sie sich nicht um ihn, ich kenne mein eigenes Kind wohl am besten und werde für sein Wohl sorgen.«
Herr Pfäffling sah nun seinerseits ebenso erstaunt auf Herrn Meier, wie dieser vorher auf ihn. Endlich sagte er: »Ich sehe, dass ich Sie gekränkt habe. Das wollte ich doch gar nicht. Wieder einmal habe ich vergessen, was ich schon so oft bei den Eltern meiner Schüler erfahren habe, dass es die Menschen nicht ertragen, wenn man offen über ihre Kinder spricht und wenn es auch aus der reinsten Teilnahme geschieht. Sagen Sie mir nur das eine, warum würden Sie es mir danken, wenn ich Ihnen sagte: ›Ihr Kind ist in Gefahr, ins Wasser zu fallen,‹ und warum sind Sie gekränkt, wenn ich sagte: ›dem Kind droht Gefahr für seinen Charakter?‹ Darin kann ich die Menschen nie verstehen!«