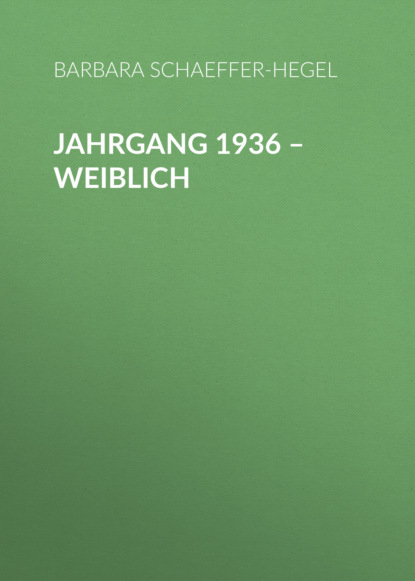- -
- 100%
- +
Meine und Leonis Mutter kamen wohlbehalten zurück und nach ein paar Tagen konnten wir heim ins Schloss. Das Schießen hatte aufgehört und ich durfte wieder nach draußen gehen. Ich spazierte durch die Stadt, um mit eigenen Augen zu sehen, was die Bomben und die Gewehre angerichtet hatten. Schamlos präsentierte das Haus einer Mitschülerin sein Innenleben: zerbrochene Tische und Stühle, Schränke und Kommoden und überall Federn, die aus zerrissenen Daunendecken über kaputte Bettgestelle flogen. Und Bilder, die schief an der Wand hingen. Die Bäckerei war in der Mitte gespalten: zwei Häuser jetzt, die auseinanderklafften. Andere waren in Berge von Backsteinen verwandelt aus denen Teile von Möbeln herausragten wie abgetrennte Arme und Beine von Menschen, die lebendig begraben worden waren. Als ich auf die Hauptstraße kam, sah ich vor der Apotheke, die kein Dach mehr hatte Herrn Dr. Schütz auf mich zukommen. Es gab keine Möglichkeit ihm auszuweichen. So marschierte ich weiter, auf Beinen, die sich wie steife Stöcke anfühlten. Als ich Dr. Schütz fast erreicht hatte, flog mein rechter Arm nach oben, die Hand weit nach vorne gestreckt. Den anderen Arm hielt ich fest gegen meine Seite gedrückt:
»Heil Hitler, Herr Dr. Schütz!«
presste ich mit kräftiger Kinderstimme hervor. Aber dann machte Dr. Schütz, der mich noch niemals zuvor angesprochen hatte, etwas ganz Außergewöhnliches: Er trat ein paar Schritte nach vorn, beugte sich zu mir herab, ergriff meinen ausgestreckten Arm und führte ihn sanft nach unten:
»Wir grüßen jetzt nicht mehr so, Bärbelchen«,
sagte er,
»warum sagst du nicht einfach „Grüß Gott, Herr Dr. Schütz?“«.
Damit ging er weiter. Wie vom Donner gerührt blieb ich auf der Straße zurück. Nach einer Weile löste sich der Kampf in meinen Muskeln, ich schlug beide Hände vors Gesicht. Ich hatte verstanden. Der Krieg war zu Ende.
Herrn Dr. Schütz begegnete ich ein paar Jahre später wieder. Als Direktor des renommierten Stuttgarter Dillmanngymnasiums, das mein Bruder Jochen besuchte.
Nachdem wir beim Eintreffen der Amerikaner aus dem Schloss, welches sich die „Amis“ als Hauptquartier erwählt hatten, rausgeschmissen worden waren, landeten wir zunächst in einer winzigen Dachkammer in einem uralten Gasthaus in der Schnurgasse. Unser Zuhause, ein winziges Kämmerchen für vier Personen, war dunkel und eng, lag aber mitten in der Stadt, dicht neben dem Rathaus. Nach nur wenigen Wochen konnten wir jedoch in zwei Zimmer plus einer Dachkammer in die KonsulÜbele-Straße umziehen. Küche und Bad teilten wir uns mit der Hauptmieterin. Mein älterer Bruder Peter und ich mussten in der Dachkammer schlafen, in der es im Sommer brütend heiß wurde. Was uns veranlasste, nachts durch die Dachluke auf das schräge Dach zu klettern, wo mich mein Bruder anhand irgendwelcher getrockneter Blätter in die Kunst des Rauchens einführte. Auf dem Dach genossen wir ungeahnte Freiheit, fühlten uns als Herren der Welt und außerhalb jeglichen elterlichen Zugriffs. Dachten wir! Wir hatten nicht bemerkt, dass im Haus schräg gegenüber eine Frau im Rollstuhl Tag für Tag, und auch abends solange es hell war, am Fenster saß und alles beobachtete, was ihre Augen erreichen konnten. Normalerweise guckte sie auf die Straße, aber eines Abends richtete sich ihr Blick nach oben. Sie sah zwei Kinder auf einem abschüssigen Dach sitzen und bekam einen Schreikrampf. Von da an war die Dachkammer nur noch heiß und stickig, kein Fenster mehr zur Freiheit.
Die Zeit in der Konsul-Übele-Straße war auch die Zeit, in der amerikanische Soldaten in offenen LKWs durch die Straßen fuhren und den Kindern, die den Autos hinterherliefen, Kaugummis und Schokolade zuwarfen. Ein Schwarm von Kindern pflegte einem solchen Lastwagen zu folgen und manche Kinder kletterten sogar auf die Ladefläche hinauf. Ich wandte mich ab. Ich fand es abstoßend und unwürdig, dass man sich wegen ein paar Süßigkeiten vor dem „Feind“ erniedrigte. Denn Feinde waren sie doch noch immer, die amerikanischen Soldaten, oder?!
In der Konsul-Übele-Straße wohnten wir nur einen Sommer. Dann fand Mutter die Wohnung im Hause von Frau Kurtz in der Alten Amrichshäuserstraße 17, wo ich den Rest meiner Kindheit verbrachte. Die Konsul-Übele-Straße blieb mir vor allem wegen der Ausflüge aufs Dach in Erinnerung. Sie war aber auch deshalb bemerkenswert, weil ich dort meine ersten eigenen Schuhe bekam. Keine, die mein Bruder Peter schon getragen hatte, sondern ein Paar ganz neue, aus Autoreifen geschnittene Sandalen, die mit dicken Schnüren zum Festbinden versehen waren. Und ich hatte dort, obwohl noch keine 10 Jahre alt, meinen ersten Anfall von Weiblichkeitswahn. Ich schob mir zwei mit Stoffresten gefüllte kugelrunde Netze, die Art Ball, mit dem wir Kinder damals spielten, unter mein enges Sommerhemd und flanierte mit falschem Busen und stolz erhobenem Kopf die ziemlich lange Konsul-Übele-Straße hinunter. Bis mir, just in dem Moment, als mir ein Junge, den ich kannte, entgegenkam, einer der Bälle aus dem Hemd rutschte und zu Boden fiel.
5. Alte Amrichshäuser Straße 17
Erst in der Alten Amrichshäuser Straße 17, im Haus von Frau Kurtz, fand ich mein endgültiges Zuhause. Das alte Haus mit dem Holzbalkon zur Straßenseite gehörte zu den wenigen Häusern, die in den zwanziger Jahren auf der Westseite des Flusses weit außerhalb des Stadtkerns gebaut worden waren, die aber jetzt, nachdem sich das Städtchen in alle vier Himmelsrichtungen, das Tal hinauf und hinunter, und weit auf die umliegenden Anhöhen hinauf ausgedehnt hatte, zum alten Stadtteil Künzelsaus gehörten. Frau Kurtz war eine alte Dame ohne Familie. Das Haus mit dem großen Gemüsegarten vor und dem Obstgarten hinter dem Haus war ihr ein und alles. Es war in Hanglage gebaut und bestand demzufolge auf der Vorderseite aus drei, auf der Obstgartenseite nach hinten hinaus aus nur zwei Etagen.

Alte Amrichshäuser Straße 17.
Obwohl als Einfamilienhaus erbaut, hatten jetzt, kurz nach Kriegsende, insgesamt 5 Partien im Haus von Frau Kurtz Unterkunft gefunden. Zwei Familien mit Kindern, ein Ehepaar und zwei alleinstehende ältere Damen. Eine pensionierte Bibliothekarin und Frau Kurtz selbst bewohnten im ersten Stock, der Bel Etage, die zwei vorderen Zimmer mit Balkon. Im Zimmer daneben, das nach hinten hinausging und neben einem altmodischen Bad mit Holzofenboiler und einer Küche mit Kohleherd lag, wohnte ein aus Schlesien vertriebenes Ehepaar, Herr und Frau Ascherl, die noch immer auf der Suche nach ihrem einzigen Sohn waren, der in den letzten Kriegsmonaten an die Ostfront eingezogen worden war, und von dem die Eltern seither nichts gehört hatten.
Meine Familie bewohnte im Oberstock eine Küche und dreieinhalb Zimmer: Mutters Arbeits- und Schlafzimmer, ein Wohn- und Esszimmer, ein Schlafzimmer für die Kinder und ein kleines Zimmerchen, in das gerade mal ein Bett für Rosel, die „gute Seele“ unserer Familie, und ein schmaler Schrank für ihre Kleider passten. Waschen musste man sich in der Küche. Mit Rosel waren wir fünf. Meine Mutter, mein Bruder Peter, mein Bruder Jochen, Rosel und ich. Und auch später, als mein älterer Bruder für die gymnasiale Oberstufe in die Klosterschulen des württembergischen Landexamens nach Maulbronn und Blaubeuren ins Internat geschickt wurde, waren wir wieder fünf. Nachdem ein Bett im Kinderzimmer frei wurde, kam Poldi zu uns. Meine Mutter hatte ihn, der in die erste Klasse der Oberschule ging, als Pflegekind aufgenommen.
Poldis Mutter war 1946 mit einem amerikanischen Offizier nach USA entwichen. Möglicherweise in der Annahme, dass ihr Mann, Poldis Vater, nicht mehr vom Krieg zurückkommen würde. Doch Poldis Vater kam zurück. Fast zwei Jahre später und nachdem er lange nach seiner Frau und seinen beiden Söhnen gesucht hatte. Er fand Poldi und seinen Bruder Eberhard schließlich in Hohenlohe, in einem kleinen Dorf nahe Dörrenzimmern, in der Obhut seiner Eltern. Tief getroffen vom Verrat seiner Frau kehrte der Vater auf der Suche nach einem beruflichen Neuanfang in seine Heimatstadt Dresden zurück, obwohl ihn alle Freunde und vor allem seine Eltern dringend davor gewarnt hatten, sich in das Herrschaftsgebiet der Sowjets zu begeben. Ich habe nie erfahren, was Poldis Vater im Krieg und unter der Naziherrschaft gemacht hatte – ich weiß nur, dass man, nachdem er in Dresden angekommen war, nie wieder von ihm gehört hat und dass alle Versuche, ihn zu finden, umsonst blieben. Seine Kinder lebten bei den Großeltern, und da es in ihrem Dorf keine weiterführende Schule gab, suchten und fanden sie in Künzelsau Pflegefamilien, in denen ihre beiden Enkel während der Schulzeit unterkommen konnten. Eine dieser Familien waren wir. Ich mochte Poldi sehr. Ein weiterer kleiner Bruder, der so anhänglich, so liebebedürftig und selbst so liebevoll war – das war ein großes Geschenk.
Und dann gab es natürlich Rosel. Rosel, ein Flüchtlingsmädchen aus Schlesien, war erst siebzehn Jahre alt, als sie zu uns kam. Sie blieb bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahr in unserer Familie. Damals, als Rosel noch neu bei uns war, hatte sie einen Freund, den sie, wie sie mir einmal gestand, sehr liebte. Aber sie wollte so jung noch nicht heiraten. Sie musste sich doch erst eine Aussteuer zusammensparen. Der Freund wollte aber nicht warten, verließ Künzelsau und heiratete eine andere. Trotz einer ganzen Anzahl von Verehrern, die heftig um Rosel warben, konnte sie sich für keinen anderen Mann entscheiden. Und dann, nach über zehn Jahren, hielt eines Abends ein Motorrad vor der Alten Amrichshäuser Straße Nr. 17. Rosels Jugendliebe! Seine Ehe war gescheitert, ob Rosel ihm verzeihen könne. Sie konnte und zog mit ihm nach Norden. Für mich war Rosel eine warme Freundin und Trösterin gewesen. Sie blieb mir und meiner Familie bis zu ihrem Tod im Jahre 2004 eng verbunden. Für die Mutter war Rosel eine unersetzliche Hilfe. Sie brachte der „Frau Doktor“, wie Rosel meine Mutter nannte, grenzenlosen Respekt entgegen. Obwohl meine Mutter doch gar keinen Doktortitel besaß. Den Titel hatte sie, wie das zu ihrer Zeit üblich war, mit meinem Vater geheiratet.
Mit Hilfe von Rosels landwirtschaftlichen Kenntnissen wurde unser Speisezettel bald kostengünstig angereichert. Frau Kurtz hatte uns im vorderen Garten fast die Hälfte der Nutzbeete überlassen. Auf denen nun Tomaten und Salat, Kohlrabi, Bohnen und Erdbeeren angepflanzt wurden. Und auf dem schmalen, links neben dem Haus gelegenen Rasenstreifen durften wir Hühner halten. Aus alten Brettern und Holzresten zimmerte mein Bruder mithilfe von Herrn Wüster, der im Souterrain wohnte, einen Hühnerstall und umgab ein etwa fünf mal sechs m² großes Rasenstück mit einem Zaun aus Maschendraht, damites den Hühnern – zwei weißen Leghornhennen, drei schwarzen Blesshühnern und einem bunten Gockelhahn – als Auslauf dienen konnte. Im unteren Teil des Obstgartens, der hinter dem Haus bis zur Neuen Amrichshäuser Straße anstieg, konnten meine Brüder und ich Hasen halten. Jedes der Kinder hatte einen eigenen Stall mit ein oder zwei Stallhasen – Deutsche Silber, Blaue Wiener oder Angorakaninchen –, für die wir jeweils allein zuständig waren. Wir mussten die Kaninchen füttern, den Stall ausmisten und, wenn es Junge gab, für besondere Streu und besondere Nahrung sorgen. Wenn es ans Schlachten ging, was unausweichlich anstand, gab es vor allem bei mir tränenreichen Protest.
Aber meine Mutter hatte noch weitere, sehr nützliche Ressourcen für uns erschlossen. An jedem Samstag gingen sie, mein älterer Bruder Peter und später auch ich selbst in eines der umliegenden Dörfer, um dort bei den Bauern Butter und Milch und Mehl zu kaufen. Trotz der nicht ganz unbedeutenden Ernte an Gemüsen und Obst, die wir aus unserem Garten bezogen, reichte das, was man in der Stadt im Laden kaufen konnte, nicht aus, um uns alle – Mutter, Rosel, die beiden Brüder, und mich – satt zu kriegen. Und Mutter kannte die meisten Bauern aus den Dörfern der Umgebung. Sie waren alle bei ihr im Kurs gewesen. Als es nach dem Ende des Krieges in der Schule keinen Unterricht mehr gab und Mutter keine Stelle und daher auch kein Einkommen mehr hatte, bot sie Englischkurse für Erwachsene an. Allabendlich um sechs Uhr in den Räumen des Kindergartens. Alle Leute, auch die Bauern, wollten damals Englisch lernen. Vor allem die Bauern. Da jetzt die Amerikaner die Herren im Land waren, wollten sie deren Sprache wenigstens so weit beherrschen, dass sie mit ihnen reden und verhandeln konnten. Mutters Kurse waren immer überfüllt und die Bauern bezahlten mit Milch und Eiern und Mehl. Manchmal auch mit einem Schinken oder mit Würsten, wenn geschlachtet worden war. Im zweiten Jahr nach dem Krieg, ließ dann allerdings der Andrang nach. Die Bauern hatten die Angst vor den fremden Eroberern verloren; es schien nicht mehr so wichtig, deren Sprache zu können. Aber unsere Mutter behielten sie in dankbarer Erinnerung. Wir durften jederzeit kommen und uns mit den in der Stadt noch immer raren Lebensmitteln versorgen.
Familie Wüster wohnte im Souterrain. Das Souterrain hatte einen eigenen Zugang auf der rechten Seite des Hauses und bestand aus mehreren Kellerräumen, einer großen Waschküche und einem geräumigen Wohnzimmer mit Erkerfenstern zum vorderen Garten hin. Dort war das Ehepaar Wüster mit dem achtjährigen Pflegesohn Horst einquartiert worden. Auch die Wüsters waren Flüchtlinge und hatten, wie ich später erfuhr, im Krieg zwei Söhne verloren. Der kleine Horst war ihnen zugelaufen. Sie hatten ihn im Flüchtlingstreck ohne Eltern oder sonstige Begleitperson aufgefunden und sich seiner angenommen, obwohl das Kind offensichtlich schwer gestört war. „Horstle“, wie der Bub von allen genannt wurde, war extrem scheu, stotterte, wenn er mit jemandem reden musste, und war hoch aggressiv. Er duckte sich hinter die Gartenhecke und bewarf vorüberkommende Kinder, aber auch Erwachsene, mit Dreck. Er beschimpfte meine Brüder und andere Jungen aus einem sicheren Versteck heraus mit den schlimmsten Schimpfwörtern, und wenn er eine Katze erwischte, ging es dieser schlecht. Wenn Peter oder Jochen Horstle zu fassen kriegten – was ihnen allerdings nur selten gelang –, hatte der nichts zu lachen. Es setzte Ohrfeigen und manchmal schlimme Prügel. Was Horstle dazu veranlasste, sie noch kräftiger zu beschimpfen und sie – wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot – mit allem erdenklichen Abfall zu bewerfen. Wodurch sich meine Brüder wiederum zu noch strengeren Strafaktionen genötigt sahen.
Nur mir gegenüber war Horstle zahm. Ich war die einzige, die ihn nicht verhöhnte, ihn nicht wegen seiner groben Sprache beschimpfte, und die ihn nicht schlug. Ich hatte Mitleid mit Horstle. Dieser kleine Junge war immer allein. Er hatte keine Geschwister, seine Pflegeeltern waren schon fast im Großelternalter und in der Schule erging es ihm genauso wie bei uns auf der Straße. Kein Kind wollte etwas mit ihm zu tun haben. Ich nahm mir Zeit, um mit Horstle zu sprechen. Ich fragte ihn nach seinen Eltern, nach der Schule, versuchte ihm zu erklären, warum er den Tieren nicht weh tun dürfe und erzählte ihm Geschichten, die er nicht kannte. Horstle schien mich zu mögen; jedenfalls suchte er meine Nähe. Und ich verteidigte ihn gegen die Brüder.
Obwohl Frau Kurtzens Haus dreigeschossig war und seinen damals zwölf Bewohnern gut Platz bot, besaß das Haus nur eine Toilette. Ein Plumpsklo auf der mittleren Treppe zwischen dem ersten und dem zweiten Stock. Das Klo bot Anlass zu mancherlei Reibereien und Auseinandersetzungen zwischen den Hausbewohnern und vor allem zwischen der Hausbesitzerin und unserer Mutter. Abgesehen davon, dass man häufig – auch wenn es dringlich war – lange anstehen musste, wurden die Reinlichkeitsstandards, die Frau Kurtz verordnet hatte, nicht immer eingehalten. Vor allem von den drei Kindern aus dem Oberstock. Was meiner Mutter regelmäßig schwere Vorwürfe einbrachte. Unsere Mutter hatte sich daher angewöhnt, wenn sie von der Schule nachhause kam, als erstes das Plumpsklo zu inspizieren.
Und dann passierte es.
Von einer alten Dame, einer Nachbarin, der sie als junges Mädchen mit kleinen Dienstleistungen behilflich gewesen war, hatte meine Mutter eine wunderschöne Kamee geerbt. Eine aus einer Muschel geschnitzte Mondgöttin, die in Gold gefasst und als Brosche gearbeitet war. Meine Mutter trug sie fast täglich. Als Verschluss ihrer Bluse direkt am Hals. Ohne die Kamee war die Mutter nicht zu denken. Sie gehörte zu ihr wie die Joppe zum Jäger.
Als meine Mutter an diesem speziellen Tag nachhause kam und das Klo inspizierte, trug sie nicht nur, wie üblich, die Brosche an der Bluse, sie fand auch hinreichenden Grund, sich mit der Bürste in der einen Hand und dem Wasserkrug in der anderen über das offene Klobecken zu beugen. Mit dem Säubern kam sie allerdings nicht sehr weit. Ein Entsetzensschrei entfuhr ihrem Mund, ihre Hände flogen zum Hals. An die Stelle, an der die Kamee ihren Stammplatz hatte. Aber sie wusste ja schon, dass es zu spät war. Sie hatte die mattweiße Schönheit nach unten stürzen sehen und den dumpfen Ton gehört, als ihre Lieblingsbrosche in dem stinkenden Grab aufschlug.
Meine Mutter stürmte hinaus, alarmierte uns Kinder und es dauerte nicht lange, da waren alle Mitbewohner, und natürlich auch Frau Kurtz, voller Schrecken und Trauer am Ort des Geschehens versammelt. Die Hausbesitzerin erkannte sofort ihre Chance. Denn die versammelte Hausgemeinschaft war sich darin einig, dass man die göttliche Dame nicht einem so trostlosen Grab überlassen dürfe. Sie musste gerettet werden. Und die kluge Alte wusste auch sofort wie. Die Güllegrube, die üblicherweise gegen eine stattliche Summe von der Stadtreinigung entleert wurde und die zum Zeitpunkt des Sturzes der Schönen schon wieder fast voll war, musste geleert werden! Eimer für Eimer müsste schön gleichmäßig auf ihrem Grundstück verteilt, die Bäume, jeder einzelne, ausreichend gedüngt werden. Und beim Ausgießen könnte man dann sorgfältig untersuchen, ob sich das verlorene Schmuckstück unter den Exkrementen befand. Also wurden alle verfügbaren Eimer zusammengetragen, die Hausbewohner bildeten eine Kette von der Grube bis zum jeweiligen Baum, den die Hausbesitzerin, die das Kommando für die Aktion übernommen hatte, angab. Herr Wüster, am Anfang der Kette, füllte die Eimer, Frau Ascherl kippte sie aus und durchsuchte das Entleerte mit einem abgeflachten Holzlöffel. Genauestens. Zentimeter für Zentimeter inspirierte sie jeden Grashalm des frisch gedüngten Rasens.
Zwei Stunden arbeitete die Menschenkette aus Mitbewohnern rastlos und ohne Pause. Gespannt wie Goldsucher beim Schürfen, und ohne den Gestank, der sie umgab, wahrzunehmen. Und zwei Stunden lang stocherte Frau Ascherl auf der Suche nach der Göttlichen mit Akribie und scharfen Augen in der ausgekippten Scheiße. Bis die Grube leer, aber die Broschendame noch immer nicht aufgetaucht war. Entgeistert standen 12 Menschen um die leere Grube und starrten ratlos nach unten. Bis die beiden Knaben aus dem Oberstock befanden, dass jetzt einer in die Grube steigen müsse – einer, der nicht sehr füllig und nicht hochgewachsen sein dürfe, der klein und wendig genug sei, um sich in der Grube frei zu bewegen – ein Kind also! Das dann den Boden stochernd absuchen und die Dame finden müsse. Die Erwachsenen protestierten: Das sei gefährlich! In der Grube gäbe es giftige Gase. Nein, das gehe nicht! Aber die Buben gaben nicht nach. Das Goldfieber hatte sie erfasst. Beide wollten sie nach unten. Sowohl Jochen als auch Poldi bestanden darauf, dass sie der Verursacher des Unglücks gewesen seien und deswegen den Abstieg in die Hölle wagen müssten. Sodass schlussendlich gelost wurde. Poldi, der Pflegesohn, gewann. Zur Sicherheit wurde er angeseilt und mit einem großen Suppenlöffel bewaffnet in die Grube hinuntergelassen. Nach einer gefühlten Unendlichkeit fand Poldi das Schmuckstück. Unter dem Jubel der Hausgemeinschaft, die, was dringend nötig war, danach – von einem penetranten Geruch begleitet – quer durch die ganze Stadt in die öffentliche Badeanstalt marschierte.
Künzelsau bot uns Kindern eine prächtige Spielumgebung. Im Garten, in den Gärten der Nachbarn, in den Wiesen, die am Ende unsere Straße begannen, konnten wir spielen und rennen, uns verstecken, und, da es auf der Straße keine Autos gab – jedenfalls fast keine –, war auch die Straße unser Spielplatz und wurde durch Kreide mit allerlei Mustern und Spielplänen verziert. Aber auch die Stadt selbst und die überbauten Gässchen, die der Stadtmauer entlang unter den Häusern hindurchführten, gaben exzellente Schauplätze für Versteckspiele, für „Räuber und Gendarm“, oder auch für einsame Erkundungstouren. Künzelsau war das Traumland meiner Kindheit, die endete, als ich gezwungen wurde, mein Städtchen zu verlassen. Aber das war später. Noch spielten sich wichtige und zum Teil dramatische Entwicklungen in meinem geliebten Kochertal ab.
6. Die Schule
Die Schule in Künzelsau war ganz anders als die Schule in Tübingen. Vor allem war sie voller Überraschungen für mich. Daran, wie ich nach der Umzugspause in die erste Klasse eingeführt wurde, habe ich keine Erinnerung. Kein Lehrer, kein Schüler, kein Gesicht. Kein Vorfall, der in meinem Gedächtnis hängen geblieben wäre. Dafür anderes. Zum Beispiel, dass ich nach nur wenigen Wochen in die zweite Klasse versetzt wurde, da ich, die doch keine Tafel mit sauberen Schriftzeichen füllen konnte, den Kindern der ersten Klasse in Künzelsau angeblich weit voraus war.
Aus der zweiten Klasse, die ich dann ebenfalls nur kurze Zeit besuchte, erinnere ich mich jedoch an einen mich sehr verwirrenden Vorfall.
Die Schule, ein noch relativ junger Neubau, lag weit außerhalb der Stadt, am Rande eines Neubaugebietes. Neben der Schule war, ebenfalls neu, die Stadthalle gebaut worden als Ort, an dem Vorträge, Theateraufführungen, Konzerte und diverse andere Veranstaltungen stattfinden konnten. Zum Ende meines ersten Schuljahres, in dem ich also schon in der 2. Klasse saß, wurde dort die Abschlussfeier für die Untersekunda, nach heutiger Zählung die zehnte Klasse der Oberschule, gefeiert. Da die Oberschule in Künzelsau nur bis zur mittleren Reife führte, mussten die Schüler die Schule nach der Untersekunda entweder ganz verlassen, oder als Fahrschüler nach Schwäbisch Hall fahren, wo sie in der dortigen Oberschule Abitur machen konnten.
Meine Mutter, die ja inzwischen wieder Lehrerin an der Oberschule war, hatte mir erzählt, dass die Abschlussfeier in der Stadthalle stattfinden würde und mich neugierig gemacht. Was machten sie bei so einer Feier? Wie sieht so ein Fest aus? Würde ich meine Mutter sehen? Das war eine allzu große Verlockung, und als ich mich zum Zeitpunkt der Veranstaltung aus der Schule raus und in den Festsaal der Stadthalle hineingeschmuggelt hatte – der Lehrerin hatte ich gesagt, ich müsse aufs Klo – war der lange viereckige Saal vor mir bis auf eine letzte leere Stuhlreihe angefüllt mit Menschen. An seinem von mir entfernten Ende bewegten sich Kinder auf einer höher gelegenen Bühne, führten kleine Stücke auf, reklamierten Gedichte, und sangen dann gemeinsam »Wer ha die Käse zum Bahnhof gerollt?« Der ganze Saal lachte. Mir wurde etwas mulmig zumute, denn meine Mutter, Frau Schweizer, das wusste ich, wurde von den Schülern „die Käse“ genannt. Aber ich wusste nicht genau, ob diese Vorführung als Huldigung oder als Verspottung meiner Mutter gedacht war.
In der letzten Reihe konnte ich mich hinstellen und das Geschehen vorne verfolgen. Aber die Feier war bald zu Ende. Wie auf Kommando erhoben sich plötzlich die Menschen im Saale, streckten den rechten Arm in die Höhe und sangen ein Lied, das ich zwar schon sehr oft gehört hatte, dessen Text ich aber nicht kannte: »Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!«. Wie elektrisiert riss es auch mich vom Stuhl. Ich stand kerzengerade und mein rechter Arm flog in die Luft. Ich sang mit. Die Worte kannte ich zwar nicht, aber die Melodie: „la-la-la-la- la-la lalala…..“ . Und dann überflutete mich inmitten der brüllenden, die Hände hochreckenden Menschen ein heißer Wirbel: Stärke, Stolz, ein gewaltiges Gefühl der Verbundenheit strömte durch meine Brust, ließ mich straffer und größer werden und im Bewusstsein einer neuen Kraft sehr aufrecht in mein Klassenzimmer zurückgehen.
Doch das mich so angenehm erhebende Gemeinschaftsgefühl hatte ein ernüchterndes Nachspiel. Nach der Schule, auf dem Weg nach Hause, der sehr weit war und den ich immer noch alleine gehen musste, da ich neue Freundinnen noch nicht gefunden hatte, kam mir plötzlich ein sehr beunruhigender Gedanke: stolz darauf zu sein, eine Deutsche zu sein, mich groß und stark fühlen, weil ich in Deutschland geboren bin?! Das war doch völlig sinnlos. Wie kann man denn auf etwas stolz sein, an dem man in keiner Weise selber beteiligt, das ein reiner Zufall war. Genauso gut hätte ich irgendwo in Afrika geboren werden können, dachte ich. Zwar wusste ich nicht, wo Afrika lag, nur dass es sehr weit weg war und dass die Leute mir manchmal hinterher sangen: »Barbara, Barbara, Komm mit mir nach Afrika«. Mein Hochgefühl sackte in sich zusammen. Es gab gar keinen Grund stolz zu sein auf etwas so Zufälliges wie meine Geburt in Kassel.