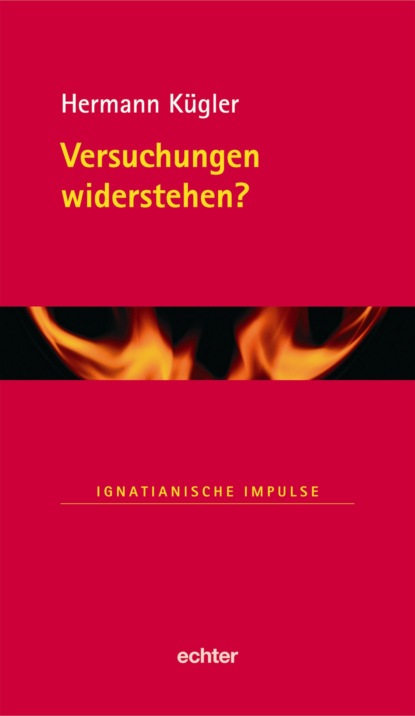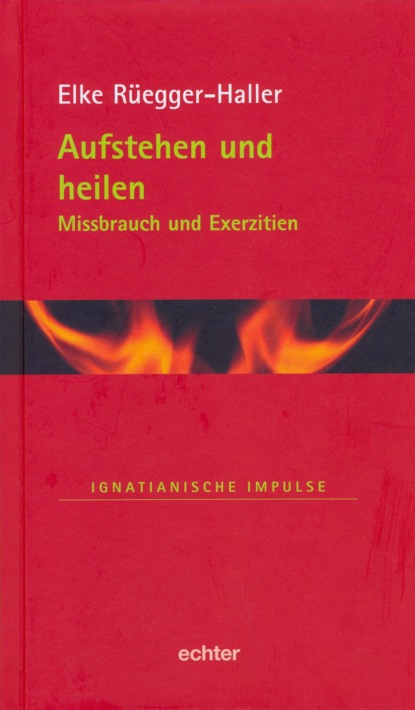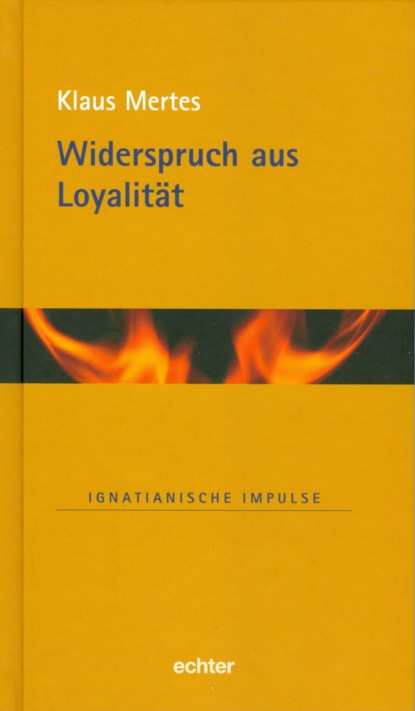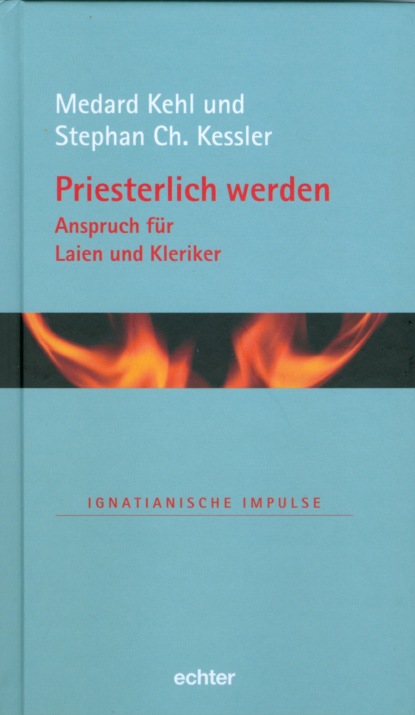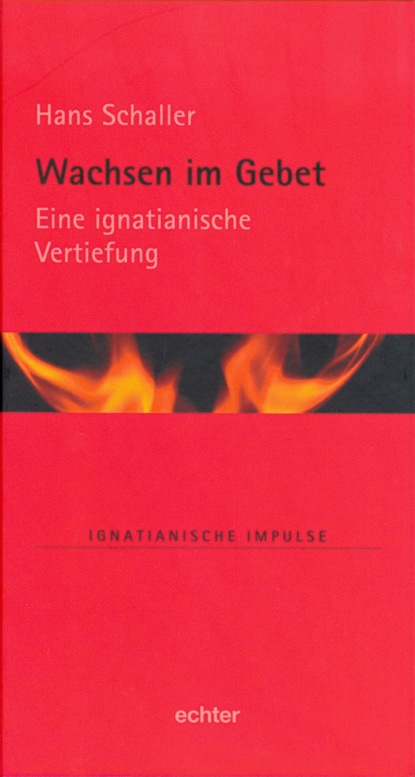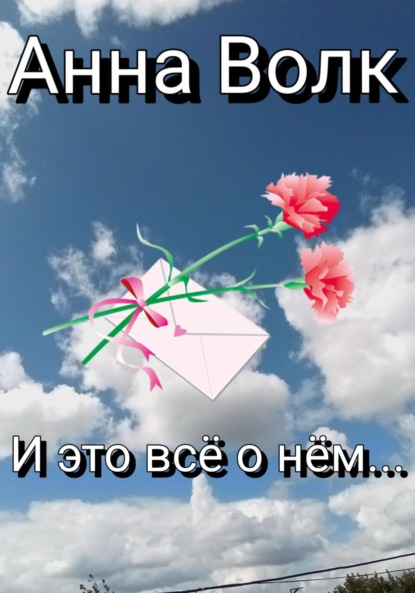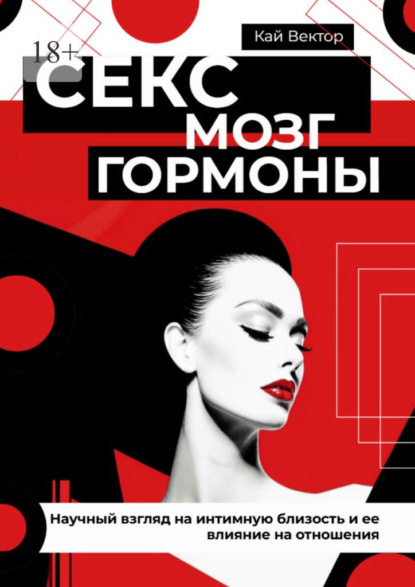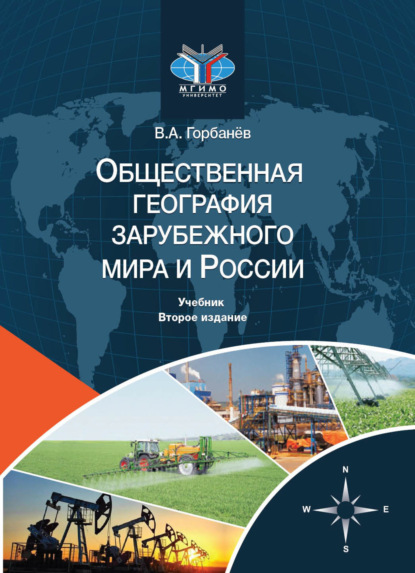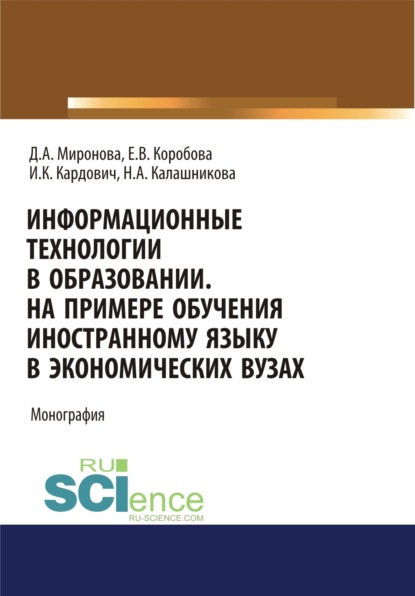Aus Rom - euer Ignatius!
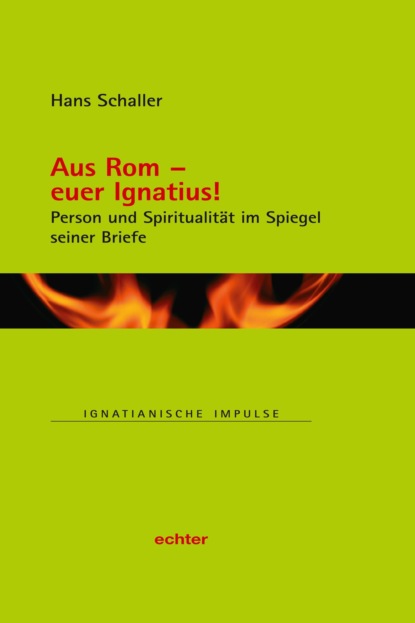
- -
- 100%
- +

Hans Schaller
Aus Rom – euer Ignatius!
Person und Spiritualität im Spiegel
seiner Briefe
Ignatianische Impulse
Herausgegeben von Stefan Kiechle SJ, Willi Lambert SJ und Stefan Hofmann SJ
Band 83
Ignatianische Impulse gründen in der Spiritualität des Ignatius von Loyola. Diese wird heute von vielen Menschen neu entdeckt.
Ignatianische Impulse greifen aktuelle und existentielle Fragen wie auch umstrittene Themen auf. Weltoffen und konkret, lebensnah und nach vorne gerichtet, gut lesbar und persönlich anregend sprechen sie suchende Menschen an und helfen ihnen, das alltägliche Leben spirituell zu deuten und zu gestalten.
Ignatianische Impulse werden begleitet durch den Jesuitenorden, der von Ignatius gegründet wurde. Ihre Themen orientieren sich an dem, was Jesuiten heute als ihre Leitlinien gewählt haben: Christlicher Glaube – soziale Gerechtigkeit – interreligiöser Dialog – moderne Kultur.
Hans Schaller
Aus Rom –
euer Ignatius!
Person und Spiritualität im Spiegel
seiner Briefe
echter
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
© 2019 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05376-5
978-3-429-05029-0 (PDF)
978-3-429-06439-6 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Einführung
1. Aura schreibender Menschen
Ein Griffel in der Hand
Ein Stift am Mund
Ein Wort auf der Zunge
2. Ignatius: Im Banne von Geschriebenem
Wie es mit dem Schreiben anfing
Wie Geschriebenes Autorität hat
Blasse Tinte ist stärker als das beste Gedächtnis
3. Ignatius über die Schulter geschaut
Gut schreibt, wer verbessert
Nicht elegant, dafür sachlich
Ignatianische Briefe im Vergleich
4. Briefe – Band geistlicher Freundschaft
Vom Gespräch zum Briefwechsel
Schriftlich im Herzen verbunden bleiben
5. Das hohe Ideal regelmäßiger Korrespondenz
Wie ein Ideal organisiert wird
Der Hauptbrief: Rapportieren und werben
Persönlicher Brief: Erzählen und unterhalten
6. Wie Briefe beginnen
Auf andere zugehen
Mit Wohlwollen empfangen
Für das Reich Gottes gewinnen
7. Was in die Briefe kommt
Die ganze Welt auf dem Schreibtisch
Schriftlich Gott Großes zutrauen
Nebensächliches ernst genommen
8. Was am Ende steht
Als Gruß ein Gebet
Nüchtern und demütig bis zum Schluss
9. Der handgeschriebene Brief in der digitalen Welt
Handgeschriebenes auf dem Prüfstand
Wenn Ignatius in unsere Zeit käme
»Nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern das innere Verkosten«
Das innere Verkosten
Anmerkungen
Vorwort
Ein Buch über das Briefschreiben! Das ist heute ein Unternehmen, das unausweichlich in eine strittige und kontroverse Thematik führt. Es ist nicht zu vermeiden, dass man mit solcher Absicht in einen digitalen Gegenwind gerät, vor allem dann, wenn es um handgeschriebene Briefe gehen soll. Um anderes kann es sich nicht handeln, wenn ein großer Briefschreiber aus dem 16. Jahrhundert zu Wort kommen soll, einer, der Tausende von Briefen geschrieben und diktiert hat, der deshalb um Größe und Elend solcher Korrespondenz weiß: Ignatius von Loyola.
Ein Buch, das quer in der heutigen geistigen Landschaft steht. Für den Schreibenden, für mich, ergab sich folgender Konflikt. Während ich mich mit diesem großen geistlichen Briefschreiber ins Gespräch einließ, kamen mir ständig die gängigen Einwände unserer Zeit zu Ohren: Mit der Hand Briefe schreiben, das sei vorbei, sei zeitraubend, nicht effektiv. Ich hörte diese Zwischenrufe, wollte mich aber dadurch nicht davon abbringen lassen, Sinn und Inhalt ignatianischer Briefe darzustellen. Er ist es schließlich, Ignatius von Loyola, der hier zu Wort kommen soll, den ich reden, ja ausreden lassen wollte, ohne ihn mit modernen Einwänden vorschnell zu unterbrechen. – Deshalb die Entscheidung, das Problem, wie ignatianische Erfahrungen in einer digitalen Zeit gehört und aufgenommen werden können, erst am Schluss, im 9. Kapitel, aufzunehmen. Allerdings andeutungsweise nur, in wenigen Hinweisen.
Es bedarf keiner großen Erklärung, warum das Briefschreiben des heiligen Ignatius Thema für die »Ignatianischen Impulse« sein kann. Die große Dokumentation von 7.000 Briefen ist ein immenser Reichtum und ein guter und direkter Weg, um die Person und die Spiritualität dieses Heiligen kennenzulernen. Briefe sind Selbstmitteilungen und verraten vieles und Wesentliches von ihren Verfassern. Durch das Handschreiben hat Ignatius nicht nur Probleme seines Aufgabenfeldes geregelt, sondern auch sein geistliches Profil gefunden. Es gibt kaum ein Thema seines Lebens, das nicht seinen Niederschlag in Briefen gefunden hätte. Deshalb sind diese ein guter Weg, um das Gesicht dieses Heiligen besser kennenzulernen.
Ich schreibe diese letzten Sätze in der extremen Sommerhitze von Basel, am Vortag des Festes des heiligen Ignatius, am 30. Juli. Dies nicht ohne großen Dank an viele Mitbrüder, die mich immer wieder zum Schreiben ermutigt haben.
P. Hans Schaller SJ
30. Juli 2018
Einführung
Briefe sind Selbstmitteilungen. Sie erzählen von dem, was jemand erlebt, auch von dem, was einer glaubt und hofft. Sie tun dies durch die Worte, die aufs Papier kommen, aber auch durch all das, was zwischen den Zeilen schwingt. Durch die Art und Weise, wie geschrieben wird, ob sorgfältig oder schludrig, nicht zuletzt auch durch das, was nicht gesagt ist. Briefe sind in diesem Sinne gesprächig, hin und wieder schwatzhaft, mehr, als dem Schreibenden bewusst ist, unter Umständen auch mehr, als ihm lieb ist.
Briefe können schweigen und können reden, vor allem die handgeschriebenen. Sie erzählen von dem, was man ihnen anvertraut. Es ist dies nicht wenig. Papier nimmt alles auf, errötet nicht, hat keine Angst und schämt sich für nichts.1 Alles, was zum Leben gehört, findet Aufnahme: kleinste Bagatellen, Banalitäten des Alltags, das Wetter, Blumen, Verdauung, aber auch all das, was über den Alltag hinausgeht: Karriere, Zweifel und Sehnsüchte, bis hin zu der alles beherrschenden Frage nach dem Sinn des Lebens. Vielleicht sind die Briefe gerade dafür ein geeignetes Gefäß. Sie sind ein gutes Mittel, um mit nahen und fernen Menschen über solche letzten Fragen in Kontakt zu kommen.
Vielleicht ist uns gerade das Geheimnis des Lebens in Briefform übermittelt! Rilke vergleicht in seinem Brief an einen jungen Dichter jene Menschen, die nie erfahren haben, was ihr Leben im Innersten soll, mit solchen, die zwar einen Brief mit dem Geheimnis ihres Lebens empfangen haben, ihn aber nicht öffnen. Aus Unachtsamkeit, Interesselosigkeit oder auch aus Angst. Sie haben ihn verlegt, werden deshalb nie zu wissen bekommen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. »Dass viele Menschen das Geheimnis des Lebens empfangen wie einen Brief, den sie nicht öffnen, den sie verschlossen lassen, dessen Botschaft sie nie lesen und so verlieren für sich selbst, den sie aber immerhin verschlossen weiterreichen, ohne zu wissen … Vielleicht kommt dieser Brief so zu jemandem, der mutig genug ist, ihn zu öffnen, der es wagt, sich der Botschaft zu stellen …«2
Der ungeöffnete Brief des Lebens! In der Alltagssprache ist dies bekannt als »Annahme verweigert«. Rilke lässt durchblicken, dass dies häufig vorkommt, dass es »viele Menschen« gibt, die dadurch, dass sie ihren Lebensbrief verlegt haben, nie zum Geheimnis ihres Lebens durchdringen. Es sind viele, die ihren Brief nie richtig in die Hand genommen haben, gar nicht zu reden davon, ihn zu lesen und zu durchforschen. – Wer denkt dabei nicht an den bekannten Satz des heiligen Ignatius: »Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich seiner Führung rückhaltlos anvertrauten.«
Nun lässt sich der Gedanke von Rilke leicht in die Welt des Glaubens verlängern und übersetzen. Auch hier geht es darum, das Geheimnis des Lebens zu finden. Dass dies uns in Briefform mitgeteilt wird, ist auch hier nicht fremd. Im zweiten Brief an die Korinther stehen die deutlichen Worte: »Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, angefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern – wie auf Tafeln – in Herzen von Fleisch« (2 Kor 3,3).
Wenn wir diese Worte in unseren Zusammenhang übersetzen, kann dies Folgendes heißen: »Ihr seid ein Brief Christi.« Bei euch in Korinth, in eurem Verhalten kann man sehen, dass ihr einen Brief erhalten habt, der euch das Geheimnis des Lebens klarmachte, ja man sieht, dass ihr diesen Brief geöffnet und aufmerksam gelesen habt. Ihr habt euch seine Botschaft zu Herzen genommen. Man erkennt sogar die Spuren des Absenders. Wenn man auf euch schaut, weiß man, wer euch geschrieben hat, und zwar so deutlich, dass es allen bekannt wird. Dieser Brief, der ihr seid, verdient, verbreitet und weitergereicht zu werden. Ihr seid glaubwürdige Empfänger einer guten Botschaft, seid ein Empfehlungsbrief.
Damit deutlich genug wird, wie dieser »Brief Christi«, den die Korinther darstellen, entstanden ist, nimmt der hl. Paulus die Frage nach der Urheberschaft ausdrücklich auf. Da bleibt für ihn kein Zweifel. Dieser Brief trägt so deutlich die Spur des Absenders, dass es sonnenklar ist, wer hier geschrieben hat. Niemand anderes als Jesus Christus selber. Er in seinem heiligen Geist, dem »Geist des lebendigen Gottes«, schreibt in das Herz der Korinther, und zwar so deutlich und tief, dass seine Handschrift unverwechselbar erkennbar ist. Die eigene Rolle, die Paulus nach seiner eigenen Einschätzung spielt, ist ganz untergeordnet, derjenigen eines Sekretärs vergleichbar.
Briefe Christi! Briefe, die das Geheimnis des Lebens offenbar machen, die zu öffnen und zu lesen sich lohnt und notwendig ist. So kann gläubiges Leben verstanden werden. Wo immer wir uns anschicken, das Leben von Gott her zu verstehen, gleichen wir Empfängern eines göttlichen Briefes, der uns in der Form der Bibel zugänglich ist. Wir lesen und blättern, suchen immer besser zu verstehen, was uns denn gesagt sein soll. Je mehr wir es tun, umso mehr wächst in uns die Überzeugung, dass dieser Brief persönlich gemeint ist, dass er Worte enthält, die direkt unser eigenes Geschick betreffen, die aber auch die Kraft enthalten, es anzunehmen und zu tragen.
1. Aura schreibender Menschen
Der Brief ist kostbar. Er kann Träger lebenswichtiger Mitteilungen sein. – Um zu begreifen, was ihn so bedeutend und wertvoll macht, müssen wir für einen Moment zu seinen Anfängen zurückgehen, zu dem, was im Hand-Schreiben überhaupt passiert. Was geschieht denn mit uns, wenn wir einen Stift in die Hand nehmen, wenn wir Buchstaben auf das Papier setzen?
Ein Griffel in der Hand
Um bei etwas ganz Äußerem zu beginnen: »Das Besondere vom Hand-Schreiben liegt vorerst darin, dass hier buchstäblich Hand angelegt wird.«3 Es sind bei diesem Tun nicht allein die Finger, die beansprucht werden, sondern die ganze Hand, ja sogar der Körper. Der Stift muss richtig angefasst werden, muss gut in der Hand liegen; man muss sich richtig hinsetzen. Nur so wird das, was aufs Papier kommt, lesbar, vielleicht gar schön. So kann auch Freude am Schreiben entstehen.
Die Hände sind beim Schreiben ganz im Dienste des Leibes, ja des ganzen geistigen Menschen. Sie gehorchen unserem Geist und scheinen doch ein Eigenleben zu führen: »Die Hand … ist Tätigkeit; sie ergreift, sie erschafft und manchmal ist man sogar versucht zu sagen, dass sie denkt. Wenn sie ruht, ist sie nicht ein seelenloses Werkzeug, das man auf dem Tisch zurücklässt oder das am Körper entlang herabhängt: Die Gewohnheit, der Instinkt und der Wille zur Tat wachen in ihr, es braucht keine lange Übung, um die Gebärde zu erraten, die sie ausführen wird.«4
Die Hand, die ganze äußere Haltung müssen zum Schreiben vorbereitet und disponiert werden. Dies aber nicht allein. Auch der Geist muss für das Schreiben geordnet werden. Was vor allem nottut, ist die Bereitschaft, sich für diese verlangsamte Bewegung, dieses Nacheinander von Worten, Zeit zu nehmen, sich dafür zu sammeln. Ein Stift in der Hand macht ruhig, konzentriert die Kräfte, lenkt den Blick aufs Papier. Er schafft damit die Voraussetzung, dass Gedanken und Formulierungen entstehen können.
Sehr poetisch und detailliert wird dieses Hand-Anlegen, das beim Schreiben vor sich geht, von Ulla Hahn beschrieben, wenn sie ausführt:
»Seit ich schreiben konnte, liebte ich das lautlose Gleiten meiner Hand über den offen und frei vor mir liegenden Bogen, nichts zwischen der Verwandlung der Schwingungen meiner Nervenzellen in Schwünge auf dem Papier. Ich liebte den Anblick meiner Hand, meiner schreibenden Hand, die Haltung von Daumen, Zeige- und Mittelfinger, die Willfährigkeit des Schreibgeräts. Die Kinderfaust mit dem Griffel auf der Schiefertafel verschwand in der älter werdenden Hand mit dem buntmelierten Federhalter, verschwand in der mit dem Kolbenfüller … Bleistifte lagen in meiner Hand, Kugelschreiber, egal.
Von Anfang an war es mir gleichgültig, womit ich schrieb, allein die Bewegung zählte, das Aufspapierbringen der Buchstaben, Wörter und Sätze. Den Körper verlängern in der Schrift; sein Innerstes nach außen kehren. Gedanken sichtbar machen. Mich schreiben, mich befestigen, Ding-Festmachen … Von Anbeginn war die Schreibmaschine nur ein Ärgernis, ein Hindernis zwischen mir und der Schrift. Es nicht zu überwinden eine Frage der Ehre. Nichts außer meiner Hand sollte meine geliebten Buchstaben hervorbringen. Ich wollte sie nicht an eine Maschine verraten.«5
Ein Stift am Mund
Nicht ohne Grund zeigen Bilder von schreibenden Menschen, wie sie gesammelt sind, wie sie innehalten und still werden. Sie machen den Eindruck, als ob sie auf ihre Gedanken warten müssten, halten den Stift bereit, bis er sich in Bewegung setzt. Die Rede formt sich auf den Lippen.
Schönstes wie auch ältestes Beispiel davon ist das Bild der Sappho, einer bedeutenden Lyrikerin der Antike. Sie wird gezeigt, wie sie den Stift am Munde hält, nach innen lauscht, um auf die Worte zu warten, die sie als Brief auf die Wachstafel schreibt.
Ein Stift am Munde! Eine Geste von Einhalt, Unterbrechung, von Pause. Es wird gewartet, man gibt sich Zeit, damit sich die Gedanken, die wir suchen, einstellen können. Aber auch Gefühle und Emotionen, die an der Wurzel unserer Gedanken sind, müssen inneren Raum haben, damit sie geklärt werden. Wo sie Zeit bekommen, wird es allgemein ruhiger, der Zorn wird gedämpft und das Blut beginnt ruhiger zu fließen. – Aus solchen Erfahrungen mag die Bemerkung von Max Frisch stammen, mit der er sein schriftstellerisches Tun zusammenfasst: »Das war eigentlich immer schon so, dass ich schreibend erst meine Erfahrungen entdeckte.«
Ein Wort auf der Zunge
Nicht immer jedoch hat der Schreibende die nötige Geduld, mit dem Stift am Mund auf die Gedanken zu warten. Oft sind die Gefühle so hitzig und streitbar, dass sie aufs Papier drängen. Sie stürzen wie eine Flut nach außen, müssen niedergeschrieben werden, egal, ob dies schön oder durcheinander gerät. Unausgegoren und ungeordnet fließen sie aufs Papier, breiten sich dort aus und werden sichtbar – Montaigne muss seiner Feder freien Lauf lassen, wenn etwas Schönes entstehen soll: »Diejenigen Briefe, die mir die meiste Mühe kosten, taugen am wenigsten. Sobald ich langsam schreibe, so ist dies ein Zeichen, dass ich meine Gedanken nicht drauf habe; ich fange gern an, ohne vorher zu wissen, was ich schreiben will. Die ersten Gedanken bringen die nächsten hervor.«6
Wie immer wir schreiben, ob schnell oder langsam, wir suchen nach Worten, warten darauf, dass sie sich bilden. Wir erspähen unser Inneres, hoffen auf Licht, Klärung, Sinn. Dass aus dem Durcheinander Ordnung entsteht, vage Gefühle sich in Worten fassen lassen.
Wo wir ausdrücklich Briefe auf das Papier bringen, da erspähen wir nicht bloß unser Inneres, sondern auch das des Adressaten. Die Erkundung des eigenen Selbst weitet sich zu einem Dialog. Briefe sind Gespräche. Sie vermögen diese nicht zu ersetzen, erreichen nie oder nur ganz selten diese Unmittelbarkeit, wie sie spontanem Austausch eigen ist. Sie können das Aug in Aug nicht ersetzen, bleiben ein Notbehelf. Goethe sagt es einmal mehr auf schöne und präzise Weise: »Das Papier ist eine kalte Zuflucht gegen deine Arme.«7
Dennoch hat der Brief wiederum Vorteile, die dem Gespräch abgehen. Nicht nur kann der Brief das Gespräch nicht ersetzen, es gibt auch Dinge, die für die Spontaneität eines Gespräches ungeeignet sind und im Brief besseren Platz finden. Probleme, die man sich mündlich nicht anzusprechen traut, sei es aus Rücksicht oder Scheu oder einfach weil die Situation nicht passt, die jedoch im Brief ruhig Platz finden. Dieser hat eine Vertrautheit, die in der direkten Begegnung nicht immer gegeben ist. Es gibt Worte, Mitteilungen, die einen besonderen Rahmen brauchen, um gesagt werden zu können.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.