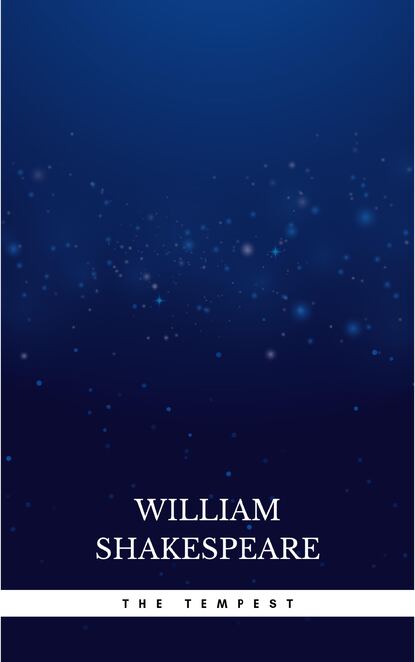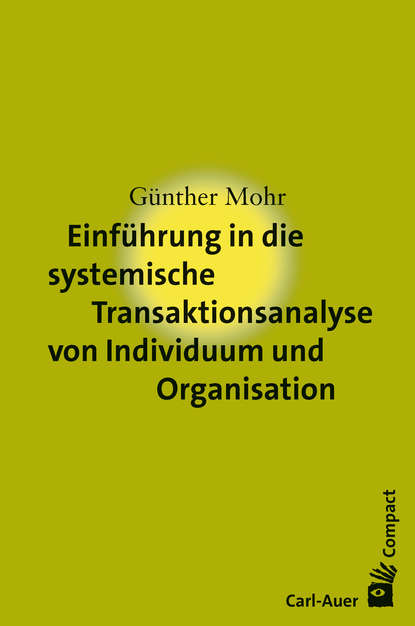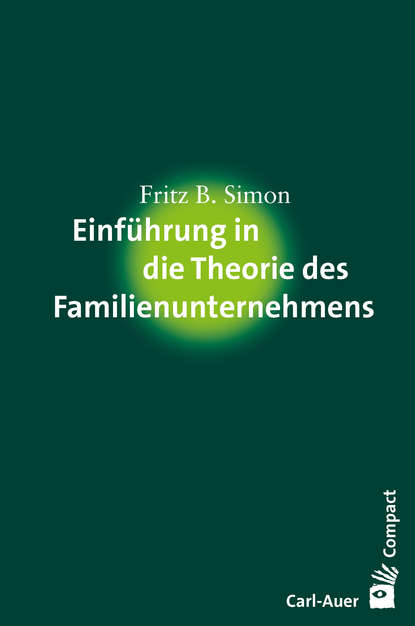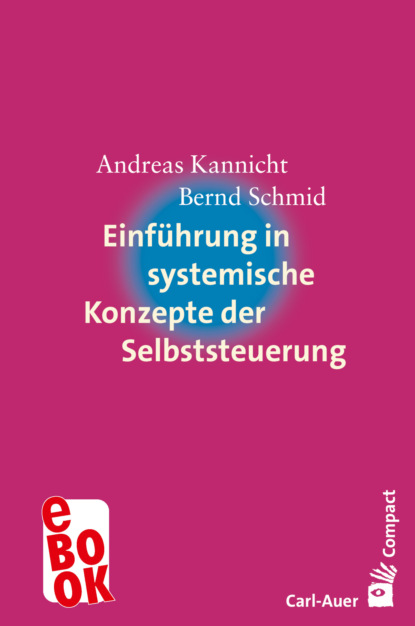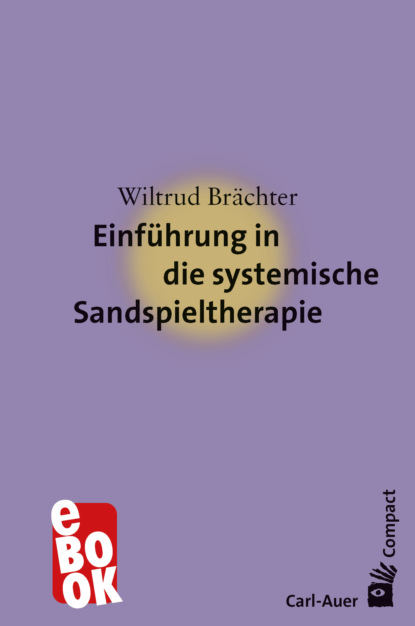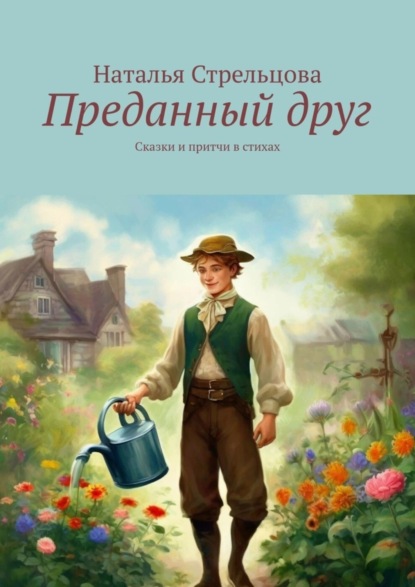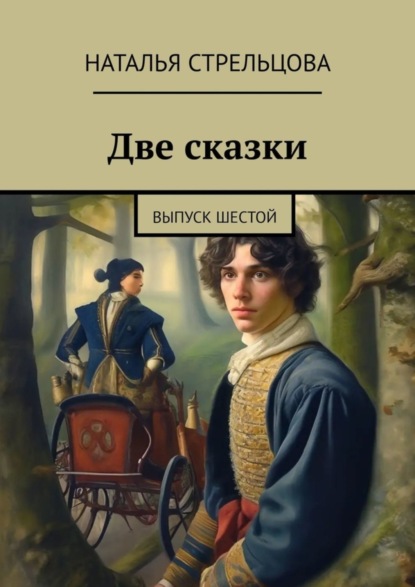Einführung in die Fallbesprechung und Fallsupervision
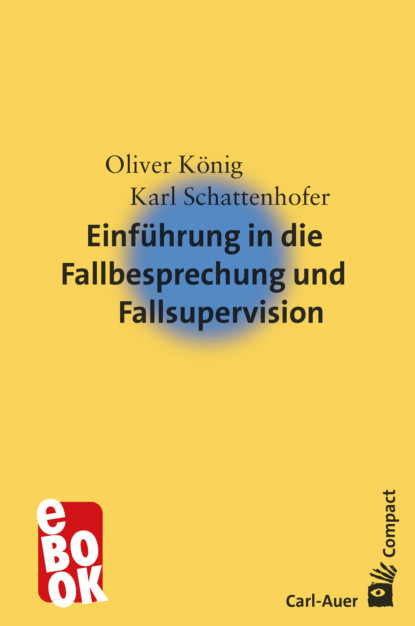
- -
- 100%
- +
1Um die Lesbarkeit zu erhalten, aber gleichzeitig im Hinblick auf Geschlecht sprachsensibel zu sein, haben wir uns entschieden, die männliche und weibliche Form jeweils abwechselnd zu verwenden, außer wenn explizit von Männern oder Frauen die Rede ist.
2Historische Quellen und konzeptionelle Hintergründe
2.1Psychoanalyse und Balint-Gruppen
In Adrian Gärtners historischer Darstellung zur Gruppensupervision (1999, S. 21 ff.) wird eine Arbeit von Sigmund Freud, dem Gründungsvater der Psychoanalyse, als eine Vorform der Fallbesprechung aufgeführt. In der Analyse des kleinen Hans leitet Freud dessen Vater, einen ärztlichen Kollegen, bei der Therapie der Ängste seines Sohnes an. Er lässt sich vom Vater Verhalten und Reaktionen des Sohnes schildern und gibt ihm dann Hinweise für den weiteren Umgang mit dem Sohn. Sicherlich könnte man dies auch als eine frühe Form der Familientherapie mit Vater und Sohn verstehen. Doch »diese merkwürdige Konstellation« gewinnt ihre Bedeutung dadurch,
»dass Freud die therapeutische Zweipersonenbeziehung um ein Verfahren der indirekten Analyse erweitert hat, das dem Modell der Supervisionsbeziehung bereits weitgehend entspricht« (ebd., S. 21).
In dieser Therapie zu dritt bildet sich die Grundkonstellation einer Fallbesprechung ab, auch wenn es nicht so genannt wird: das auf professionelles Handeln bezogene Reden über einen abwesenden Dritten sowie über die Arbeitsbeziehung des einen Gesprächspartners mit diesem Dritten.
Im Zuge der Formalisierung der Ausbildung zur Psychoanalytikerin in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts entsteht daraus die »Kontrollanalyse« mit dem Ziel, die Ausbildungskandidaten in die »richtige« Form der Analyse einzuführen. In ihr müssen angehende Analytikerinnen ihre eigene Arbeit mit einem Patienten einem erfahrenen Kontrollanalytiker vorstellen und sich von ihm beraten und eben auch kontrollieren lassen.
Auch alle weiteren psychotherapeutischen Schulen machten Gruppensupervision, Praxisanleitung und Fallbesprechungen verfahrensübergreifend zum festen Bestandteil ihrer therapeutischen wie beraterischen Aus- und Weiterbildungen. Dort lernen angehende Therapeuten und Beraterinnen, das jeweilige Therapie- oder Beratungskonzept auf den besonderen Einzelfall anzuwenden. Dies geschieht unter der Anleitung von erfahrenen und dazu legitimierten Kolleginnen, die die geschilderten Patienten weder kennen noch mit ihnen direkt zu tun haben.
Mit dem Namen von Michael Balint, einem ungarischen Psychoanalytiker der ersten Stunde, der später in London in der Tavistock-Klinik arbeitete und lehrte, sind die Balint-Gruppen verbunden. Balint berichtet in der Einführung seiner maßgeblichen Publikation zu diesem Thema über ein an der Klinik regelmäßig stattfindendes Forschungsseminar, das sich mit den in der medizinischen Allgemeinpraxis auftauchenden psychologischen Problemen beschäftigte.
»Eines der ersten Themen, die zur Diskussion kamen, betraf die gebräuchlichsten, vom praktischen Arzt besonders oft verschriebenen Medikamente. Und gewiss nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin führte die Diskussion sehr bald zu der Erkenntnis, dass das am allerhäufigsten verwendete Heilmittel der Arzt selber sei. Nicht die Flasche Medizin oder die Tabletten seien ausschlaggebend, sondern die Art und Weise, wie der Arzt sie verschreibe – kurz, die ganze Atmosphäre, in welcher die Medizin verabreicht und genommen werde« (Balint 2019, S. 15),
so sein Motto. Dies brachte ihn zu der Überzeugung, dass der Arzt selber bzw. seine Beziehung zum Patienten das wichtigste Heilmittel sei, eine Haltung die damals wie heute quer zur dominanten Logik des medizinischen Feldes lag und liegt. Für die nach ihm benannten Balint-Gruppen ergab sich daraus die Aufgabe, in einer von einem erfahrenen Arzt geleiteten Gruppe die latenten und unbewussten Themen in der Arzt-Patient-Beziehung herauszuarbeiten und dem jeweils handelnden Arzt bewusst zu machen. Die Gruppenmitglieder wurden aufgefordert, ihre freien Assoziationen zur Verfügung zu stellen, also unzensiert und spontan zu erzählen, was ihnen zur erzählten Situation einfiel. Die so zutage geförderten Ideen sollten ein erweitertes Verständnis ermöglichen dafür, was die Patienten »eigentlich« vom Arzt wollen; z. B., wofür sie ihn halten oder warum sie z. B. mit Abwehr und Widerstand auf die Behandlung reagieren. Balint machte bei dieser Arbeit die Erfahrung, dass sich die Dynamik des Falles in der Gruppe spiegelte und genau diese von den Mitgliedern erlebte Resonanz zum Verstehen des Falles und damit als Arbeitsinstrument genutzt werden konnte. Bis heute ist dieses Vorgehen mit Michael Balint verbunden, und die meisten Konzepte von Fallbesprechungen in Gruppen und Gruppensupervision beziehen sich auf diese Tradition (vgl. Mattke 2006; Rappe-Giesecke 2009; Weigand 2015). In seiner weiteren Entwicklung wurde das Arbeitsmodell der Balint-Gruppe als Ort der Reflexion professioneller Beziehungen auf andere Berufsgruppen ausgeweitet: auf Lehrer, Sozialarbeiter, Psychologen, aber auch auf Juristen und Theologen. Selbst für Führungskräfte und Manager gibt es vereinzelt Balint-Gruppen.
Mit der Ausweitung auf andere Zielgruppen erweiterte und veränderte sich das Konzept. Ursprünglich wurde das gesamte Geschehen in der Balint-Gruppe vor dem Hintergrund eines Falles und der Dynamik der helfenden Beziehung interpretiert. Eine distanzierte, kühle Atmosphäre während der Besprechung in der Gruppe wurde dann z. B. als Hinweis angesehen, dass es zwischen Arzt und Patient ähnlich kühl und distanziert zuging. Dass dies durchaus auch mit der Situation in der Fallbesprechungsgruppe zu tun haben konnte, z. B. mit Konkurrenz unter den Kollegen und Kolleginnen eines Teams, wurde erst mit dem Aufkommen und der Verbreitung gruppendynamischer Ansätze in den 1970er-Jahren mit in die Betrachtung einbezogen. In einer nächsten Konzepterweiterung fand dann – neben Beziehungsdynamik und Gruppendynamik – auch der Einfluss des weiteren Kontextes Beachtung, z. B. die Dynamik einer Organisation mit ihren Rollen, Normen und ihrer Kultur. Die Interpretationsebenen wurden vielfältiger, die entsprechenden Konzepte zur Fallbesprechung komplexer.
2.2Soziale Arbeit und Supervision
Schon früher und unabhängig von Psychoanalyse und Psychotherapie entwickelte sich eine Tradition von Fallarbeit und Fallbesprechung in der sozialen Arbeit. Die Methode des Casework, verstanden als eine gezielte Hilfe für einzelne Familien und ihre Kinder, und eine darauf bezogene Anleitung durch Supervisoren entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA. Eine Pionierin war Mary Richmond mit ihrem 1917 veröffentlichten Buch Social diagnosis. Zentral für die von ihr propagierte psychosoziale Betrachtungsweise war eine Verschränkung von individuellen Faktoren und Umweltfaktoren. In der praktischen Umsetzung bedeutete dies, dass freiwillige und ehrenamtliche Helferinnen als »friendly visitors« (freundliche Besucher) in Not geratene Familien aufsuchten, ihre Situation untersuchten und ihnen Hilfe anboten. Diese Ehrenamtlichen sollten durch hauptamtliche, besser ausgebildete Sozialarbeiterinnen in ihrer Arbeit angeleitet, unterstützt, kontrolliert und supervidiert werden. Das bevorzugte Medium dafür waren Fallbesprechungen und Praxisanleitung. Diese Unterstützung sollte die Ehrenamtlichen dauerhaft für ihre Arbeit motivieren. In Deutschland wurde die am Einzelfall orientierte Sozialarbeit insbesondere durch die Veröffentlichungen von Alice Salomon befördert (vgl. z. B. 1926; vgl. auch Althoff 2020, S. 39 ff.; Belardi 1994, S. 33 ff.; Müller 2013, S. 22 ff.).
Die Weiterentwicklung von sozialer bzw. sozialpädagogischer Diagnose beschäftigt die Sozialarbeit und ihre Leitwissenschaften bis heute. Konzeptionell unterscheiden lassen sich klassifizierende Ansätze, die den einzelnen Fall bestimmten diagnostischen Kategorien zuordnen, um so zu einem Fallverständnis zu kommen, sowie rekonstruktive Ansätze, die den Fall aus seiner eigenen Logik und Dynamik zu verstehen versuchen. In der Praxis finden sich viele Kombinationen beider Vorgehensweisen, die zusätzlich davon profitieren, wenn sie in einer Gruppe durchgeführt werden. So schreibt auch der Gesetzgeber im Kinder- und Jugendhilfegesetz bei der Hilfeplanung und der Hilfeentscheidung das »Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte« gemäß § 36 Abs. 2 SGB VIII vor. Man ist also offensichtlich davon überzeugt, dass durch die Beteiligung mehrerer Fachkräfte bessere Planungen und bessere fachliche Entscheidungen zustande kommen als durch Einzelne (vgl. Ader u. Schrapper 2020). Häufig wird dieses Zusammenwirken bei Fallbesprechungen oder kollegialen Beratungen organisiert.
Parallel zu dieser Entwicklung sind im deutschsprachigen Raum aus der fallbezogenen Praxisanleitung und Praxisberatung die Supervision und vor allem die Gruppensupervision hervorgegangen. Zunächst wurde diese Tätigkeit weitgehend noch von erfahrenen Sozialarbeitern ausgeübt. Erst ab den 1970er-Jahren entstanden eigene Ausbildungsgänge, die die Praxisanleiterinnen besonders qualifizieren sollten. Das sich allmählich professionalisierende Format »Supervision« bediente sich dabei unterschiedlicher Verfahren, z. B. Psychoanalyse, humanistischer Psychologie, angewandter Sozialpsychologie und Gruppendynamik sowie systemischer Ansätze oder integrierte sie in unterschiedlichen Kombinationen zu einem Arbeitsmodell. 1989 wurde von den Trägern der entsprechenden Weiterbildungen die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching e. V. (DGSv) gegründet, die zum führenden Fach- und Berufsverband für Supervisoren und Supervisorinnen wurde. Während anfangs Gruppensupervision und Fallbesprechungsarbeit in der fachlichen Diskussion im Vordergrund standen (vgl. z. B. Gärtner 1999; Rappe-Giesecke 2009), gelangten später zunehmend Team- und organisationsbezogene Supervision in die Aufmerksamkeit. Fallbesprechungen gehören zwar weiterhin zum Grundrepertoire von Supervision, aber als eigene Form fanden sie wenig Aufmerksamkeit.
Seit den 1990er Jahre entstanden viele Konzepte kollegialer Beratung, auch als Intervision, kollegiale Supervision oder kooperative Beratung bezeichnet. Ohne die Begleitung einer externen Leiterin beraten und unterstützen sich Therapeuten, Sozialpädagoginnen, Lehrer, Führungskräfte, Projektleiterinnen, Personal- und Organisationsentwickler etc. gegenseitig bei ihrer Arbeit. Die entsprechenden Publikationen formulieren zumeist einen Leitfaden oder ein Ablaufschema, nach dem Fälle ohne fachliche Leitung bearbeitet werden können. Die Konzepte sind zwar auf die Bearbeitung beruflicher Problemsituationen ausgerichtet, der jeweilige Fall als selbst erlebte berufliche Interaktion wird in den Darstellungen aber kaum erwähnt. Im Zentrum stehen mit ihren Fragen die Professionellen selbst, das Verstehen der jeweiligen Klienten tritt in den Hintergrund. Zumeist gibt diese Literatur zwar Auskunft darüber, wie man bei der Beratung in der Gruppe vorgehen sollte, was man bei der Gestaltung berücksichtigen sollte und welche Methoden man anwenden kann. Wie in diesen Gruppen tatsächlich gearbeitet wird, erschließt sich den Leserinnen aber wenig bis gar nicht (vgl. z. B. Schlee 2019; Mutzek 2014; Tietze 2010b; Lippmann 2013).
2.3Qualitative Sozialforschung und Fallbesprechungen
Schon in den genannten Traditionen von Psychoanalyse und Sozialer Arbeit ging und geht es um methodisch kontrolliertes Fremdverstehen. Entscheidende Entwicklungsimpulse für eine theoretische und konzeptionelle Weiterentwicklung ergaben sich seit den 1960er-Jahren durch die Ausformulierung eines interpretativen Paradigmas (vgl. Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen 1981) in den Sozialwissenschaften, durch das die qualitative Sozialforschung entscheidende Impulse bekam (vgl. Althoff 2020, S. 272 ff.). Das qualitative Forschungsverständnis und die damit verbundenen Methoden der Datenerhebung und Dateninterpretation helfen dabei zu verstehen, was bei Fallbesprechungen geschieht.
Genauso wie eine Fallbesprechung zielt qualitative Forschung darauf ab, den Sinn eines Einzelfalles zu rekonstruieren. Im Unterschied zur Fallbesprechung tut sie dies aber in der Absicht, über den Einzelfall hinausgehende (theoretische) Aussagen über die zugrunde liegende Strukturiertheit sozialer Praxis zu formulieren. Fallbesprechungen verallgemeinern nicht, höchstens insoweit, als geprüft wird, was aus dem Verständnis des einen Falles eventuell für das Verständnis anderer ähnlicher oder kontrastierender Fälle gewonnen werden kann.
Fallbesprechungen und qualitative Forschungsdesigns zielen beide auf die Analyse von sozialen Praktiken und sozialem Handeln ab. Beide bedienen sich dabei bereits vorliegender Daten (z. B. Dokumenten und Schriftstücken jeglicher Art), oder sie erheben diese Daten in irgendeiner Weise (z. B. in Interviews und/ oder durch Beobachtungen). In der qualitativen Sozialforschung werden am häufigsten Texte ausgewertet, die aus der Abschrift von Tonaufnahmen entstanden sind: Aufnahmen von Interviews, Gruppendiskussionen, Therapie- und Beratungssitzungen oder auch Fallbesprechungen. Qualitative Forschung schafft dadurch Distanz zur untersuchten sozialen Praxis. Der Forschende, der dieses Material auswertet, muss selber gar keinen Kontakt zur Praxis gehabt haben, auch ist der Untersuchung keine enge zeitliche Grenze gesetzt, die interpretative Bearbeitung kann in mehreren Durchgängen erfolgen.
Eine Fallbesprechung schafft ebenfalls Distanz zu der untersuchten sozialen Praxis durch ein abgegrenztes Beratungssystem, in dem aber ein Teil der zu untersuchenden Praxis, nämlich die falleinbringende Person, enthalten ist (vgl. Kap. 3). In einer Fallbesprechung geht es darum, Ideen zu entwickeln, wie es weitergehen soll mit und in der untersuchten Praxis. Der Prozess der Rückkoppelung mit der Praxis beginnt noch in der Untersuchungssituation selber, während er sich in einem wissenschaftlichen Forschungskontext über Jahre erstreckt – wenn der Prozess denn überhaupt stattfindet.
So gesehen, sind Fallbesprechungen in ihren Ansprüchen bescheidener als Forschung – und als Forschungssituation zugleich komplexer. Denn anders als im Studierzimmer der Forschung bleibt das Material nicht brav als Text auf dem Papier, sondern die Daten können einem schon einmal um die Ohren fliegen, manchmal kann sogar der Forschungsgegenstand in Person des Falleinbringers unmittelbar Widerspruch gegen die Ergebnisse einlegen. Auch die qualitative Forschung sucht gegebenenfalls eine Rückkoppelung ihrer Ergebnisse mit der Praxis, kommunikative Validierung genannt; die gewonnenen Hypothesen werden den untersuchten Personen vorgelegt und mit ihnen diskutiert, die Ergebnisse in dem dann wieder getrennten Forschungskontext verarbeitet. In einer Fallbesprechung geschieht diese kommunikative Validierung prozesshaft, d. h. von Anfang an und ständig. Untersuchungsobjekte sind immer zugleich auch Untersuchungssubjekte. Fallbesprechungen stehen damit in der Tradition der Aktionsforschung (Moser 1978).
Die Vor- und Nachteile dieser Nähe-Distanz-Regulierung bei Fallbesprechungen liegen auf der Hand. Sie sind in der Gefahr, an der Überkomplexität ihrer Forschungssituation zu scheitern. Die Falldynamik kann sich im Prozess ihrer Untersuchung unbesehen und unverstanden fortsetzen. Die durch den Fall freigesetzten Gefühle können eine reflexive Distanz zur Praxis erheblich erschweren.
Die Auseinandersetzung mit den auftauchenden Gefühlen gehört in der Fallbesprechung zum Konzept, weil Fallbesprechungen in der Praxis für die Praxis arbeiten und Emotionalität nun einmal ein zentraler Bestandteil dieser Praxis ist. Sie kann dabei auf eine eigene praxiswissenschaftliche Tradition zurückgreifen, insbesondere aus der Sozialen Arbeit, der Psychoanalyse und der Aktions- und Handlungsforschung (Wensierki 1997). Gelingt es mit diesen methodischen Hilfen, die auftauchenden Emotionen für ein Verständnis des Falles zu nutzen, entsteht ein echter Mehrwert.
Qualitative Methoden wiederum sind heute aus der Erforschung psychosozialer Praxis, sei es Beratung, Psychotherapie oder Supervision, nicht mehr wegzudenken. Zunehmend werden sie von Praktikern dafür genutzt, die eigene Arbeit nochmals besser und anders zu verstehen. Mithilfe von Bandaufnahmen bzw. der Abschriften dieser Aufnahmen und der Interpretation dieses Materials mit den Mitteln der qualitativen Sozialforschung kann man ausgezeichnet dem komplexen Geschehen in Fallbesprechungen auf die Spur kommen. In Kapitel 7 werden wir das beispielhaft vorführen.
2.4Grundprinzipien qualitativer Forschung und ihre Bedeutung für Fallbesprechungen
Wenn von qualitativer Forschung, vom qualitativen oder interpretativen Paradigma, von rekonstruktiver Sozialforschung (Bohnsack 2021; Mayring 2016) die Rede ist, dann ist eine Vielzahl von sozialwissenschaftlichen Traditionen und Ansätzen angesprochen. Über alle Unterschiede hinweg gibt es geteilte Prämissen, die wir im Folgenden auf Fallbesprechungen übertragen wollen. Wir finden hier eine Antwort auf die Frage: Was wird verstanden, wenn in einer Fallbesprechung die Erzählung des Falleinbringenden untersucht und vervollständigt wird?
Ausgangspunkt ist die Annahme, dass die Menschen im Alltag die Umwelt und Mitwelt um sie herum in einem ständigen Prozess interpretieren und deuten. Dies folgt den Annahmen eines sozialen Konstruktivismus (grundlegend dazu Berger u. Luckmann 2013), weil uns die Welt nie unmittelbar zugänglich ist, sondern wir sie in unserer jeweiligen Wahrnehmung erst zu dem machen, was sie dann für uns ist. Wir tun dies aber nicht beliebig, sondern greifen dazu auf die Kategorien, Begriffe, Muster, Regeln etc. zurück, die uns unsere jeweilige gesellschaftliche Umwelt zur Verfügung stellt. Wir nutzen nicht nur unsere individuellen Vorerfahrungen, sondern über eingespeichertes Wissen auch die Erfahrungen unserer Mitwelt, d. h. unseres sozialen und kulturellen Umfeldes, in dem wir aufgewachsen sind, inklusive der Generationen vor uns. Dieses praktische Wissen ist den Handelnden zumeist nicht reflexiv zugänglich, es bleibt implizit. Sie folgen diesem Wissen, ohne es benennen zu können, so wie wir auch sprechen, ohne uns über die zugrunde liegende Grammatik Gedanken zu machen.
Der Verstehensprozess befasst sich also mit einem immer schon verstandenen Gegenstand, in der Sprache der qualitativen Forschung: mit Konstruktionen ersten Grades. Die Fallarbeit hat es mit Menschen zu tun, die sich ihrerseits einen Reim auf die Dinge gemacht haben, auch wenn er manchmal auf den ersten Blick absonderlich anmutet. Wenn man versucht, die Sinnhaftigkeit dieses alltagspraktischen Verstehens zu rekonstruieren, also seinerseits in seiner Logik zu verstehen, warum eine Person etwas gerade so versteht, wie sie es versteht, und nicht anders, so spricht man von Konstruktionen zweiten Grades.
Um sie zu rekonstruieren, arbeitet man systematisch die Kontextualität von Daten, Informationen und Erzählungen heraus, indem man danach fragt, vor welchem Hintergrund die gemachten Aussagen, d. h. die Konstruktionen ersten Grades, überhaupt erst einen Sinn ergeben.
Der Verstehensprozess zielt darauf ab, die Menschen in ihrer Ganzheit zu erfassen und nicht vorschnell einzelne Aspekte zu isolieren. Dem analytischen Denken, d. h. dem Zerlegen in einzelne Bereiche und Themenfelder, tritt eine ganzheitliche Betrachtung an die Seite, die das so Getrennte wieder zusammenführt. Eine untersuchte Person ist zudem immer auch in ihrer Historizität zu sehen, in ihrem biografischen Lebensvollzug und Gewordensein, eingebettet in eine spezifische soziale, kulturelle und historische Lebenslage. Dieser Blick in die Vergangenheit verbindet sich mit der Annahme einer prinzipiell offenen Zukunft, selbst wenn sie in vielerlei Hinsicht eingeengt erscheint. Der Verstehensprozess arbeitet daher auch nicht mit der Idee allgemeingültiger sozialer Gesetzmäßigkeiten, sondern bevorzugt die Vorstellung, dass unser Denken und Handeln von Regeln und Strategien geleitet ist, die situationsspezifisch zur Anwendung kommen. Sie gilt es zu verstehen.
Damit man diesen Grundannahmen im Verstehensprozess gerecht werden kann, wird seine Offenheit zum leitenden Prinzip. Die Forschenden gehen in einen discovery mode, in eine entdeckende Haltung, die den untersuchten Personen gegenüber eingenommen wird. Damit ein Fall in seiner Eigenheit zur Darstellung kommen kann, wird daher eine Gesprächssituation geschaffen, in der die Falleinbringenden erzählen können, was und wie sie es wollen und können, sodass sich ihre Art der Darstellung des Falles entfalten kann. In der Anfangsphase der Erzählung z. B. sollte es daher möglichst wenige Unterbrechungen geben. Die Kunst des Fragens, die in der qualitativen Forschung zu sehr ausdifferenzierten Frageformen geführt hat (vgl. Helfferich 2021, S. 90 ff.), ist in der Fallbesprechung von großer Bedeutung. Es kommt darauf an, möglichst wenige Unterstellungen und Vorannahmen in den Fragen zu verpacken. Die Erzählenden sollen vielmehr anregt werden, die eigene Erzählung zu ergänzen, sie mit weiteren Details und bislang nicht berücksichtigten Aspekten zu versehen.
Was die an Fallbesprechungen Teilnehmenden von qualitativer Forschung insbesondere lernen können, ist das Gestalten von Interviews, speziell anhand des narrativen Interviews (Mayring 2016, S. 54 ff.). Dieses Interview zeichnet sich dadurch aus, dass eine Eingangsfrage formuliert wird, die konkret genug ist, damit eine Antwort erfolgt, aber offen genug, sodass die befragte Person möglichst wenig festgelegt wird, in welcher Art sie antwortet. Die Kunst des Interviewenden besteht darin, diesen Erzählstimulus aufrechtzuerhalten.
2.5Hypothesenbildung unter Handlungsdruck
Ziel und Zweck von Fallbesprechungen und qualitativer Sozialforschung ist zuallererst die Entwicklung von Hypothesen zum Fall, also das Fallverstehen. Ungleich der Situation qualitativer Forschung steht sie dabei aber zumeist unter dem Druck, vor dem Hintergrund dieses neuen Verständnisses auch neue Handlungsoptionen für die falleinbringende Person zu entwickeln. Diese beiden Ziele in Einklang zu bringen ist in Fallbesprechungen eine Aufgabe eigener Art. Schiebt sich der Handlungsdruck zu sehr in den Vordergrund, verliert die Fallbesprechung gerade die Distanz zur Praxis, die es für ein neues Verständnis braucht. Wird die Handlungsebene zu sehr vernachlässigt, wird der Falleinbringer mit seinem Handlungsdruck alleine gelassen und damit die Zweckmäßigkeit der Fallbesprechung infrage gestellt.
Eine Konsequenz des stärkeren Handlungsdrucks bei Fallbesprechungen ist es, dass sie in ihrer Rekonstruktionsarbeit stärker als qualitative Forschungsansätze auf bestehendes Wissen zurückgreifen (müssen). Je mehr und je früher dies getan wird, umso mehr bewegen sich Fallbesprechungen im Rahmen eines klassifizierenden Verfahrens. In der sozialpädagogischen Diagnostik, einem der klassischen Anwendungsfelder von Fallbesprechungen, wird diese Unterscheidung zwischen rekonstruktiven und klassifizierenden Verfahren seit vielen Jahren diskutiert (Ader u. Schrapper 2020). Während Erstere strikt am Material entlang ihre Hypothesen zu entwickeln versuchen, arbeiten Letztere mit festen Rastern, z. B. mit Erhebungsbogen und diagnostischen Schemata. Sie erleichtern, gerade unter Zeitdruck, eine erste Einschätzung, bringen relevante Fragen ins Blickfeld. Zugleich sind sie immer in der Gefahr, das Besondere eines Falles zu verfehlen. Für Fallbesprechungen bedeutet dies, dass eine jeweils passende Balance gefunden werden muss zwischen der Arbeit am vorliegenden Material und dem Rekurs auf Wissensbestände, vor deren Hintergrund dieses Material interpretiert werden kann.