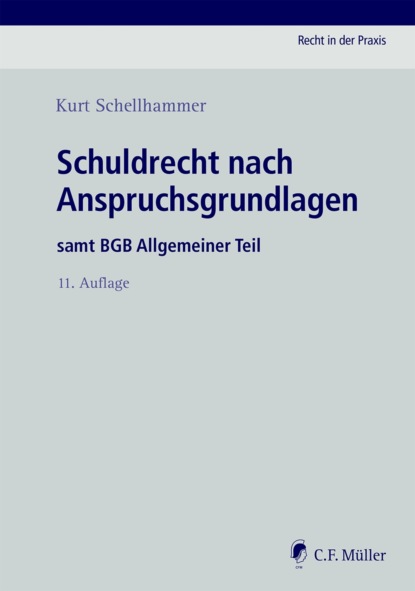- -
- 100%
- +
Die Höhe des Mietzinses soll wie jede schuldrechtliche Leistung bestimmbar sein[41]. Der Mietvertrag muss sie aber nicht selbst bestimmen, sondern kann die Bestimmung nach §§ 315 ff. einer Partei oder einem Dritten überlassen, muss freilich den Maßstab dafür vorgeben[42]. Vereinbaren die Parteien eine „angemessene Miete“, bestimmt letztlich das Gericht die Höhe[43].
Beispiel
Die Parteien sind Schwestern. Die Klägerin ist Eigentümerin eines Wohnhauses, die Beklagte bewohnt einen Anbau, für dessen Errichtung sie 115 000,– DM an die Klägerin gezahlt hat. Die Klägerin klagt auf Räumung und Herausgabe des Anbaus.
Die Entscheidung richtet sich nach Mietrecht, denn zwischen den Parteien besteht ein Wohnmietverhältnis. Die Höhe des Mietzinses, der mit der Vorauszahlung der Beklagten zu verrechnen ist, wurde zwar nicht ausdrücklich vereinbart, lässt sich aber durch ergänzende Vertragsauslegung oder analog §§ 612 II, 632 II als üblichen oder angemessenen Mietzins bestimmen. Soweit die Vorauszahlung noch nicht abgewohnt ist, hat die Klägerin sie der Beklagten bei deren Auszug zu erstatten (BGH NJW 2003, 1317).
Zusätzliche Kosten des Mieters über § 535 hinaus muss der Mietvertrag auch der Höhe nach eindeutig regeln[44].
1.2 Die Mietbremse
179a
Dies Mietrechtsnovellierungsgesetzt vom 21.4.2015 (BGBl I, 610) begrenzt mit den §§ 556d–556g seit 1.6.2015 die Höhe des Mietzinses für Wohnraum schon bei Mietbeginn[45], freilich nur in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung bestimmt werden. Das Mietrechtsanpassungsgesetz vom 18.12.2018[46] und das Gesetz über die zulässige Miethöhe vom 19.3.2020 ergänzen den § 556g.
Die gutgemeinte, aber komplizierte Mietbremse[47] sieht so aus: Nach § 556d darf die Miete schon zu Beginn des Wohnmietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete des § 558 II höchstens um 10 % übersteigen (I). Die Landesregierungen werden ermächtigt, Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt auf jeweils längstens 5 Jahre zu bestimmen (II 1 mit näherer Bestimmung des angespannten Wohnungsmarktes in II 2, 3 sowie Fristablauf und Begründung der Rechtsverordnung in II 4-7)[48]
§ 556e erlaubt, wenn der Vormieter eine höhere Miete schuldete, die Vereinbarung einer Miete bis zur Höhe der Vormiete (I 1). Bei der Ermittlung der Vormiete bleiben unberücksichtigt Mietminderungen sowie Mieterhöhungen, die mit dem Vormieter im letzten Jahr vor Mietende vereinbart wurden (I 2). Modernisierungsmaßnahmen in den letzten drei Jahren vor Mietbeginn erhöhen die nach § 556d I zulässige Miete in bestimmter Höhe (II).
Nach § 556f ist § 556d nicht anwendbar auf Wohnungen, die erstmals nach dem 1.10.2014 genutzt und vermietet wurden (S. 1), und die §§ 556d, 556e sind nicht anwendbar auf die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung (S. 2).
§ 556g I regelt die Rechtsfolgen der Mietbremse. Eine Vereinbarung, die von §§ 556d-556g abweicht, ist unwirksam (S. 1). Jedoch bleibt der Mietvertrag im Übrigen bestehen, wenn nur die zulässige Miete überschritten wird (S. 2). Zu viel bezahlte Miete hat der Vermieter dem Mieter als ungerechtfertigte Bereicherung zu erstatten (S. 3), jedoch sind die §§ 814, 817 S. 2 nicht anzuwenden (S. 4).
§ 556g Ia verpflichtet den Vermieter, soweit die Miethöhe nach § 556e oder § 556f zulässig ist, dem Mieter, bevor er seine Vertragserklärung abgibt, unaufgefordert Auskunft in vier Varianten zu erteilen (S. 1).
Soweit der Vermieter die Auskunft nicht erteilt, kann er sich nicht darauf berufen, dass die Miete nach § 556e oder § 556f zulässig sei (S. 2). Und wenn er die Auskunft in der vorgeschriebenen Form nachholt, darf er sich erst zwei Jahre danach auf eine nach § 556e oder § 556f zulässige Miete berufen (S. 3). Entbehrt die Auskunft aber der vorgeschriebenen Form, darf der Vermieter sich erst nach formgerechter Nachholung auf § 556e oder § 556f berufen (S. 4).
Der Mieter darf nach § 556g II eine Miete, die er nach §§ 556d, § 556e nicht geschuldet hat, nur zurückfordern, wenn er einen Verstoß gegen die §§ 556d–556g gerügt hat (S. 1). Hat der Vermieter eine Auskunft nach § 556g Ia 1 erteilt, muss die Rüge des Mieters sich darauf beziehen (S. 2). Und rügt der Mieter den Verstoß erst mehr als 30 Monate nach Mietbeginn oder ist das Mietverhältnis bei Zugang der Rüge schon beendet, kann er nur die Miete zurückfordern, die erst nach Zugang der Rüge fällig geworden ist (S. 3).
§ 556g III verpflichtet den Vermieter auf Verlangen des Mieters zur Auskunft über die Tatsachen, welche die vereinbarte Miete zulässig machen.
Nach § 556 IV bedürfen alle Erklärungen nach Ia–III der Textform.
2. Die Entstehung und Fälligkeit des Mietzinsanspruchs
180
Nach § 556b I ist der Mietzins für Wohnraum und nach § 579 II auch für andere Räume, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, im Voraus spätestens bis zum 3. Werktag derjenigen Periode zu zahlen, nach der er vertraglich bemessen ist[49].
Als Verbraucher zahlt der Wohnungsmieter bargeldlos dann rechtzeitig, wenn er seine Bank rechtzeitig mit der Überweisung beauftragt und sein Konto gedeckt ist; die strenge Zahlungsverzugsrichtlinie der EU vom 26.2.2011 gilt nur für Entgelte im Geschäftsverkehr[50].
Dagegen ist der Mietzins für ein Grundstück oder eine bewegliche Sache gemäß § 579 I erst am Ende der Mietzeit oder nach Ablauf der Rechnungsperiode zu zahlen, nach der er vertraglich bemessen ist, die Grundstücksmiete vierteljährlich, wenn sie nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist.
Laut BGH entsteht der periodisch fällige Anspruch auf den Mietzins nicht insgesamt schon mit Abschluss des Mietvertrags, sondern regelmäßig wiederkehrend erst mit Beginn oder Ende des jeweiligen Zeitabschnitts, nach dem er bemessen ist. Er ist deshalb nicht betagt, sondern befristet; das ist wichtig für die Vorausabtretung künftiger Mietzinsforderungen[51]. Die §§ 556b I, 579 regeln demnach nicht erst die Fälligkeit, sondern schon die Entstehung des Mietzinsanspruchs.
Nach § 259 ZPO darf der Vermieter auf künftige Mietzinszahlung klagen, wenn der Mieter mit der Miete oder den Nebenkosten in mehrfacher Höhe der Bruttomiete im Rückstand ist[52].
Der Mietzinsanspruch lässt sich ohne weiteres aus dem Mietverhältnis herauslösen und separat nach § 398 abtreten[53].
Für den hilfsbedürftigen Wohnungsmieter kann das Jobcenter (Sozialamt) die Miete direkt an den Vermieter zahlen[54].
3. Die Staffel- und die Indexmiete
181
Nach § 557 II kann der Wohnungsmietvertrag den Mietzins für bestimmte Zeiträume in unterschiedlicher Höhe festlegen, entweder als Staffel- oder als Indexmiete, und so der Inflation und dem Geldwertschwund vorbeugen.
§ 557a erlaubt die Staffelmiete unter folgenden Bedingungen:
- schriftliche Vereinbarung der unterschiedlichen Geldbeträge (I); - stabiler Mietzins für jeweils mindestens ein Jahr und Ausschluss einer Mieterhöhung gemäß §§ 558-559b während der Laufzeit der Staffelmiete (II); - Ausschluss des Kündigungsrechts des Mieters für höchstens vier Jahre und Kündigung frühestens nach vier Jahren (III)[55]; - Anwendung der §§ 556d-556g zur Mietbremse (IV).Die wirksam vereinbarte Staffelmiete ist auch dann verbindlich, wenn das allgemeine Mietniveau plötzlich absinkt[56].
Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters sind unwirksam (V)[57].
§ 557b erlaubt die Indexmiete, die den Mietzins durch den Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland bestimmt, unter folgenden Bedingungen:
- schriftliche Vereinbarung (I); - unveränderte Miethöhe für jeweils mindestens ein Jahr vorbehaltlich der §§ 559-560 und Beschränkung der Mieterhöhung nach § 559 während der Laufzeit der Indexmiete (II), - Verlangen der geänderten Miethöhe in Textform (III)[58]; - Anwendung der §§ 556d-556g zur Mietbremse nur auf die Ausgangsmiete (IV).Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters sind unwirksam (V)
4. Die Mieterhöhung
182
Nach § 557 I dürfen Vermieter und Mieter auch die Wohnraummiete vertraglich erhöhen[59]. Schon der Mietvertrag kann nach §§ 557 II, 557a, 557b den Mietzins durch Vereinbarung einer Staffel- oder Indexmiete für die Zukunft ändern (RN 181).
Einseitig darf der Vermieter eine Mieterhöhung nur nach § 557 III verlangen, soweit dies nicht vertraglich ausgeschlossen ist. Er hat zwei Möglichkeiten: nach § 558 kann er eine Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen und nach § 559 eine Mieterhöhung nach Modernisierung der Wohnung. Die umfangreichen §§ 558-561 in der Fassung durch das Mieterhöhungsanpassungsgesetz von 18.12.2018[60] und das Gesetz über die zulässige Miethöhe von 19.3.2020 regeln die Einzelheiten.
Nach § 558 I kann der Vermieter vom Mieter verlangen, dass er einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zustimmen, wenn die bisherige Miete zur Zeit der Mieterhöhung seit 15 Monaten unverändert ist (S. 1)[61]. Die Mieterhöhung kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung verlangt werden (S. 2). Erhöhungen nach §§ 559–560 werden nicht berücksichtigt (S. 3). Aus welchen Faktoren die ortsübliche Vergleichsmiete gebildet werde, regelt § 558 II[62].
Durch die Erhöhung nach § 558 I darf sich die Miete gemäß § 558 III binnen 3 Jahren, abgesehen von Erhöhungen nach §§ 559-560 um höchstens 20 % erhöhen (Kappungsgrenze)[63], jedoch um höchstens 15 %, wenn die Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen besonders gefährdet ist, was die Landesregierung durch Verordnung für höchstens 5 Jahre bestimmen darf. Ausnahmen von der Kappungsgrenze macht § 558 IV. Drittmittel sind nach § 558 V vom Jahresbetrag der zu erhöhenden Miete abzuziehen[64].
Das Mieterhöhungsverlangen bedarf nach § 558a der Textform (I ) und ist zu begründen (I–IV)[65].
§ 558b regelt die Rechtsfolgen des Mieterhöhungsverlangens[66]. Soweit der Mieter zustimmt, schuldet er die erhöhte Miete ab Beginn des 3. Kalendermonats nach Zugang des Erhöhungsverlangens (I). Soweit der Mieter nicht bis zum Ablauf des 2. Kalendermonats zustimmt, kann der Vermieter den Mieter auf Zustimmung verklagen und muss die Klage binnen weiterer drei Monate erheben (II). Wenn das Erhöhungsverlangen nicht dem § 558a entspricht, kann der Vermieter den Mangel noch im Rechtsstreit beheben (III). Die §§ 558a, 558b sind anspruchsbegründend[67].
Die §§ 558c–558e sind Hilfsnormen zum Mietspiegel, zum qualifizierten Mietspiegel und zur Mietdatenbank, welche die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete erleichtern sollen[68].
§ 559 berechtigt den Vermieter, nachdem er Modernisierungsmaßnahmen des § 555b Nr. 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt hat, die jährliche Miete um 8 % der aufgewendeten Kosten zu erhöhen (I). Erforderlich sind eine Modernisierung und bauliche Veränderung durch nachhaltige Einsparung von Energie, durch Reduzierung des Wasserverbrauchs, durch Erhöhung des Gebrauchswertes der Mietsache, durch Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse oder durch bauliche Veränderungen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat und die keine Erhaltungsmaßnahmen sind[69]. Kosten für Erhaltungsmaßnahmen gehören nicht dazu (II). Werden mehrere Wohnungen modernisiert, sind die Kosten angemessen auf die einzelnen Wohnungen zu verteilen (III). Die Erhöhung der jährlichen Miete ist begrenzt (III a). Sie ist ausgeschlossen, soweit sie den Mieter unbillig hart treffen würde (IV, V)[70].
Drittmittel sind nach § 559a keine Modernisierungskosten (I mit Sonderregeln für öffentliche Darlehen in II und Mieterdarlehen in III).
Die Mieterhöhung ist dem Mieter nach § 559b in Textform zu erklären (I 1) und nur wirksam, wenn sie die Erhöhung begründet und entsprechend §§ 559, 559a erläutert (I 2). § 556c III ist entsprechend anzuwenden (I 3). Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit Beginn des dritten Monats ab Zugang der Erklärung (II 1 mit Fristverlängerung in II 2).
§ 559c regelt in fünf gewichtigen Absätzen ein „vereinfachtes Verfahren“ zur Mieterhöhung.
§ 559d vermutet, dass der Vermieter unter bestimmten Voraussetzungen seine Pflichten aus dem Schuldverhältnis verletze (I mit Ausnahme in II).
Nach § 561 I muss der Mieter einer Mieterhöhung durch den Vermieter gemäß § 559 nicht tatenlos zusehen, sondern darf das Wohnmietverhältnis bis zum zweiten Monat nach Zugang der Erklärung des Vermieters zum Ablauf des übernächsten Monats außerordentlich kündigen und die Mieterhöhung unwirksam machen.
Die §§ 557–561 sind nach § 549 II, III auf den dort beschriebenen Wohnraum nicht anwendbar.
Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters sind nach §§ 557 IV, 558 VI, 558a V, 558b IV, 559 VI, 559a V, 559b III und 561 II unwirksam.
5. Die Betriebskosten der Mietsache
5.1 Die Vereinbarung über die Betriebskosten
183
Laut Gesetz schuldet der Mieter nur den Mietzins und bleiben die Betriebskosten der Mietsache am Vermieter hängen. Im Mietvertrag jedoch wälzt der Vermieter die Betriebskosten meist auf den Mieter ab[71].
Das ist in bestimmtem Umfang auch für das Wohnraummietverhältnis erlaubt: § 556 regelt den zulässigen Inhalt der Vereinbarung und die Abrechnung, § 556a liefert den Maßstab für die Umlegung der Betriebskosten.
Nach § 556 darf der Vermieter Betriebskosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen[72], vertraglich, auch vorformuliert, auf den Wohnungsmieter umlegen (I 1, 2)[73], entweder als Pauschale oder als angemessene Vorauszahlung (II)[74]. Für die Aufstellung der Betriebskosten gilt die Betriebskostenverordnung vom 25.11.2003 (BGBl I, 2346, 2347) fort, bis die Bundesregierung durch Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt (I 3, 4).
Wie die Betriebskosten umzulegen sind, sagt § 556a: nicht nach der Zahl der Bewohner, sondern nach dem Anteil der Wohnfläche (I 1), Verbrauchskosten aber nach dem Verbrauch (I 2)[75]. Die abweichende Vereinbarung geht vor[76], jedoch darf der Vermieter für die Zukunft in Textform eine Umlegung nach dem Verbrauch oder der Verursachung bestimmen (II). Ist eine Umlegung nach der Wohnfläche vereinbart, trägt der Vermieter den Anteil der Betriebskosten, der auf eine leer stehende Wohnung entfällt[77].
Wenn der Mieter die Betriebskosten für Heizwärme und Warmwasser trägt, darf der Vermieter von der Eigenversorgung zur Fremdversorgung durch einen Wärmelieferanten wechseln und die Kosten dem Mieter aufbürden; die Einzelheiten regelt § 556c.
5.2 Die Abrechnung der Betriebskosten
Nach § 556 III 1 hat der Wohnungsvermieter die Vorauszahlungen des Mieters auf die Betriebskosten jährlich abzurechnen[78] und dabei den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Wirtschaftlich sind nur die notwendigen Maßnahmen einer ordentlichen Bewirtschaftung[79] und ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis[80]. Verletzt der Vermieter seine vertragliche Nebenpflicht zur Wirtschaftlichkeit, schuldet er dem Mieter nach §§ 280 I 1, 249 I derart Schadensersatz, dass er unnötige Kosen nicht ersetzt verlangen darf oder zurückzahlen soll[81]. Abrechnen darf der Vermieter nicht nur Betriebskosten, die er bereits bezahlt hat, sondern auch Betriebskosten, zu deren Bezahlung er sich einem Dritten verpflichtet hat[82].
Der Mieter hat Anspruch darauf, die vom Vermieter erhobenen Verbrauchsdaten anderer Nutzer eines gemeinsam versorgten Mietobjekts einsehen und darf nach § 273 eine Betriebskostennachzahlung bis zur Einsicht verweigern[83].
Da mehrere Mieter den Mietzins samt Nebenkosten nach § 421 S. 1 als Gesamtschuldner zu zahlen haben und die Gesamtschuld selbständige Verpflichtungen begründet, die sich nach § 425 unterschiedlich entwickeln können, darf der Vermieter die Betriebskosten auch allein gegenüber einem Mieter abrechnen und eine Nachzahlung auch allein von diesem Mieter fordern[84].
Die jährliche Abrechnung der Betriebskosten ist dem Wohnungsmieter nach § 556 III 2 spätestens binnen 12 Monaten ab dem Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen[85].
Die rechtzeitige und formal korrekte Abrechnung stellt sowohl die (noch) zu zahlenden als auch die überzahlten und zu erstattenden Betriebskosten fällig[86].
Sobald die Betriebskosten reif zur Abrechnung sind, darf der Vermieter keine Abschlagszahlungen mehr verlangen[87]. Der Anspruch des Mieters auf Erstattung zu viel bezahlter Betriebskosten entsteht erst mit der Abrechnung[88].
Während der Abrechnungsfrist enthält weder die vorbehaltlose Nachzahlung noch die vorbehaltlose Erstattung einer Überzahlung ein bestätigendes Schuldanerkenntnis, das eine weitere Nachforderung oder Erstattung ausschließt, denn die Abrechnung kann noch korrigiert werden[89].
5.3 Die verspätete Nachforderung von Betriebskosten
Die gesetzliche Abrechnungsfrist nach § 556 III 2 ist eine materiellrechtliche Ausschlussfrist: Verspätete Nachforderungen des Vermieters sind nach § 556 III 3 ausgeschlossen[90], es sei denn, der Vermieter habe die Verspätung nicht zu vertreten[91]. Von dieser Ausnahme abgesehen, vermeidet nur die rechtzeitige und formal korrekte Abrechnung den Rechtsverlust des Vermieters, und nur, wenn sie dem Mieter während der Abrechnungsfrist zugeht; die rechtzeitige Absendung wahrt die Frist nicht[92].
§ 556 III gilt auch für den Vermieter einer Eigentumswohnung, und es nützt ihm nichts, dass die Wohnungseigentümer die Jahresabrechnung des Verwalters noch nicht beschlossen haben, denn das Mietverhältnis hat seine eigenen Regeln[93].
Formal korrekt und wirksam ist die Abrechnung der Nebenkosten, wenn sie gemäß § 259 die Rechnungsposten übersichtlich zusammenstellt und den Verteilerschlüssel prüfbar mitteilt[94], mag er oder die Höhe der Kosten auch unrichtig sein, denn inhaltliche Mängel der Abrechnung schaden nicht[95]. Formale Fehler hingegen nehmen der Abrechnung die rechtliche Wirkung, sodass sie die Abrechnungsfrist nicht wahren kann[96].
Dass der Vermieter die Betriebskosten 20 Jahre lang nicht abrechnet, obwohl er sie vertraglich hätte abrechnen dürfen, schließt nach § 556 III 3 nur Nachforderungen für die Vergangenheit aus. Seine erste rechtzeitige und formal korrekte Abrechnung für eine spätere Zeit ist weder durch eine stillschweigende Vertragsänderung ausgeschlossen noch nach § 242 verwirkt[97].
Was der Wohnungsmieter auf eine verspätete Betriebskostenabrechnung bezahlt hat, ist ihm nach § 812 I 1 als rechtsgrundlose Bereicherung zu erstatten[98]. Geleistete Abschlagszahlungen kann er erst nach Ablauf der Abrechnungsfrist und Beendigung des Mietverhältnisses vollständig zurückfordern, fällige Abschlagszahlungen aber sogleich nach § 273 I verweigern[99].
5.4 Verspätete Einwendungen des Wohnungsmieters gegen die Betriebskostenabrechnung
Auch der Wohnungsmieter steht zeitlich unter Druck. Nach § 556 III 5 muss er Einwendungen gegen eine rechtzeitige und formal korrekte Abrechnung der Betriebskosten bis zum Ablauf des 12. Monats nach Zugang der Abrechnung dem Vermieter mitteilen. Verspätete Einwendungen des Mieters sind nach § 556 III 6 ausgeschlossen[100], es sei denn der Mieter habe die Verspätung nicht zu vertreten.
5.5 Die Abrechnung der Betriebskosten für vermietete Geschäftsräume
§ 556 gilt nur für die Wohnraummiete. Im Mietverhältnis über andere Räume ist die Abrechnung der vertraglich umgelegten Betriebskosten gesetzlich nicht befristet, § 556 III 2, 3 nicht entsprechend anwendbar, aber der Vermieter muss binnen angemessener Frist abrechnen, und angemessen erscheint in der Regel die Frist eines Jahres ab dem Ende des Abrechnungszeitraums[101], sodass man doch noch an § 556 III hängenbleibt.
5.6 Erhöhung und Herabsetzung der Betriebskosten
Vermieter und Mieter können die Vereinbarung über die Betriebskosten jederzeit vertraglich, auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten, ändern[102]. Dass der Vermieter einzelne Betriebskosten längere Zeit nicht abrechnet, ist noch keine Vertragsänderung[103].
Rechtsgrundlage für einseitige Änderungen im Wohnmietverhältnis ist § 560. Trotz Vereinbarung einer Pauschale darf der Vermieter, soweit der Mietvertrag es erlaubt, erhöhte Betriebskosten anteilig auf den Mieter umlegen, muss dies aber begründen und erläutern (I, II). Und wenn die Betriebskosten sinken, hat er die Pauschale entsprechend zu kürzen (III). Sind Vorauszahlungen vereinbart, darf jeder Vertragspartner nach einer Abrechnung in Textform verlangen, dass die Vorauszahlungen angemessen angepasst werden (IV). Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bestimmt, wie weit die Vorauszahlungen zu erhöhen oder zu kürzen seien (V). Damit die Anpassung den tatsächlichen Kosten möglichst nahe komme, soll die Abrechnung nicht nur formal korrekt, sondern auch inhaltlich richtig sein[104]. Eine inhaltlich falsche Abrechnung darf der Mieter korrigieren und seine Vorauszahlung anpassen[105].
Der Vermieter von Geschäftsräumen darf im Anschluss an eine Betriebskostenabrechnung gemäß seiner AGB die Höhe der Vorauszahlungen einseitig anpassen[106].
5.7 Einseitig zwingendes Recht zum Schutz des Wohnungsmieters
Nach §§ 556 IV, 556a III, 560 VI sind Vereinbarungen unwirksam, die zum Nachteil des Wohnungsmieters von §§ 556 I, II 2, III, 556a II, 560 I-V abweichen[107].