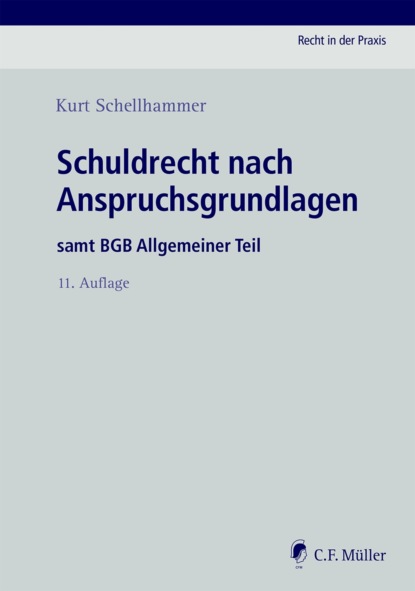- -
- 100%
- +
5.8 Die Erstattung rechtsgrundlos bezahlter Betriebskosten
Der Mieter hat nach § 812 I 1 Anspruch auf Erstattung bezahlter Betriebskosten, die nicht wirksam auf ihn umgelegt worden sind[108].
6. Die Schönheitsreparaturen
6.1 Gesetz und Mietvertrag
184
Nach § 535 I hat zwar der Vermieter die Mietsache dem Mieter nicht nur im vereinbarten gebrauchstauglichen Zustand zu überlassen, sondern auch noch während der ganzen Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten, und nach § 538 hat der Mieter eine Verschlechterung der Mietsache durch den vereinbarten Gebrauch nicht zu vertreten. Aber die Vermieter halten dies seit langem für einen alten Zopf, der abzuschneiden sei, und verpflichten den Mieter im Mietvertrag, die Mietsache während der Mietzeit instandzuhalten und spätesten am Mietende instandzusetzen und die Spuren des Gebrauchs zu beseitigen.
Da diese Praxis allgemein üblich ist, darf nicht nur der Mietvertrag über Gewerberaum[109], sondern auch der Mietvertrag über Wohnraum die Renovierung der Mietsache auf den Mieter abwälzen, im Rahmen des § 307 sogar durch vorformulierte Abreden[110]. Gemeint sind Schönheitsreparaturen im Rahmen des § 28 IV 3 der zweiten Berechnungsverordnung durch das Streichen der Decken und Wände, der Türen und Fenster, der Heizkörper und Heizrohre. Für die Wohnungsmiete ist diese Definition verbindlich[111].
Die wirksam vereinbarte Renovierungspflicht des Mieters ist ein Bestandteil des Mietzinses, den sie erhöht, und eine vertragliche Hauptpflicht des Mieters[112]. Fällig wird sie bei Bedarf, als Endrenovierung am Mietende[113]. Im Streitfall muss der Mieter die vertragsgemäße Erfüllung beweisen[114]. Seine hartnäckige Leistungsverweigerung verpflichtet ihn nach §§ 280 I, III, 281 I, II zum Schadensersatz[115].
Würde die Renovierung durch einen Umbau der Mietsache alsbald zerstört, muss der Mieter zwar nicht renovieren, aber er muss zahlen: den restlichen „Mietzins“ nämlich[116]. Wenn der Mietvertrag dazu nichts sagt, ist die Vertragslücke durch ergänzende Vertragsauslegung zu schließen[117].
6.2 Die Inhaltskontrolle vorformulierter Renovierungsabreden im Wohnmietvertrag
Vorformulierte Renovierungsabreden, die der Vermieter dem Mieter im Wohnmietvertrag stellt, scheitern leicht an § 307. Den gesetzlichen Maßstab für die Inhaltskontrolle liefert § 28 IV 3 der zweiten Berechnungsverordnung[118]. AGB, die sich daran nicht halten, können den Mieter nicht verpflichten[119]. Die Beweislast für den unwirksamen Inhalt der AGB trägt der Mieter[120].
Beispiele
Unwirksam sind vorformulierte Abreden:
- die den Mieter nach einem starren Fristenplan ohne konkreten Bedarf zur Renovierung verpflichten (BGH NJW 2006, 3778; 2007, 3776; 2008, 3772: auch Gewerberaummiete; NJW 2012, 1572; 2015, 1594); - die den Mieter, auch mit flexiblem Fristenplan nach Bedarf, dazu verpflichten, eine bei Mietbeginn unrenovierte oder renovierungsbedüftige Wohnung zu renovieren und damit auch die Spuren des Mietgebrauchs durch einen früheren Mieter zu beseitigen (BGH NJW 2015, 1594; 2015, 1871; 2018, 3302), es sei denn der Vermieter gewährt dem Mieter einen angemessenen Ausgleich, etwa durch Mietminderung (BGH NJW 2015, 1594; NJW-Spezial 2020, 610: Zur Verteilung der Kosten im „dekorativen Stau“). Solange die unrenovierte Wohnung bewohnbar ist, bleibt es dabei (BGH NJW 2020, 3517, 3523). Einen Anspruch aus § 535 I 2 hat der Mieter erst, wenn die Wohnung sich wesentlich verschlechtert, muss dann aber für die Verbesserung einen Teil der Renovierungskosten tragen (BGH NJW 2020, 3517, 3523); - die dem Mieter eine bestimmte Farbe oder eine Handwerkerleistung vorschreiben (BGH NJW 2009, 3716; 2011, 514; 2012, 1280; 2012, 3031); - die den Mieter zum Außenanstrich der Fenster und Türen verpflichten (BGH NJW 2009, 1408; 2010, 674; - die den Mieter verpflichten, die Parkettversiegelung wieder herzustellen (BGH NJW 2010, 674); - die den Mieter verpflichten, die am Mietende noch nicht fällige Renovierung anteilig durch eine Geldzahlung zu ersetzen, denn der Mieter kann bei Vertragsabschluss die Höhe der Kosten noch nicht abschätzen, wenn sie sich nach dem Kostenvoranschlag eines vom Vermieter zu bestimmenden Malerfachbetriebs richten soll (BGH NJW 2013, 2505).Auch wenn nur ein Teil einer vorformulierten Renovierungsabrede oder eine von mehreren, rechtlich zusammengehörigen Renovierungsabreden dem § 307 nicht standhält, ist rechtlich alles unwirksam[121]. Die individuell vereinbarte Endrenovierung hingegen bleibt auch dann wirksam, wenn der vorformulierte Fristenplan nach § 307 unwirksam ist[122].
Die Vertragslücke, die durch die Unwirksamkeit einer vorformulierten Renovierungsabrede entsteht, wird gemäß § 306 II nicht durch ergänzende Vertragsauslegung, sondern durch die gesetzliche Renovierungspflicht des Vermieters nach § 535 I ausgefüllt[123]. Der Vermieter ist auch nicht berechtigt, die ortsübliche Miete zu erhöhen, wenn seine vorformulierte Renovierungsabrede unwirksam ist[124].
Der Mieter, der renoviert, obwohl die vorformulierte Abrede unwirksam ist, kann vom Vermieter nach §§ 812 I 1, 818 II Wertersatz in Höhe der üblichen Kosten für Material und Personal verlangen[125]. Ein Geschäft für den Vermieter nach §§ 539, 677, 683 führt der Mieter mit der Renovierung nicht, sondern erfüllt nur seine eigene vermeintliche Renovierungspflicht[126]. Zum Schadenersatz nach § 280 I 1 ist der Vermieter dem Mieter dann nicht verpflichtet, wenn er nicht erkennen muss, dass die handschriftliche Renovierungsabrede eine vom ihm gestellte AGB sei[127].
Schönheitsreparaturen sollen die Spuren der Abnutzung beseitigen, sie sollen nicht auch Schäden an der Mietsache ausgleichen. Unwirksam sind vorformulierte Abreden, die den Mieter zu anfallenden Kleinreparaturen[128] oder zum Ersatz von Schäden verpflichten, die er nicht zu vertreten hat[129]. Wirksam sind nur Kostentragungsabreden mit jährlichen Höchstbeträgen[130].
7. Die Mietkaution
185
Die Mietkaution ist kein Teil des Mietzinses, sondern sichert den Mietzinsanspruch und die sonstigen Ansprüche des Vermieters aus dem Mietverhältnis[131].
Ob, wie und in welcher Höhe eine Mietkaution zu leisten sei, bestimmt der Mietvertrag[132]. Eine Barkaution hat der Vermieter im Zweifel wie eine Spareinlage mit gesetzlicher Kündigungsfrist anzulegen[133] Der Anspruch des Vermieters auf die versprochene Kaution überlebt auch das Mietende, wenn und solange der Vermieter noch aufrechenbare Gegenansprüche aus dem Mietverhältnis hat und sein Sicherungsbedürfnis fortbesteht[134]. Während des Mietverhältnisses darf der Vermieter für streitige Forderungen die Kaution noch nicht verwerten[135]. Nach Mietende darf der Mieter die Kaution zurückfordern, wenn und soweit der Vermieter aus dem Mietverhältnis keine Ansprüche mehr hat[136], muss dem Vermieter jedoch angemessene Zeit zur Prüfung lassen, ob und mit welchen Gegenforderungen er aufrechnen wolle[137]. Der Vermieter darf nur mit Gegenansprüchen aufrechnen, die dem Mietverhältnis entstammen[138].
Die Kaution des Wohnungsmieters darf nach § 551 höchstens das Dreifache der monatlichen Nettomiete betragen; die Betriebskosten erhöhen die Nettomiete nicht, wenn sie als Pauschale oder Vorauszahlung vereinbart sind (I)[139]. Eine Barkaution darf der Mieter in 3 gleichen Monatsbeträgen leisten, die erste Zahlung am Mietbeginn (II)[140]. Der Vermieter hat die Barkaution als Spareinlage mit dreimonatiger Kündigungsfrist anzulegen, wenn nicht der Mietvertrag eine andere Anlage vorsieht (III, 1, 2). So oder so ist die Anlage vom Vermögen des Vermieters zu trennen[141]. Dafür bietet sich ein Ander- oder Treuhandkonto an; die Erträge stehen dem Mieter zu, erhöhen aber gleichzeitig die Sicherheit (III 3, 4). Während § 551 I allgemein von „Sicherheit“ spricht, regelt § 551 II, III nur die Barkaution in Geld, schließt andere Sicherheiten aber nicht aus[142].
Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters sind nach § 551 IV unwirksam.
§ 551 gilt nicht für eine Sicherheit, die eine Kündigung des Vermieters wegen Zahlungsverzugs des Mieters verhindern soll[143] und auch nicht für die Unterwerfung des Wohnungsmieters unter die sofortige Zwangsvollstreckung wegen der laufenden Miete[144].
8. Die Aufrechnung des Wohnungsmieters
186
Unabdingbar ist nach § 556b II das Recht des Wohnungsmieters, gegen die Mietzinsforderung mit einem Schadensersatz oder Aufwendungsersatzanspruch aus §§ 536a, 539 oder einem Bereicherungsanspruch wegen überzahlter Miete aufzurechnen oder den Mietzins deswegen zurückzuhalten, wenn er sein Vorhaben dem Vermieter mindestens 1 Monat vor Fälligkeit der Miete in Textform angezeigt hat.
Die Aufrechnung des Mieters mit seinem Anspruch auf Rückzahlung verspätet abgerechneter Nebenkosten wird unwirksam, wenn der Vermieter doch noch wirksam abrechnet[145].
9. Die persönliche Verhinderung des Mieters
Nach § 537 I muss der Mieter den Mietzins auch dann bezahlen, wenn er die Mietsache aus persönlichen Gründen nicht gebrauchen kann (S. 1), denn zu vergüten ist nicht erst der Gebrauch, sondern schon die Gebrauchsmöglichkeit. Der Vermieter muss sich nur den ersparten Aufwand anrechnen lassen (S. 2).
Erst recht schuldet der Mieter den versprochenen Mietzins auch dann, wenn er aus freien Stücken vorzeitig auszieht oder gar nicht erst einzieht[146]. Die Vorteile aus einer Weitervermietung muss sich der Vermieter, der am Vertrag festhält, nicht anrechnen lassen, denn der Einwand des Mieters, der Vermieter sei zur Vertragserfüllung nicht mehr imstande, widerspricht Treu und Glauben[147].
Jedoch schuldet der Mieter nach § 537 II solange keinen Mietzins, als der Vermieter außerstande ist, dem interessierten Mieter den Mietgebrauch zu gewähren, weil er die Mietsache einem Dritten überlassen hat.
1. Die freie Wahl des Vermieters und die vertragliche oder gesetzliche Beschränkung
187
In der Wahl seines Mieters war der Vermieter lange Zeit frei. Zum Abschluss eines Mietvertrags verpflichteten ihn nur der Mietvorvertrag[148] und die Nachfolgeklausel im Mietvertrag: Der Vermieter verspricht, an einen geeigneten Nachmieter, den der Mieter beibringt, zu vermieten[149]. Ohne Nachfolgeabrede musste der Vermieter keinen Nachmieter akzeptieren, den der Mieter ihm brachte, und den Mieter auch nicht vorzeitig aus dem Mietvertrag entlassen[150].
Seit dem 18.8.2006 jedoch schützt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auch den Mietinteressenten vor diskriminierender Ungleichbehandlung und beschränkt massiv die Vertragsfreiheit des Vermieters[151], je nach Mietsache und Mietangebot in unterschiedlichem Maße (RN 1896 ff.).
- Unzulässig ist nach § 19 I Nr. 1 AGG eine Benachteiligung wegen der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion, des Geschlechts oder der sexuellen Identität, der Behinderung oder des Alters bei der Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Schuldverhältnisses, wenn es sich um ein Massengeschäft oder ähnliches Geschäft handelt, bei dem das Ansehen der Person keine oder nur eine nachrangige Rolle spielt. Ein derartiges Massengeschäft ist die gewerbliche Vermietung beweglicher Sachen wie Baumaschinen, Kraftfahrzeuge, Fahrräder oder Videokassetten[152], die Vermietung von Geschäfts- oder Wohnraum hingegen nur, wenn sie sich auf einen vorübergehenden Gebrauch (Hotelzimmer, Ferienwohnung oder Ferienhaus) beschränkt[153], oder wenn der Vermieter eine große Zahl von Wohnungen anbietet. Die Vermietung von bis zu 50 Wohnungen ist nach § 19 V 3 AGG in der Regel noch kein Massengeschäft nach § 19 I Nr. 1 AGG. - Ausnahmslos unzulässig ist nach § 19 II mit § 2 I Nr. 8 AGG für alle Mietverhältnisse eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder ethnischen Herkunft, wenn die Mietsache durch Zeitungsinserat, durch Makler oder im Internet öffentlich angeboten wird, mag es sich auch um die einzige Wohnung des Anbieters handeln[154]. - § 19 III AGG erlaubt eine unterschiedliche Behandlung, wenn sie im Zuge einer Städteplanung sozial stabile Bewohner- und ausgewogene Siedlungsstrukturen schaffen oder erhalten soll, was auf Großvermieter gemünzt ist. - § 19 V 1, 2 AGG gestattet die freie Mieterwahl, wenn das Mietverhältnis ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet, etwa weil die Parteien oder ihre Angehörigen auf demselben Grundstück wohnen.Eine unterschiedliche Behandlung kann der Vermieter nach § 20 I AGG durch den Nachweis eines sachlichen Grundes rechtfertigen; dazu liefert das Gesetz vier Beispiele. Ausnahmslos unzulässig ist jedoch die Benachteiligung aus rassischen oder ethnischen Gründen.
Gegen eine unzulässige Benachteiligung wehrt sich der Mietinteressent nach § 21 I, II AGG mit Ansprüchen auf Beseitigung, Unterlassung und Schadenersatz (RN 1898), die er nach § 21 V AGG binnen 2 Monaten geltend machen muss, wenn er sie nicht verlieren will. Ob der abgewiesene Mietinteressent auch den Abschluss des verweigerten Mietvertrags verlangen könne, ist streitig.
Vereinbarungen, die vom AGG abweichen, sind nach § 21 IV AGG unwirksam, der restliche Vertrag bleibt jedoch bestehen, denn § 139 BGB ist nicht anwendbar.
2. Mehrere Vermieter oder Mieter
188
Mehrere Vermieter sind in der Regel nach Bruchteilen berechtigt (§ 741), nicht als Gesamthänder. Die Mietzinsforderung darf zwar jeder allein einziehen, nach § 432 aber nur Zahlung an alle fordern[155]. Den Mietgebrauch schulden sie als Gesamtschuldner (§ 431).
Mehrere Mieter sind im Innenverhältnis gleichfalls nach Bruchteilen berechtigt (§ 741)[156]. Den Mietzins schulden sie als Gesamtschuldner (§ 427).
Ein Dritter kann durch Vereinbarung mit dem Mieter und mit Zustimmung des Vermieters in das Mietverhältnis eintreten, entweder an Stelle des bisherigen Mieters oder zusätzlich neben dem bisherigen Mieter[157] und hat dann, wenn nichts anderes vereinbart ist, die Rechte und Pflichten aus dem ursprünglichen Mietvertrag[158].
Das Mietverhältnis ändern oder gemeinsam aufheben[159] können nur alle Mieter und Vermieter zusammen und das Mietverhältnis kündigen können nur alle Mieter oder Vermieter zusammen nur gegenüber allen Vertragsgegnern[160]. Wenn aber der Ehemann aus der gemeinsam gemieteten Ehewohnung auszieht, bleibt die Ehefrau alleinige Mieterin[161].
Die Kündigung des Insolvenzverwalters über das Vermögen eines von mehreren Mietern nimmt auch den anderen Mitmietern ihr Recht zum Besitz der Mietsache, wenn nicht der Mietvertrag für diesen Fall bestimmt, dass das Mietverhältnis mit den anderen Mitmietern fortgesetzt werde[162].
3. Der Mieterwechsel
3.1 Unter Lebenden
189
Der Mieter kann seine Rechte und Pflichten aus dem Mietverhältnis nicht einfach auf einen anderen übertragen, dem Vermieter keinen anderen Mieter aufzwingen. Die Vertragsübernahme ist nur mit Zustimmung des Vermieters möglich[163].
3.2 Von Todes wegen
Die Rechte und Pflichten des Mieters aus dem Mietverhältnis sind nach §§ 564, 580 vererblich[164].
Für das Wohnmietverhältnis gilt dies jedoch nur beschränkt, denn der Erbe wird hier durch andere Personen verdrängt, die nach § 563 unmittelbar kraft Gesetzes und in folgender Rangfolge anstelle des verstorbenen Mieters in das Mietverhältnis eintreten:
- Den ersten Rang besetzt der Ehegatte oder Lebenspartner (I). - Die Kinder des Mieters gehen dem Ehegatten nach, haben aber den gleichen Rang mit dem Lebenspartner (II 1, 2). - Es folgen andere Familienangehörige und sonstige Personen (II 3, 4).In das Wohnmietverhältnis treten aber nur diejenigen Angehörigen des Mieters ein, die mit dem verstorbenen Mieter einen gemeinsamen Haushalt, die „sonstigen Personen“ gar einen auf Dauer angelegten Haushalt, geführt haben; unerheblich ist die Art der Lebenspartnerschaft oder die Nähe der Verwandtschaft.
Der Eintritt eines solchen Haushaltsmitglieds in das Mietverhältnis bedarf keiner Erklärung, sondern ist eine unmittelbare gesetzliche Rechtsfolge, eine Art Sonderrechtsnachfolge nach dem Tod. Sie ist freilich auflösend bedingt, denn das eintrittsberechtigte Haushaltsmitglied darf die Rechtsnachfolge in das Mietverhältnis nach § 563 III ablehnen. Erforderlich ist die Erklärung gegenüber dem Vermieter, das Mietverhältnis nicht fortsetzen zu wollen. Sie ist befristet und binnen eines Monats ab Kenntnis vom Tod des Mieters abzugeben. Die rechtzeitige Ablehnung beseitigt mittels gesetzlicher Fiktion den Eintritt in das Mietverhältnis.
Der Vermieter ist gegen den gesetzlichen Eintritt eines anderen Mieters machtlos. Nach § 563 IV darf er zwar binnen eines Monats ab Kenntnis vom endgültigen Eintritt mit gesetzlicher Frist kündigen, aber nur, wenn die Person des neuen Mieters einen wichtigen Grund liefert[165].
Stirbt eine von mehreren Personen, die nach § 563 gemeinsam Mieter sind, wird das Mietverhältnis nach § 563a mit den überlebenden Mietern fortgesetzt, die aber durch außerordentliche Kündigung ausscheiden können.
Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters oder der eintrittsberechtigten Personen sind nach §§ 563 V, 563a III unwirksam.
Wer nach § 563 in das Wohnmietverhältnis eintritt oder es nach § 563a fortsetzt, haftet nach § 563b I für die bis zum Tod des Mieters entstandenen Mietschulden als Gesamtschuldner mit dem Erben, der intern jedoch allein haftet. § 563b II regelt den Ausgleich für die vorausbezahlte Miete, § 563b III den Anspruch des Vermieters auf Sicherheit.
Ganz am Ende der Warteschlange steht der Erbe des Wohnungsmieters. Nach § 564 erbt er die Mieterrechte und -pflichten nur, wenn ihn kein vorrangiges Haushaltsmitglied nach §§ 563, 563a verdrängt. In diesem Fall dürfen sowohl der Erbe als auch der Vermieter das Mietverhältnis binnen eines Monats ab Kenntnis vom Tod des Mieters und vom Nichteintritt anderer Personen mit gesetzlicher Frist außerordentlich kündigen[166].
Nach § 580 haben Erbe und Vermieter das Recht zur außerordentlichen Kündigung auch in einem Mietverhältnis über eine andere Sache.
4. Der Vermieterwechsel nach gewerblicher Weitervermietung zum Wohnen
190
Ein Wohnraummietverhältnis entsteht nur dann, wenn die Räume zum Wohnen ge- und vermietet werden, der Mieter also selbst darin wohnen soll. Soll der Mieter hingegen die Mieträume gewerblich zum Wohnen weitervermieten, entsteht ein Wohnraummietverhältnis nur zwischen Mieter und Untermieter, nicht auch zwischen Vermieter und Mieter und schon gar nicht zwischen Vermieter und Untermieter[167].
Damit der Wohnungs-Untermieter aber nicht schutzlos im Regen stehe, wenn das Hauptmietverhältnis endet, tritt nach § 565 I 1 der Vermieter in das Untermiet-Wohnverhältnis ein[168]. Die §§ 566a-566e über die Veräußerung des vermieteten Wohnraums gelten nach § 565 II entsprechend.
Und vermietet der Vermieter die Wohnung erneut zur gewerblichen Weitervermietung, tritt nach § 565 I 2 der neue Mieter anstelle des bisherigen Vertragspartners in das Wohmietverhältnis mit dem Untermieter ein.
Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters sind nach § 565 III unwirksam.
5. Der Vermieterwechsel durch Veräußerung der Mietsache
5.1 „Kauf bricht nicht Miete“
191
Als Vertragsschuldverhältnis besteht auch das Mietverhältnis nur zwischen Vermieter und Mieter, unabhängig davon, ob die Mietsache dem Vermieter oder einem Dritten gehört. Von dieser gesetzlichen Regel weichen die §§ 566, 578, 578a zum Schutz des Wohnungs-, Raum- und Grundstücksmieters ab[169]. Nach diesen Vorschriften tritt der Erwerber der Mietsache an Stelle des Vermieters in das Mietverhältnis ein, obwohl er am Abschluss des Mietvertrags nicht beteiligt war.
Die Überschrift: „Kauf bricht nicht Miete“ ist allerdings unsinnig, denn der schuldrechtliche Kauf kann die Miete nie brechen. § 566 handelt denn auch nicht vom Verkauf, sonder von der Übereignung der vermieteten Wohnung und soll den Mieter vor den Folgen des Eigentumswechsels schützen[170].
Das Mietrechtsreformgesetz hat das System insofern geändert, als jetzt die Veräußerung vermieteten Wohnraums nach §§ 566-567b im Vordergrund steht und die Veräußerung anderer Räume, eines Grundstücks oder eingetragenen Schiffs nach §§ 578, 578a diesen Regeln folgt.
5.2 Der gesetzliche Übergang des Wohnmietverhältnisses auf den neuen Eigentümer
192
Nach § 566 I tritt der Erwerber des vermieteten Wohnraums ab dinglichem Erwerb[171] und für die Dauer seines Eigentums an Stelle des Vermieters in alle Rechte und Pflichten aus dem Mietverhältnis ein[172]. Jedoch erwirbt er nur diejenigen Ansprüche und Verpflichtungen, die erst nach seinem Eigentumserwerb fällig werden[173], und nur Ansprüche und Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis[174], nicht auch aus anderen Vereinbarungen, die mit dem Mietverhältnis nicht untrennbar verbunden sind, mögen sie auch im Mietvertrag stehen[175]. Mehrere Erwerber bilden eine Bruchteilsgemeinschaft (RN 188) und haften dem Mieter als Gesamtschuldner[176].