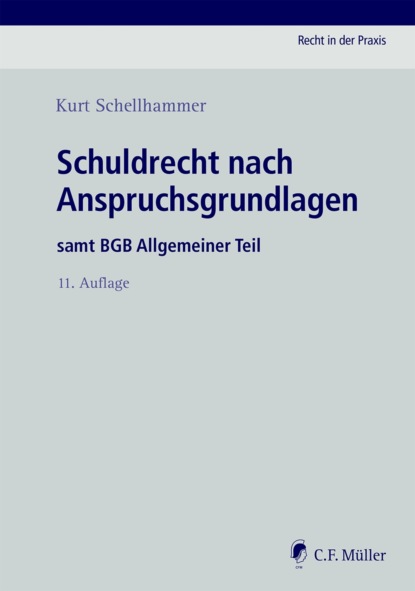- -
- 100%
- +
1. Der Anspruch des Gesellschafters und der Anspruch der Gesellschaft648
2. Die Gesellschafterbeiträge649
3. Der Gesellschaftsvertrag als Anspruchsvoraussetzung650 – 652
4. Die Einwendungen des Gesellschafters gegen die Beitragspflicht653 – 655
5. Die Beitragserhöhung656
4. Kapitel Die Gewinn- und Verlustbeteiligung des Gesellschafters657 – 659
5. Kapitel Die Haftung des Gesellschafters für Gesellschaftsschulden660 – 665
1. Die Gesellschaftsschulden aus Vertrag660, 661
2. Die vertragliche Haftungsbeschränkung662
3. Die Gesellschaftsschulden aus Bereicherung663
4. Die Haftung der Gesellschaft und der Gesellschafter aus unerlaubter Handlung664
5. Der Gesamtschuldnerausgleich665
6. Kapitel Die Organisation der Gesellschaft666 – 677
1. Die rechtliche Struktur der Gesellschaft666
2. Der Gesellschafterbeschluss667 – 669
3. Die Geschäftsführung der Gesellschaft670 – 676
4. Die Vertretung der Gesellschaft677
7. Kapitel Die Mitgliedschaft678 – 681
1. Die Summe der Gesellschafterrechte678
2. Die Übertragbarkeit der Mitgliedschaft679, 680
3. Der Eintritt eines neuen Gesellschafters in die Gesellschaft681
8. Kapitel Das Ende der Gesellschaft682 – 691
1. Der Anspruch des Gesellschafters auf Auseinandersetzung der aufgelösten Gesellschaft und auf Auszahlung seines Auseinandersetzungsguthabens682 – 686
2. Die Auflösung der Gesellschaft687 – 691
9. Kapitel Der Anspruch des ausscheidenden Gesellschafters auf sein Auseinandersetzungsguthaben692 – 700
1. Das Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft692 – 697
2. Das Ausscheiden des einen Gesellschafters und die Übernahme des Gesellschaftsvermögens durch den anderen698
3. Der Ausschluss eines Gesellschafters699
4. Das Recht eines Gesellschafters auf Übernahme des Gesellschaftsvermögens700
11. Teil Die Gemeinschaft
1. Kapitel Das gesetzliche System701 – 704
1. Entweder Gesamthands- oder Bruchteilsgemeinschaft701
2. Die Entstehung der Gemeinschaft702
3. Ein gesetzliches Schuldverhältnis703
4. Die Verfügung über den Anteil und über das gemeinschaftliche Recht704
2. Kapitel Nutzung, Kosten und Lasten der Gemeinschaft705, 706
1. Die Nutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes705
2. Die Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen Gegenstandes706
3. Kapitel Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes707 – 712
1. Das gesetzliche System707
2. Die Verwaltungsvereinbarung708
3. Der Mehrheitsbeschluss709
4. Die gemeinschaftliche Verwaltung710
5. Der Anspruch des Teilhabers auf eine billige Neuregelung711
6. Das Notverwaltungsrecht des Teilhabers712
4. Kapitel Die Aufhebung und Teilung der Gemeinschaft713 – 719
1. Das gesetzliche System713
2. Realteilung oder Versilberung des gemeinschaftlichen Gegenstandes714, 715
3. Die Tilgung der gemeinschaftlichen Schulden716
4. Die Verteilung des Reinerlöses717, 718
5. Die Beschränkung der Aufhebung der Gemeinschaft719
6. Das Ende der Gemeinschaft
12. Teil Die juristischen Personen des BGB: der Verein und die Stiftung
1. Kapitel Die Rechtsfähigkeit720 – 722
1. Natürliche und juristische Person720
2. Die körperschaftliche Organisation721
3. Die Rechtsgrundlagen der juristischen Person722
2. Kapitel Gründung, Ende und Organisation des Vereins723 – 727
1. Die Vereinsgründung723, 724
2. Das Ende des Vereins725
3. Die Vereinsorgane726, 727
3. Kapitel Der Verein im Geschäfts- und Rechtsverkehr728 – 730
1. Die Geschäfts- und Deliktsfähigkeit des Vereins728
2. Die Haftung des Vereins729, 730
4. Kapitel Vereinsmitgliedschaft und Vereinsautonomie731, 732
1. Der Beitritt zum und die Aufnahme in den Verein731
2. Die Vereinsmitgliedschaft
3. Der Ausschluss aus dem Verein und andere Vereinsstrafen732
5. Kapitel Das Vereinsregister733
6. Kapitel Der nichtrechtsfähige Verein734
7. Kapitel Die Stiftung735
13. Teil Die Bürgschaft
1. Kapitel Das gesetzliche System736 – 738
1. Eine schuldrechtliche, forderungsabhängige Sicherheit736
2. Das hohe Risiko des Bürgen
3. Das Dreiecksverhältnis737
4. Anspruchsgrundlagen und Gegennormen738
5. Sonderformen der Bürgschaft
2. Kapitel Der Anspruch des Gläubigers gegen den Bürgen aus der Bürgschaft739 – 763
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge739
2. Die Anspruchsvoraussetzungen740
3. Die erste Anspruchsvoraussetzung: ein Bürgschaftsvertrag741 – 747
4. Die zweite Anspruchsvoraussetzung: eine verbürgte Hauptschuld748 – 751
5. Einwendungen und Einreden des Bürgen752 – 762
6. Der Schadensersatzanspruch des Bürgen gegen den Gläubiger763
3. Kapitel Der Rückgriff des Bürgen gegen den Hauptschuldner764 – 766
1. Der Anspruch des Bürgen auf Ersatz seiner Aufwendungen764
2. Der gesetzliche Forderungsübergang765
3. Die Voraussetzung des gesetzlichen Forderungsübergangs766
4. Einwendungen und Einreden des Hauptschuldners
4. Kapitel Besondere Erscheinungsformen der Bürgschaft767 – 780
1. Die Bürgschaft auf erstes Anfordern767 – 769
2. Die Ausfallbürgschaft770
3. Die Höchstbetragsbürgschaft771
4. Die Mitbürgschaft772
5. Die Nachbürgschaft773
6. Die Rückbürgschaft774
7. Die Prozessbürgschaft775
8. Die Zeitbürgschaft776 – 778
9. Gesetzliche Bürgschaften779
10. Wechsel- und Scheckbürgschaft780
5. Kapitel Andere schuldrechtliche Sicherheiten781, 782
1. Der Schuldbeitritt781
2. Der Garantievertrag782
14. Teil Der Vergleich
1. Kapitel Das gesetzliche System783 – 788
1. Der Vergleich im Gesetz und im Rechtsleben783
2. Die rechtliche Struktur des Vergleichs
3. Der Vergleich als Anspruchsgrundlage784
4. Die Nichtigkeit des Vergleichs wegen eines gemeinsamen Irrtums über die Vergleichsgrundlage785 – 787
5. Die Geschäftsgrundlage des Vergleichs788
6. Sonstige Nichtigkeitsgründe
2. Kapitel Besondere Erscheinungsformen des Vergleichs789 – 792
1. Der Abfindungsvergleich789
2. Der Prozessvergleich790
3. Der Anwaltsvergleich
4. Der Sanierungsvergleich791
5. Das Teilungsabkommen792
15. Teil Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis
1. Kapitel Das gesetzliche System793
1. Selbstständige, abstrakte Verpflichtungen793
2. Das Anerkenntnis im Rechtsleben
2. Kapitel Das selbstständige Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis794 – 798
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge794
2. Die Anspruchsvoraussetzung: ein Vertrag über eine selbstständige Verpflichtung795, 796
3. Die Form des selbstständigen Schuldversprechens oder Schuldanerkenntnisses797
4. Die Einwendungen des Schuldners gegen das selbstständige Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis798
3. Kapitel Das deklaratorische Schuldanerkenntnis799 – 802
1. Ein vertraglicher Einwendungsverzicht799
2. Das deklaratorische Anerkenntnis als Anspruchsgrundlage800
3. Die Voraussetzung eines deklaratorischen Anerkenntnisses801, 802
16. Teil Anweisung und Inhaberschuldverschreibung
1. Kapitel Die Wertpapiere im System des Zivilrechts803 – 806
1. Das verbriefte Recht803
2. Das Namenspapier804
3. Das Inhaberpapier805
4. Das Orderpapier806
2. Kapitel Die Anweisung807 – 812
1. Das gesetzliche Muster für Wechsel und Scheck807
2. Die Anweisung als Doppelermächtigung808
3. Das Valuta- und das Deckungsverhältnis809
4. Form, Widerruf und Übertragung der Anweisung810
5. Die Annahme der Anweisung811, 812
3. Kapitel Die Schuldverschreibung auf den Inhaber813 – 818
1. Der Anspruch aus der Inhaberschuldverschreibung813 – 815
2. Einwendungen des Ausstellers gegen die Inhaberschuldverschreibung816 – 818
4. Kapitel Das Namenspapier mit Inhaberklausel819
5. Kapitel Der Anspruch auf Vorlegung einer Sache und auf Einsicht in eine Urkunde820
17. Teil Auslobung und Gewinnmitteilung, Leibrente, Spiel und Wette
1. Kapitel Die Auslobung821 – 823
1. Ein einseitiges Verpflichtungsgeschäft821
2. Das Preisausschreiben822
3. Die Gewinnmitteilung823
2. Kapitel Die Leibrente824
3. Kapitel Spiel und Wette825, 826
1. Die unvollkommene Verbindlichkeit825
2. Der verbindliche Spielvertrag826
3. Der Spielsperrvertrag
18. Teil Die Geschäftsführung ohne Auftrag
1. Kapitel Das gesetzliche System827 – 830
1. Ein gesetzliches Schuldverhältnis827
2. Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag828
3. Die unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag829
4. Die vermeintliche und die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag830
2. Kapitel Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag831 – 842
1. Der Anspruch des Geschäftsführers auf Ersatz seiner Aufwendungen831 – 840
2. Die Ansprüche des Geschäftsherrn aus einer auftraglosen Geschäftsführung841, 842
3. Kapitel Die unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag843, 844
1. Der Anspruch des Geschäftsführers auf Herausgabe der Bereicherung843
2. Der Anspruch des Geschäftsherrn auf Schadensersatz844
4. Kapitel Die vermeintliche und die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag845
19. Teil Die ungerechtfertigte Bereicherung
1. Kapitel Das gesetzliche System846 – 849
1. Der Ausgleich rechtsgrundloser Vermögensverschiebungen846
2. Die Anspruchsgrundlagen847
3. Die Gegennormen
4. Die Abgrenzung des Bereicherungsanspruchs von anderen Ausgleichsansprüchen848, 849
2. Kapitel Die ungerechtfertigte Bereicherung durch Leistung (Leistungskondiktion)850 – 865
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge850 – 852
2. Die Anspruchsvoraussetzungen der Leistungskondiktion und die Beweislast853
3. Die Leistung des Anspruchstellers854 – 856
4. Die Bereicherung des Anspruchsgegners857
5. Die Bereicherung auf Kosten des Anspruchstellers858
6. Die Bereicherung durch eine Leistung ohne rechtlichen Grund859 – 865
3. Kapitel Der Bereicherungsausgleich nach einer Leistung im Dreiecksverhältnis866 – 879
1. Das Problem866
2. Die Leistung durch oder an einen Vertreter867
3. Die Leistung durch Vertrag zugunsten Dritter868 – 870
4. Die Leistung auf Anweisung871 – 875
5. Die Leistung durch Banküberweisung876, 877
6. Die Leistung auf fremde Schuld878
7. Die Leistung nach Abtretung der Forderung879
4. Kapitel Die ungerechtfertigte Bereicherung in sonstiger Weise880 – 889
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge880, 881
2. Die Voraussetzungen einer Bereicherung „in sonstiger Weise“882 – 889
5. Kapitel Die ungerechtfertigte Bereicherung durch unberechtigte Verfügung über ein fremdes Recht oder durch unberechtigte Annahme einer Leistung890 – 896
1. Das gesetzliche System890
2. Der unberechtigte Eingriff durch entgeltliche Verfügung über ein fremdes Recht891, 892
3. Der unberechtigte Eingriff durch unentgeltliche Verfügung über ein fremdes Recht893, 894
4. Der unberechtigte Eingriff durch schuldbefreiende Annahme einer Leistung895, 896
6. Kapitel Die mittelbare Bereicherung durch unentgeltlichen Erwerb vom Bereicherungsschuldner897
1. Die Anspruchsgrundlage897
2. Die Rechtsfolge
3. Die Anspruchsvoraussetzungen
7. Kapitel Die Einrede der Bereicherung898
8. Kapitel Die Einwendungen und Einreden des Bereicherungsschuldners899 – 920
1. Das gesetzliche System899
2. Die Einwendung der Entreicherung aus § 818 III900 – 909
3. Die Einwendung aus § 814 gegen die Leistungskondiktion wegen einer Nichtschuld910, 911
4. Die Einwendung aus § 815 gegen die Leistungskondiktion wegen Zweckverfehlung912
5. Die Einwendung aus § 817 S. 2 gegen die Leistungskondiktion913 – 917
6. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs918
7. Der Einwand der aufgedrängten Bereicherung919
8. Die Verjährungseinrede920
20. Teil Die unerlaubte Handlung
1. Kapitel Das gesetzliche System921 – 927
1. Die Vielfalt der Anspruchsgrundlagen mit und ohne Verschulden921, 922
2. Die unterschiedlichen Haftungssysteme923
3. Die Konkurrenz der Schadensersatzansprüche924, 925
4. Die Anspruchsgrundlagen des Rechts der unerlaubten Handlung926
5. Die Einwendungen und Einreden des Rechts der unerlaubten Handlung927
6. Der Gang der Darstellung
2. Kapitel Die Rechtsfolge der unerlaubten Handlung: ein Anspruch auf Schadensersatz928 – 938
1. Art und Umfang des Schadensersatzes928
2. Der Ersatz des Verdienstausfalls929, 930
3. Die Schadensrente für Mehrbedarf und Verdienstausfall931, 932
4. Das Schmerzensgeld933 – 936
5. Der Schadensersatz wegen der Entziehung oder Beschädigung einer Sache937
6. Schadensersatz, Beseitigung vorhandener und Unterlassung künftiger Störungen938
3. Kapitel Gläubiger und Schuldner des gesetzlichen Schadensersatzanspruchs939 – 951
1. Der Ersatzberechtigte939 – 944
2. Der Schadensersatzschuldner945 – 951
4. Kapitel Der Grundtatbestand des § 823 I: die Verletzung eines absoluten Rechts oder Rechtsguts952 – 1003
1. Anspruchsvoraussetzungen und Beweislast952
2. Die Rechtsgutsverletzung953 – 967
3. Die Verletzungshandlung968
4. Das pflichtwidrige Unterlassen969 – 985
5. Die Schadensverursachung durch die Verletzungshandlung986
6. Die Rechtswidrigkeit der Rechtsgutsverletzung987 – 997
7. Das Verschulden des Verletzers998 – 1003
5. Kapitel Das Namensrecht1004 – 1010
1. Das gesetzliche System1004, 1005
2. Der Anspruch des Namensträgers auf Beseitigung der Namensstörung1006 – 1009
3. Der Anspruch auf Unterlassung weiterer Namensstörungen1010
6. Kapitel Das allgemeine Persönlichkeitsrecht1011 – 1025
1. Ein Rahmenrecht ohne scharfe Konturen1011
2. Die Rechtsgrundlage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts1012
3. Die Abwehransprüche1013, 1014
4. Der Anspruch auf Schadensersatz1015, 1016
5. Die rechtswidrige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts1017, 1018
6. Die Menschenwürde1019
7. Das Recht auf ein ungestörtes Intimleben1020
8. Das Recht auf ein ungestörtes Privatleben1021
9. Das Privatleben Prominenter1022
10. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung1023
11. Das Recht am eigenen Wort1024
12. Das Recht am eigenen Bild1025
7. Kapitel Der zivilrechtliche Schutz der Ehre1026 – 1034
1. Das gesetzliche System1026
2. Der Anspruch auf Schadensersatz1027 – 1030
3. Der Anspruch auf Beseitigung der Störung und auf Widerruf1031, 1032
4. Der Anspruch auf Unterlassung weiterer Ehrverletzungen1033
5. Der Anspruch auf Gegendarstellung1034
8. Kapitel Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung1035 – 1044
1. Der Widerstreit zweier Grundrechte1035
2. Die Kriterien der Abwägung1036
3. Tatsachenbehauptungen und Werturteile1037 – 1039
4. Die Freiheit der Rede im öffentlichen Meinungskampf1040 – 1042
5. Die Schmähkritik1043
6. Die Freiheit von Kunst und Wissenschaft1044
9. Kapitel Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb1045 – 1052
1. Die Anspruchsgrundlage für Schadensersatz1045
2. Ein Rahmenrecht und Auffangtatbestand1046
3. Das Unternehmen1047
4. Der unmittelbare Eingriff in das Unternehmen1048 – 1052
5. Die Abwehransprüche
10. Kapitel Der Grundtatbestand des § 823 II: die Verletzung eines Schutzgesetzes1053 – 1055
1. Die Anspruchsvoraussetzungen1053
2. Das Schutzgesetz1054
3. Das Verschulden1055
11. Kapitel Der Grundtatbestand des § 826: die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung1056 – 1060
1. Der Schutzumfang des § 8261056, 1057
2. Die sittenwidrige Schädigung1058
3. Der Schädigungsvorsatz1059
4. Typische Fälle einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung1060
12. Kapitel Die Kreditgefährdung1061
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1061
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
13. Kapitel Die Bestimmung zu sexuellen Handlungen1062
14. Kapitel Die Haftung des Geschäftsherrn für Verrichtungsgehilfen1063 – 1069
1. Die Haftung für vermutetes Auswahl- und Überwachungsverschulden1063
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1064
3. Die Anspruchsvoraussetzungen1065 – 1068
4. Der Einwand der Entlastung1069
15. Kapitel Die Haftung für die Verletzung einer Aufsichtspflicht1070 – 1075
1. Die Haftung für vermutetes Aufsichtsverschulden1070
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1071
3. Die Anspruchsvoraussetzungen1072, 1073
4. Der Einwand der Entlastung1074
5. Typische Fälle einer Verletzung der Aufsichtspflicht1075
16. Kapitel Die Haftung des Tierhalters1076 – 1082
1. Das gesetzliche System1076
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1077
3. Die Anspruchsvoraussetzungen1078, 1079
4. Die Entlastung für ein Nutz-Haustier1080
5. Der Tierhüter1081
6. Der vertragliche Haftungsausschluss und die Selbstgefährdung1082
17. Kapitel Die Haftung für den Einsturz eines Gebäudes1083 – 1087
1. Die Haftung für vermutetes Verschulden1083
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Voraussetzungen1084, 1085
3. Anspruchsberechtigter und Anspruchsgegner1086
4. Der Einwand der Entlastung1087
18. Kapitel Die Amtshaftung1088 – 1122
1. Staatshaftung statt Beamtenhaftung1088
2. Die Konkurrenz der Amtshaftung mit anderen Schadensersatzansprüchen1089
3. Die Rechtsfolge der Amtshaftung1090, 1091
4. Das System der Amtshaftung und die Beweislast1092
5. Gläubiger und Schuldner des Schadensersatzanspruchs1093 – 1096
6. Die Staatshaftung nur für hoheitliche Verwaltungstätigkeiten1097, 1098
7. Die Verletzung einer Amtspflicht gegenüber einem Dritten1099 – 1110
8. Der Schaden und seine Verursachung1111
9. Das Verschulden des Beamten1112
10. Das Fehlen einer anderen Ersatzmöglichkeit1113 – 1117
11. Das „Spruchrichterprivileg“1118
12. Der Ausschluss der Amtshaftung durch Versäumung von Rechtsmitteln1119
13. Die Entschädigung für überlange Verfahrensdauer1120
14. Die Notarhaftung1121
15. Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen und des Zeugen1122
19. Kapitel Die Verjährung der Ansprüche aus unerlaubter Handlung1123 – 1129
1. Regelverjährung statt Sonderregel1123
2. Der Beginn der Regelverjährung1124 – 1127
3. Der Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung trotz Verjährung1128
4. Die Einrede der unerlaubten Handlung1129
20. Kapitel Die Produkthaftung1130 – 1134
1. Unerlaubte Handlung oder Gefährdungshaftung1130
2. Die Abgrenzung1131
3. Die Gefährdungshaftung nach dem ProdHaftG1132, 1133
4. Der gesetzliche Haftungsausschluss1134
5. Das Mitverschulden des Geschädigten
6. Verjährung und Ausschlussfrist
21. Kapitel Die Halter- und Fahrerhaftung nach dem Straßenverkehrsgesetz1135 – 1155
1. Das gesetzliche System1135 – 1137
2. Die Halterhaftung: Rechtsfolgen und Voraussetzungen1138 – 1143
3. Der Ausschluss der Halterhaftung1144 – 1146
4. Das Mitverschulden des Geschädigten1147
5. Die mitwirkende Betriebsgefahr des anderen unfallbeteiligten Kraftfahrzeugs1148 – 1152
6. Die Schwarzfahrt1153
7. Sonstige Einwendungen gegen die Halterhaftung1154
8. Die Fahrerhaftung1155
22. Kapitel Die Haftung des Gastwirts für eingebrachte Sachen1156 – 1158
1. Der Anspruch des Gastes auf Schadensersatz1156, 1157
2. Der Haftungsausschluss1158
2. Buch Schuldrecht Allgemeiner Teil oder: Das Schuldverhältnis
21. Teil Das gesetzliche System des Schuldrechts
1. Kapitel Allgemeines und besonderes Schuldrecht1159
2. Kapitel Das Schuldverhältnis als Programm des gesamten Schuldrechts1160 – 1166
1. Der Gegenstand des Schuldverhältnisses1160
2. Die Rechtsfolge des Schuldverhältnisses1161
3. Die Voraussetzungen des Schuldverhältnisses1162
4. Das Schuldverhältnis im engeren und im weiteren Sinn1163
5. Schuldverhältnisse außerhalb des Schuldrechts1164
6. Die Relativität des Schuldverhältnisses1165
7. Schuld und Haftung1166
8. Kein Schuldverhältnis durch unbestellte Leistung
3. Kapitel Die schuldrechtliche Leistung1167 – 1170
1. Das gesetzliche System1167
2. Der Gegenstand der Leistung im Prozess und in der Zwangsvollstreckung1168
3. Die Leistungshandlung und der Leistungserfolg1169, 1170
22. Teil Treu und Glauben
1. Kapitel Ein fundamentaler Rechtsgrundsatz1171 – 1175
1. Der Geltungsbereich1171
2. Die Grundwerte der Verfassung als Maßstab1172, 1173
3. Das Gebot von Treu und Glauben als vielschichtige Generalklausel1174, 1175
2. Kapitel Die Rechtsfolgen von Treu und Glauben1176 – 1188
1. Anspruch oder Einwendung1176
2. Die Ansprüche aus Treu und Glauben1177, 1178
3. Die gebotene Rücksicht auf den anderen1179
4. Die fristlose Kündigung des Dauerschuldverhältnisses1180 – 1188
3. Kapitel Die unzulässige Rechtsausübung und der Rechtsmissbrauch1189 – 1205
1. Die Rechtsfolge1189 – 1191
2. Der unredliche Rechtserwerb1192
3. Die unredliche Verhinderung fremden Rechtserwerbs1193
4. Das widersprüchliche Verhalten1194 – 1196
5. Die Verpflichtung zur sofortigen Rückgabe der geforderten Leistung1197