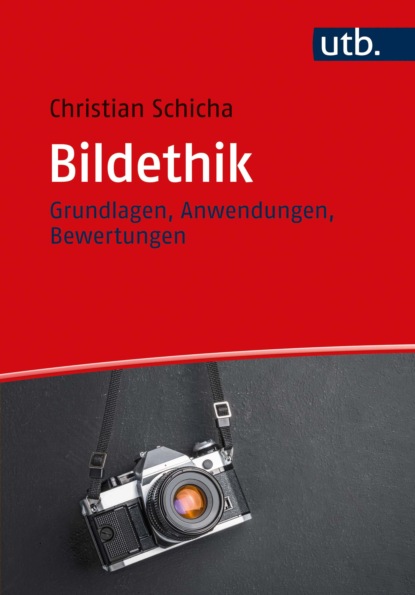- -
- 100%
- +

Dies können ebenfalls Aufnahmen erreichen, die die Konsequenzen des Klimawandels dokumentieren, sofern etwa rasch schwindende Gletscher gezeigt werden. Derartig beeindruckende Katastrophenfotos können einerseits dazu motivieren, sinnvolle Aktivitäten für den Klimaschutz zu beginnen. Andererseits können sie aber eine Abwehrhaltung (Reaktanz) erzeugen, sofern sich Rezipienten mit diesen visuellen Negativbotschaften nicht auseinandersetzen möchten (vgl. Staud 2016). Obwohl aktionsreiche Bilder den Nimbus der Einzigartigkeit verbreiten sollen, bedienen sie in der Regel konventionelle Schemata. Das visuelle Material hat hier einen hohen Konventionalisierungsgrad bei der Darstellung von Kriegshandlungen, Polizeieinsätzen oder gewalttätigen Ausschreitungen, die sich primär an Nachrichtenfaktoren orientieren, bei denen u.a. Konflikte, Auseinandersetzungen und Kontroversen für die Selektion von Nachrichten dargestellt werden (vgl. Staab 1990, Ruhrmann u.a. 2003).
Eine besonders unterhaltsame und auflockernde Funktion hat das Beziehungsbild. bei dem in Magazin- und Nachrichtensendungen beliebten Prinzip der Doppelmoderation. Hier findet die Zuschaueransprache in einem betont theatralisch inszenierten Rollenspiel statt, bei dem neben dem Moderator noch ein Experte für den Sport im Studio sitzt. Dort werden – speziell bei den privat-kommerziellen Anbietern – so genannte Scherzdialoge geführt, um eine lockere Studioatmosphäre zu suggerieren. Beide Moderatoren werden dann gleichzeitig im Bild für die Zuschauer präsentiert.
Die Wirkung des Emotionsbildes kann durch die Strategie forciert werden, ein Schockbild zu zeigen. Dabei werden etwa die Schrecken des Krieges am eindrucksvollsten durch das Frontalbild eines getöteten Opfers dokumentiert. Es haben sich in diesem Kontext einige Schlüsselbilder herausgebildet, die bei den Rezipienten im Gedächtnis haften geblieben sind. Besonders verwerflich waren die Verbrechen amerikanischer Soldaten an den irakischen Gefangenen, die 2004 im Abu-Ghuraib-Gefängnis bei Bagdad misshandelt wurden. Es wurden Scheinhinrichtungen inszeniert, Stromstöße verabreicht und Hunde auf die teilweise nackten Opfer gehetzt. Diese Misshandlungen des Folterskandals mit den lachenden Tätern wurden weltweit verbreitet. Am 28. April 2004 wurden diese Bilder bei CBS im amerikanischen Fernsehen gezeigt (vgl. Beilenhoff 2007, Leifert 2007, Haller 2008a).
Der Idealtyp des Affektbildes ist die Großaufnahme eines Gesichts oder eines anderen Körperteils, das im Detail gezeigt wird, um einen bestimmten Eindruck zu suggerieren. Bilder dieses Typs sind in gewissem Sinne aus dem zeit-räumlichen Zusammenhang eines Geschehens herausgehoben und konzentrieren sich ganz auf eine emotionale Qualität. Sie sind deshalb nicht auf die Großaufnahme beschränkt, sondern schließen unter bestimmten Bedingungen die Naheinstellung ein. Eine Sonderform des Affektbildes ist die Körperdetailaufnahme, die offensichtlich die Absicht verfolgt, Indizien für den emotionalen Zustand oder den Charakter einer Person einzufangen. So wird in politischen Talkshows die Unruhe der am Gespräch beteiligten Protagonisten häufig durch die Kamera eingefangen. Dort ist das nervöse Wackeln mit dem Fuß ebenso zu sehen wie die Schweißperlen auf der Stirn. Durch eine professionell eingesetzte Kameraregie kann es gelingen, einen Politiker entsprechend vorteilhaft und unvorteilhaft wirken zu lassen (vgl. Ontrup/Schicha 2001, Tenscher/Schicha 2002). Bei der Affektzeugenschaft ist die persönliche Betroffenheit der Fotografen als direkte Mitteilung zentral, sofern sie etwa Bilder von zivilgesellschaftlichen Protesten vor Ort machen und somit direkt in das Geschehen eingebunden sind. Es geht hierbei um eine persönliche Betroffenheit, aus der Gefühle von Gemeinschaftlichkeit und Solidarität resultieren können. Schrankweiler (2018) verweist in diesem Zusammenhang auf handygefilmte Amateurvideos von Polizeigewalt in den sozialen Medien. Entsprechende Aussagen in Bild- oder Videoform können durch Zirkulationen im Social Web in Form von Memen verbreitet werden, um die Effekte zu steigern und dadurch politisch wirksam zu werden. Das Teilen dieser Bilder gilt dann als Phänomen memetischer Verbreitung, um eine größtmögliche öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen (vgl. Bernhardt 2020, von Gehlen 2020). Sie treten in satirischer Form bisweilen „bewusst grenzüberschreitend und provokant“ (Grimm/Keber/Zöllner 2019, S. 244) in Erscheinung. Dabei können derartige Bilder bearbeitet und manipuliert werden, um die gewünschte Wirkung zu erreichen.
Das Motivationsbild kann dadurch Aufmerksamkeit erzeugen, dass es sich auf sich selbst bezieht, also autoreflexiv erscheint, indem es die Aufmerksamkeit des Betrachters darauf lenkt, wie es gemacht ist bzw. unter welchen außergewöhnlichen Umständen es entstanden ist. Ungewöhnliche Kameraperspektiven lassen sich dabei auf eine besonders dramatisierende oder psychologisierende Absicht zurückführen. Sie werden bei banalen und unspektakulären Vorgängen eingesetzt, um zusätzliche Reize beim Zuschauer zu wecken, das angebotene Programm zu konsumieren. Konventionelle Handlungen, etwa in Form einer Politikerrede werden dann aus der Froschperspektive gefilmt, um einen visuellen Spannungsbogen aufzubauen.
Beim Schachtelbild wird der Bildschirm geteilt, so dass zwei miteinander sprechende Personen gleichzeitig zu sehen sind. Bei Interviews und Korrespondentenberichten ersetzen die Redaktionen das bekannte Schuss-Gegenschuss-Prinzip durch einen elektronisch inszenierten Dialog auf dem Bildschirm. Durch diese Technik sind die wechselseitigen mimischen und gestischen Reaktionen der beiden Protagonisten zu den jeweiligen Äußerungen des Gegenübers unmittelbar wahrnehmbar. Diese Technik wird weiterhin bei Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern eingesetzt.
Das Beweisbild hat die Aufgabe, in strittigen Situationen als gerechte Entscheidungshilfe zu dienen, sofern die menschliche Perspektive dies nicht leisten kann. Ein Beispiel hierfür ist der Videobeweis im Sport, der z. B. in der Fußballbundesliga eingesetzt wird. Durch Zeitlupen, Wiederholungen und spezielle Techniken kann geprüft werden, ob der Ball die Torlinie vollständig überquert hat, ein Foul- oder Handspiel vorliegt oder Spieler bei Sanktionen durch eine gelbe oder rote Karte vom Schiedsrichter den Regeln zufolge angemessen sanktioniert worden sind. Obwohl Bildinhalte zusätzlich geprüft und erklärt werden müssen, dienen sie dennoch neben den oft trügerischen Erinnerungen als Zeugenschaft für spezifische Ereignisse.

Um spezifische Ereignisse als Erinnerung und Beweismittel zu dokumentieren, können Screenshots von Livestreams, Chatverläufen und Onlinepostings in den sozialen Medien festgehalten werden (vgl. Frosh 2019). Gleichwohl können derartige Aufnahmen verändert und manipuliert werden.
2.9 Bildwahrnehmungen

Die aktuelle Medienrezeption ist zumindest bei den älteren Zuschauern nach wie vor durch das Fernsehen geprägt, dessen Programm oftmals über einen bildorientierten und unterhaltsamen Medienstil verfügt. Gleichwohl werden Bilder nicht mehr ausschließlich über das lineare Fernsehen in Echtzeit rezipiert, sondern zeitversetzt über weitere mobile Endgeräte mit einem digitalen Zugang. Soziale Bildnetzwerke wie die Foto-Sharing-Plattform Instagram sprechen ein breites Spektrum an Nutzern an, die visuelle Inhalte einstellen, anklicken und teilen. Die Gruppe der jugendlichen Rezipienten im Alter von zwölf bis 19 Jahren konzentriert sich primär auf die Internetangebote. Einer repräsentativen Befragung von mehr als 1.000 Personen dieser Zielgruppe im Rahmen der JIM-Studie 2020 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2020) zufolge steht YouTube mit 57 % auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz belegt Whats-App (31 %) vor Netflix (16 %) und Google (14 %).
Visuelle Wahrnehmungen können Zusammenhänge leichter fassbar machen. Sie bleiben länger im Gedächtnis haften als gesprochene oder geschriebene Worte. Es entsteht der Eindruck, dass Bilder einen authentischen Ausschnitt der Wirklichkeit wiedergeben, obwohl die Auswahl der Bilder, die Perspektive des Betrachters und die Schnittfolge dazu beitragen, Bearbeitungen zu ermöglichen (vgl. Forster 2003, Grittmann 2003, Schicha 2003 und 2013b, Godulla 2014, Krämer 2019).
Aus einer normativen Perspektive gilt die hohe Glaubwürdigkeit von Bildern bisweilen als problematisch, da bildliche Informationen weit weniger kritisch rezipiert werden als vergleichbare sprachliche Informationen. Es wird bemängelt, dass durch die visuelle Kommunikation keine Argumentationskette herausgebildet wird. So argumentiert Röll (1998, S. 44):

Dieser Auffassung folgt Leif (2001, S. 9) ebenfalls: „(Inszenierte) Bilder, gut gestylte Stimmungen und überlegt eingesetzte Emotionen verdrängen immer mehr die Argumente oder den redlichen intellektuellen Austausch.“ Die Wahrnehmung wird durch die visuellen Sinneseindrücke beherrscht,

Insgesamt wird der sprachliche Argumentationsstil durch einen bildlichen ergänzt, und die Bilder besitzen nicht mehr nur die Funktion, Sprache oder Texte zu ergänzen oder zu illustrieren. Faktisch werden zentrale Informationen und Emotionen über Bilder transportiert, die unterschiedliche Wirkungen bei den Betrachtern auslösen können.
2.10 Bildwirkungen
Es ist Kroeber-Riel (1993) zufolge davon auszugehen, dass immer mehr Menschen Bildeindrücke zur Grundlage ihrer Überzeugungen machen und die Bildkommunikation einen entscheidenden Beitrag leistet, das Verhalten zu beeinflussen. Einerseits wird Bildern die Eigenschaft zugeschrieben, eine wahrheitsgetreue Abbildung der Wirklichkeit zu bewerkstelligen. Anderseits bestehen Möglichkeiten, Bilder zu inszenieren, zu bearbeiten und zu manipulieren. Dennoch wirkt die bildliche Darstellung in der Regel realistisch. Es gelingt ihr bisweilen stärker, eine emotionale Regung zu erzeugen, als die verbale Codierung von Informationen.
Eine eindimensionale Wirkungsdimension kann bei der Medienrezeption grundsätzlich nicht vorausgesetzt werden. Hall (1980) hat in seinem encoding/decoding-Modell aufgezeigt, dass die Vermittlung von Informationen im Rahmen der Massenkommunikation keinen transparenten Prozess im Verständnis eines stabilen Senders/Empfänger-Modells darstellt. Hall differenziert zwischen drei unterschiedlichen Lesarten eines medialen Produktes:
Bei der Vorzugslesart (dominant-hegemonic position) wird der durch den Text und die Bilder strukturierte und begrenzte Interpretationsspielraum vom Rezipienten weitestgehend übernommen. Insofern erfolgt hier eine Zustimmung hinsichtlich der vorgelegten Inhalte.
Bei der ausgehandelten Lesart (negotiated position) werden die in einem Beitrag dominierenden Ereignisse von den Rezipienten zwar akzeptiert, jedoch in den eigenen Wissens- und Erfahrungshorizont und weitergehende Zusammenhänge eingeordnet. Die kodierte Bedeutung wird nicht einfach übernommen, sondern mit den subjektiven Hintergründen und Erfahrungshorizonten assoziiert. Es liegt demzufolge eine kritischere Haltung als bei der Vorzugslesart vor.
Bei der oppositionellen Lesart (oppositional code) werden die dargestellten Informationen rundweg abgelehnt und in einem alternativen Bezugsrahmen interpretiert (vgl. weiterführend Winter 1999, Lobinger 2012, Schicha 2021b).
Es wird in diesem Verständnis von einem produktiven Zuschauer (vgl. Winter 2010) ausgegangen, der über eigene Wertmaßstäbe bei der Beurteilung von Medieninhalten verfügt. Diese Vorstellung basiert auf der Modellvorstellung eines aktiven Publikums, das die Botschaft für sich selbst autonom interpretiert und bewertet (vgl. Machart 2008). Dies gilt weiterhin bei der Interpretation von Bildinhalten:

Insofern kann es nicht die Bildwirkung geben, da jeder Betrachter über unterschiedliche Haltungen, Bewertungsmaßstäbe und Präferenzen verfügt:

So sind etwa Studien, die die Wirkung von Mediengewalt analysiert haben, zu dem Ergebnis gekommen, dass Gewaltdarstellungen in Abhängigkeit von der dramaturgischen Einbettung sozialverträgliche oder -unverträgliche Effekte erzeugen können. Sie hängen zusätzlich vom sozialen Umfeld, den Einstellungen und Erfahrungen sowie der psychischen Dispositionen des jeweiligen Rezipientenkreises ab (vgl. Grimm 1999). Nach einer weiteren qualitativen Rezeptionsanalyse auf der Basis von Gruppendiskussionen zeigte sich, dass das Spektrum der emotionalen Reaktionen auf Mediengewalt von Angst über Langeweile bis hin zu Vergnügen und Irritation reicht (vgl. Röser 2000). Nach Sichtung der wissenschaftlichen Befunde der Medien-und-Gewalt-Forschung kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass auftretende Aggressionen ein Phänomen darstellen, das von zahlreichen Faktoren abhängt und nicht allein durch die Rezeption von Mediengewalt verursacht wird (vgl. Zipfel 2021).
3 Normative Zugänge
Im Gegensatz zur Bildethik, die auf freiwillige Reflexion und Steuerung bei der Beurteilung der angebotenen visuellen Inhalte setzt, hat das Bildrecht auf der Basis verbindlicher Gesetze die Möglichkeit, entsprechende Sanktionen bei Verstößen festzulegen und durchzusetzen. Beide Zugänge orientieren sich an Grundwerten wie dem Schutz der Menschenwürde, der Durchsetzung von Freiheit und Demokratie, dem Postulat von Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit sowie der Einhaltung der Menschenrechte. Als Leitbilder gelten die Förderung des Pluralismus, die Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung (vgl. Losch 2006).
3.1 Bildrecht
Das Bildrecht ist Teil des Medienrechtes, das das Presserecht, Rundfunkrecht und Multimediarecht einschließt. Medien in Demokratien vom Typ der Bundesrepublik Deutschland dienen der pluralistischen Meinungsbildung. Sie fungieren als Wirtschaftsfaktor und Kulturträger. Dabei übernehmen sie im Rahmen der so genannten Grundversorgung eine Bildungs-, Informations- und Unterhaltungsfunktion. Zu den Mediengrundrechten gehören u.a. die Meinungs-, Informations- und Kunstfreiheit sowie das Zensurverbot.
In Bezug auf das Eigentum von Texten, Grafiken sowie bewegten und unbewegten Bildern greift das Urheberrecht, das die Rahmenbedingungen der Besitzverhältnisse und Nutzungsrechte festlegt (vgl. Steckler 2004). Weiterhin existieren Gesetze zum Schutz gegen jugendgefährdende Medieninhalte in Wort und Bild (vgl. Fechner 2001).
Fotos als Lichtbildwerke sind urheberrechtlich geschützt, sofern eine gewisse Gestaltungshöhe in Form einer besonderen Perspektivenwahl oder Lichteinstellung vorgenommen worden ist. Dies gilt zusätzlich für Filme aus dem fiktiven und dokumentarischen Bereich. So stellt die bloße Aufzeichnung eines Sportereignisses kein schützenswertes Filmwerk dar. Gleichwohl können die Rechteinhaber der Veranstaltung entscheiden, welcher Medienanbieter zu welchem Umfang auf welchem Kanal z. B. ein Fußballbundesligaspiel übertragen darf (vgl. Kaessler 2007).
Grundsätzlich dürfen Bildnisse, zu denen Fotos, Film- und Fernsehaufnahmen, Fotomontagen und weitere Formen des künstlerischen Schaffens wie Zeichnungen und Gemälde gehören, nur mit der Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.
Es ist bei der juristischen Bewertung hinsichtlich einer angemessenen Verbreitung von Bildern aber zu differenzieren, ob es sich um relative und absolute Personen der Zeitgeschichte handelt. Als absolute Personen der Zeitgeschichte werden diejenigen Akteure klassifiziert, bei denen ein hohes öffentliches Interesse über deren Leben besteht. Dazu gehören unter anderem prominente Politiker, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler, Erfinder, Künstler, Schauspieler und Sportler.
Relative Personen der Zeitgeschichte treten in der Regel mit Bezug auf ein bestimmtes Ereignis in den Blick der Öffentlichkeit. Dazu gehören zum Beispiel Vertreter der Judikative (Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte), Legislative (Abgeordnete) oder Exekutive (Polizisten) und Begleiter von Prominenten, die als absolute Personen der Zeitgeschichte klassifiziert sind, aber auch Verbrecher (vgl. Leifert 2007). Sie genießen einen größeren Schutz am eigenen Bild, da ihre Aktivitäten kein derart großes Interesse umfassen wie die absoluten Personen der Zeitgeschichte, bei der das öffentliche Interesse stärker eingeschätzt wird.
Das Recht am eigenen Bild, das weitgehend im Kunst- und Urhebergesetz (KUG) geregelt ist, verbietet es anderen, entsprechende Aufnahmen ohne Einwilligung der Betroffenen zu verbreiten oder öffentlich zur Schau zu stellen (vgl. Petersen 2003, Sachsse 2003, Dörr/Schwartmann 2008, Isermann/Knieper 2010). Dies gilt weiterhin für Bilder von Prominenten. Hierbei hat das sogenannte Caroline-Urteil einen wichtigen Beitrag geleistet (vgl. Ladeur 2007, Ruchartz 2007, Rau 2008, Keller/Häger 2011). Es gelangte nach einer Klage der Prinzessin gegen Paparazzi-Fotografien aus ihrem Privatleben nach mehreren Prozessen u.a. beim Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht zu folgender Einschätzung:

Aufnahmen von privaten Feiern der Prominenten dürfen ohne Einwilligung der Beteiligten demnach nicht mehr publiziert werden. Es geht hierbei demzufolge um das Spannungsfeld des öffentlichen Interesses einerseits und den Schutz der Privatsphäre andererseits. Letztere wird als Bedeutungsraum klassifiziert. Grimm und Krah (2016, S. 178) zufolge handelt es sich dabei um den Bereich,

Gleichwohl existieren Einschränkungen derartiger Beschränkungen, die einige Bereiche umfassen. Dazu gehören Bilder, bei denen die Personen nur als Beiwerk im Rahmen einer Landschaft oder einer anderen Örtlichkeit abgebildet sind, Bilder von offiziellen Veranstaltungen, Versammlungen und Demonstrationen, an denen die abgebildeten Personen teilgenommen haben, sowie Bilder, die im Sinne eines höheren Interesses der Kunst dienen (vgl. Gruber 2006, Leifert 2007). Insofern handelt es sich stets um eine Abwägungsentscheidung nach spezifischen Kriterien, ob Bilder veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Relevant ist also, ob es sich um eine öffentliche Veranstaltung mit Prominenten handelt, in der z. B. Repräsentationspflichten vollzogen werden oder um privates Agieren im öffentlichen oder privaten Raum. Die Privat- und Intimsphäre von Prominenten und Nicht-Prominenten ist aber stets zu schützen.

Diese Grenze lässt sich anhand des folgenden Beispiels verdeutlichen. Trotz des angeblich großen öffentlichen Interesses an den Aufnahmen von Kate Middleton, der Ehefrau des englischen Prinzen William, die in ihrem Strandurlaub mit nacktem Oberkörper fotografiert worden ist, wurde nach erstem Abdrucken durch eine italienische Illustrierte die Weiterverbreitung dieser Bilder juristisch untersagt (vgl. Lamprecht 2013).
Offizielle Auftritte in sozialen Zusammenhängen z. B. von Amtsträgern dürfen hingegen durch Bilder stets dokumentiert und publiziert werden (vgl. Mast 2004).
Bei nicht prominenten Personen dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung der Abgebildeten verbreitet und ausgestellt werden. Dabei handelt es sich um Fotos, Film- und Fernsehaufnahmen, aber auch um Zeichnungen und Gemälde. Die Privat- und Intimsphäre sind hier besonders geschützt. Dazu gehören öffentlich zugängliche Räumlichkeiten wie Toiletten, Umkleidekabinen und ärztliche Behandlungszimmer. Der leichtfertige und unreflektierte Umgang mit Bildern im Alltag kann also justiziabel sein. Schließlich war es noch nie so einfach und kostengünstig, Aufnahmen mit dem Smartphone zu machen und zu verbreiten. So werden Bilder von Opfern bei Verkehrsunfällen regelmäßig gefilmt und ins Internet gestellt. Was harmlos als das Teilen von Informationen klassifiziert wird, ist faktisch eine Form von Voyeurismus und Sensationsgier, bei der unsensible Hobbyfotografen das Schicksal von Verletzten zum Zwecke der eigenen Aufmerksamkeitssteigerung und Sensationsgier instrumentalisieren. Der Beobachter mit dem Handy wird zum Täter, indem er das Grauen dokumentiert und weiterverbreitet. Durch dieses Verhalten werden Persönlichkeitsrechte der Opfer ebenso verletzt wie die Gefühle deren Angehörigen. Dies gilt zusätzlich für so genannte Spannerbilder, bei denen Menschen ihre Opfer z. B. heimlich in Umkleidekabinen und Waschräumen ablichten und diese Bilder dann ins Netz stellen. Das heimliche Fotografieren und Filmen unter den Rock (Upskirting) oder in den Ausschnitt von Frauen ist ebenso eine Straftat wie das Aufnehmen von Unfalltoten. Seit Mitte 2020 droht in Deutschland bei einem derartigen Verhalten eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren (vgl. o.V. 2020).