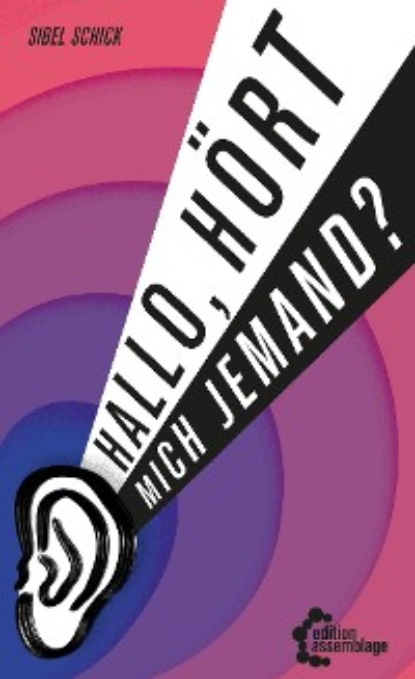- -
- 100%
- +
Was ist schon Integration, wenn nicht die Ermöglichung der Teilhabe? Und wenn diese Integration gescheitert sein soll, was können die Betroffene dafür, außer zu versuchen auf die Missstände hinzuweisen? Wem keine Teilhabe ermöglicht wird, kann nicht mitgestalten. Wer nicht mitgestalten darf, kann für sich keine Teilhabe ermöglichen. Es ist ein Teufelskreis.
Man könnte jetzt denken, dass man sich ohne Wahlrecht auch anderweitig einbringen kann. Zum Beispiel bei einem lokalen Verein. Allerdings kämpfen viele gemeinnützige Vereine, Verbände, Organisationen und Projekte ums Überleben. 2019 wurden Organisationen wie Attac, Campact und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten die Gemeinnützigkeit entzogen. Für betroffene bedeutet das vor allem eine finanzielle Katastrophe, die sich bis hin zur Insolvenz strecken kann. Aber auch, dass sie zum Beispiel kein Mitglied von Dach- und Fachverbänden mehr werden dürfen und sich nur begrenzt organisieren können. So ist auch die politische Arbeit für Menschenrechte und Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit in Deutschland voller Hürden.
Seit Anfang des Jahres werden bundesweit zwei Dritteln der bis 2019 geförderten Demokratisierungsprojekte nicht mehr finanziert. Es geht um ca. 200 Projekte, die sich beispielsweise gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit und andere Formen der Menschenfeindlichkeit einsetzen. In vielen dieser Strukturen arbeiten auch Menschen, die selber betroffen sind, und sich teilweise gegen ihre eigene Margina-lisierung wehren. Beruflich. Teilweise Vollzeit. Sie studieren, bilden sich zu Expert*innen aus und kämpfen. Während Menschen, die nicht marginalisiert sind, ihren Neigungen und Wünschen entsprechend einen Berufsweg wählen können, gehen viele Betroffene einen teils schmerzhaften, kräftezerrenden Weg für eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt sein sollen – nicht nur theoretisch, sondern auch in Wirklichkeit. Viele dieser Menschen stehen jetzt seit Anfang des Jahres ohne Arbeit da, weil die Strukturen, in denen sie tätig waren, nicht mehr gefördert werden.
Die Arbeit gegen Menschenfeindlichkeit in Deutschland ist eine Frage des Überlebens. Es ist kein Hobby.
Der Ausschluss aus politischer Teilhabe ist die eine Seite der aktuellen Lage. Der Hass, der den Menschen, die sich einen Weg in die Strukturen erkämpfen, entgegenschlägt, eine andere. Sener Sahin aus dem bayrischen Wallerstein sah sich sogar genötigt, seine Kandidatur für die CSU als Bürgermeister zurückzuziehen, weil ihm als Muslim die nötige Unterstützung verwehrt wurde.
Der Ausschluss funktioniert allerdings auch nach der Ankunft in den Strukturen. Als Belit Onay 2019 zum ersten Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt mit einer Migrationsgeschichte gewählt wurde, wurde er über die sozialen Netzwerke mit einer rassistischen Hasswelle konfrontiert. In einem Interview mit Der Spiegel9 sagte Onay, dass es Menschen mit Migrationsgeschichte schwerfalle, in deutschen Parteien Fuß zu fassen, weil ihnen die Netzwerke fehlen, die sie innerhalb der Parteien benötigen. Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte würden oft über ihre Familie in diesen Netzwerken landen. Zudem fehle es an Interesse, weil es kaum Vorbilder in der deutschen Politik gebe. Dass die Repräsentation eine entscheidende Rolle bei der Berufsentscheidung spielt, ist bereits im Zusammenhang mit der Frauenquote ausgiebig diskutiert und belegt worden.
Es geht aber um mehr als Quoten: Am 15. Januar gab es Schüsse auf das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle. Der in Senegal geborene Politiker zog 1986 nach Deutschland und schaffte es trotz aller Hürden in den Bundestag. Im Gespräch mit Zeit Online10 erklärte er die vermehrten Angriffe auf Politiker*innen und Einschüchterungsversuche der Minderheiten und Andersdenkenden damit, dass innerhalb der letzten zwei Jahre die Aggression zunehme – nicht nur im Netz, sondern auch in der Politik: „In den Debatten werden Abneigungen deutlicher zum Ausdruck gebracht als früher, etwa gegen Minderheiten. Und das kann dann dazu führen, dass der ein oder andere Mensch, der vielleicht isoliert lebt und Zugang zu Waffen hat, zur Tat schreitet.“
Wer also im Bundestag oder den Landtagen sitzt und was dort gesagt wird, hat einen direkten Einfluss darauf, was auf der Straße passiert.
Als 2018 das Hashtag #MeTwo ins Laufen gebracht wurde, haben viele betroffene Menschen von traumatischen Rassismuserfahrungen in der Schule durch Lehrkräfte berichtet. Dass rassistische Diskriminierung in deutschen Schulen systematisch ist, belegt eine Studie11 der Universität Mannheim: Kinder mit anders klingenden Namen werden bei gleichen Leistungen schlechter bewertet. Während jede*r dritte Schüler*in einen sogenannten Migrationshintergrund hat, beträgt der Anteil der Lehrpersonen mit Migrationshintergrund lediglich acht Prozent12. Kinder, die Rassismuserfahrungen machen, erhalten auch weniger Gymnasialempfehlung und haben später geringere Chancen auf einen akademischen Abschluss. Die logische Schlussfolgerung: Diese werden u.a. von dem Beruf als Lehrkraft ausgeschlossen – ein weiterer Teufelskreis. Der Karriereweg als Lehrkraft ist keine Ausnahme. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, werden auch in anderen Berufswegen mit Ausschlüssen konfrontiert. So wüssten zum Beispiel Jugendliche mit Migrationshintergrund wenig über die Ausbildungsmöglichkeiten und deren Bedingungen im öffentlichen Dienst, berichtete Annemie Burkhardt, ehemalige Geschäftsführerin des Berliner Qualifizierungszentrum für Migrantinnen und Migranten, im Gespräch13 mit der Heinrich-Böll-Stiftung 2014. Laut einer Studie14 des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit von 2016 müssen Frauen mit Kopftuch vier Mal mehr Bewerbungen schicken, bis sie zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Zudem erhöht sich die Diskriminierung, je höher die Position ist: So müsse die Bewerberin mit Kopftuch für eine Stelle in der Bilanzbuchhaltung 7,6 Mal so viele Bewerbungen verschicken als etwa Sandra Bauer, für eine Stelle als Sekretärin müsse sie nur 3,5 Mal mehr Bewerbungen schreiben. Je größer die Karrierewünsche, desto größer die Diskriminierung.
Viele der zivilgesellschaftlichen Strukturen, die sich gegen Ausschlüsse von Minderheiten einsetzen, bemühen sich aufgrund der oben geschilderten Missstände u.a. für interkulturelle Öffnung deutscher Institutionen. Nur wenn die diskriminierenden Strukturen hinterfragt und offengelegt werden, können sie auf Dauer abgeschafft werden. Der Rassismus, der zum Ausschluss aus den Institutionen führt, ist nämlich derselbe Rassismus, der in Form von körperlicher Gewalt bis hin zu Waffengewalt vorkommen kann: Von brennenden Unterkünften für geflüchtete Menschen bis hin zu den NSU-Morden und dem Umgang damit. Die strukturelle Diskriminierung wirkt wie ein Katalysator, wenn es darum geht, Gewalt auf Minderheiten zu legitimieren.
Während es für viele selbstverständlich ist, die Polizei zu rufen, wenn sie Unrecht erfahren, gibt es zum Beispiel die Anwältin Seda Başay-Yıldız, die die NSU-Opfer bzw. ihre Angehörigen vertritt, und Morddrohungen erhält, die als „NSU 2.0“ unterschrieben und von einer Frankfurter Polizeiwache herausgeschickt werden. Die Kontinuität des rassistischen Mordens, sei es der Fall von Oury Jalloh, die NSU-Morde oder der rechtsterroristische Anschlag in Hanau, schüchtert Menschen nicht nur ein, sondern schlägt auch kollektive Wunden. Solange keine vollständige Aufklärung folgt, werden Traumata von Generation zur Generation weitergegeben.
Bisher hat sich die Mehrheitsgesellschaft nicht ausreichend für ihr Schicksal interessiert, das hat sie über die vergangenen Jahre mehrfach bewiesen. Es ist zu wenig bis nichts passiert. Das muss sich ändern.
20 Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte leben zurzeit in Deutschland, nur die Hälfte hat die deutsche Staatsbürgerschaft und somit das Wahlrecht. Hierbei geht es um die politischen Interessen von mehr als drei Mal so vielen Menschen, die bei der Bundestagswahl 201715 die AfD wählten. Was wäre, wenn Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft wählen dürften?
Wenn sich die Mehrheit nicht fürs Schicksal der Minderheiten interessiert, so müssen diese ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Denn diskriminieren und gleichzeitig alle Wege nach Außen sperren, sodass sie sich nicht befreien können – so geht’s nicht. Alle, die seit mehreren Jahren in Deutschland leben und ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, verdienen das Wahlrecht und müssen wählen dürfen. Und zwar nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch bei den Landes- und Bundestagswahlen.
Was wäre, wenn die Demokratie so gestaltet worden wäre, dass alle von ihr profitieren könnten? Was wäre, wenn die repräsentative Demokratie auch wirklich so gestaltet wäre, dass nicht nur manche repräsentiert werden, sondern alle? Es wäre nicht nur der frische Wind, den Deutschland so bitter nötig hat. Es wäre höchste Zeit.
Deutschland brennt
25.02.2020, Missy Magazine
Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem Worte nichts mehr bedeuten.
Ein Mann, dessen Namen ich bewusst nicht erwähnen werde, tötete am 19. Februar in Hanau zehn Menschen. Neun davon nahm er aus rassistischen Motiven das Leben.
Als die Eilmeldung zu Hanau eintraf, suchte ich in den Nachrichten nach einem Hinweis zum Täter. Ein Angriff auf Shisha-Bars, in Deutschland stigmatisierte Orte, beunruhigte mich. Bekanntermaßen stehen Hinweise zum Äußeren oder der vermeintlichen Herkunft der Täter*innen in Presse- und Polizeimeldungen nur, wenn diese nicht weiß sind – à la „südländischen“ oder „nordafrikanischen Typs“. Als ich keine Hinweise fand, war klar: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen rechtsextremen Angriff handelt. Weitere Nachrichten bestätigten dies.
Der mutmaßliche Täter war ein Rassist mit Erlaubnis zum Waffenbesitz, weil er Mitglied in einem Schützenverein war. Wie konnte es so weit kommen, fragt sich die deutsche Öffentlichkeit. Eine der Antworten ist: Rassistische Äußerungen von weißen Deutschen bleiben in der Regel ohne Konsequenzen. Der Mann, der im Juli 2019 in Wächtersbach einen jungen Mann aus Eritrea anschoss, hatte seinen Plan beispielsweise offen und groß angekündigt. Das interessierte nur absolut keinen und niemand informierte die Polizei. Er konnte seinen Plan ungestört umsetzen.
„Das war die Tat eines psychisch Kranken! Er war verwirrt, hatte Wahnvorstellungen!“, sagt die deutsche Öffentlichkeit und atmet auf. Sie ist erleichtert, denn sobald Rassismus zur Krankheit erklärt wird, kann man sich zum einen sauber davon distanzieren, zum anderen hat man eine einfache Lösung gefunden, ohne sich anzustrengen. Doch so einfach ist es nicht. Rassismus in Deutschland ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und keine psychische Erkrankung.
Vor einer Weile traf ich mich mit Freundinnen in einer Bar. In unserem Gespräch ging es irgendwann um Shisha-Bars und eine der Freundinnen bezeichnete diese wiederholt als „Fotzenbars“. Dieses Wort verletzte mich sehr, denn damit hat sie Shisha-Bar-Besucherinnen gleichzeitig rassistisch und misogyn abgewertet. Jede Freund*innenschaft, die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, mit weißen Menschen schließen, ist ein Risiko, Diskriminierungserfahrungen zu machen oder zumindest verletzt zu werden. Seitdem kam mir jeden Tag dieses Wort in den Sinn und schmerzte. Aber nach dem Anschlag in Hanau verwandelte sich mein Schmerz in Wut.
Hanau stellt Deutschland vor eine Prüfung und zwar nicht aufgrund der Dimension dieses Horrors, sondern auch, weil es so kurz vor Karneval passiert ist. Bereits kurz darauf kamen die ersten Karnevalsbilder an, auf Social Media und in Chatgruppen. Ganze deutsche Städte feierten so, als sei nichts passiert. Als hätte nicht gerade erst ein Nazi aus der Mitte der Mehrheitsgesellschaft neun Menschen ermordet. Als würden die alltägliche Abwertung und das Stigma von Shisha-Bars nicht damit zusammenhängen, dass diese zur Bühne von Bluttaten gemacht wurden.
Markus Söder sagte zwar seinen Faschingsempfang ab und die Stadt München folgte mit Absagen zu großen Karnevalssitzungen. Unter den Meldungen darüber regten sich jedoch viele auf: Eine Schweigeminute hätte gereicht, hieß es da unter anderem. Die Stadt München kündigte daraufhin an, dass die Feierlichkeiten doch noch stattfinden. Köln und Düsseldorf verkündeten, dass es in den Umzügen „Hanau-Wagen“ geben werde. Deutsche lassen sich ihren Karneval nicht nehmen, egal, wie viele eben erst durch einen rechtsterroristischen Anschlag ermordet worden sind. Angehörige der Opfer müssen sich mit Karnevalswagen und Clowns oben drauf zufriedengeben.
Auch in Hamburg reichte eine Schweigeminute aus. Am Freitag, also eine Woche nach dem Anschlag, nahmen dort laut Polizeiangaben 20.000 Menschen an der Fridays-for-Future-Demonstration teil, zur Demo am Samstag in Hanau waren es nur 6.000. Natürlich beschäftigten sich die Redner*innen in Hamburg auch mit Hanau, allerdings nebenbei. Denn das ist ein rassistischer Anschlag in Deutschland: ein Nischenthema. Welch ein Zeichen wäre gesetzt worden, wenn die Hamburger FFF-Demo sich an die in Hanau angeschlossen hätte! Aber Priorität war offenbar zu zeigen, dass FFF anders als von Kommentator*innen behauptet doch nicht stirbt. Menschen, die betroffen sind, können sich allerdings ihre Prioritäten nicht aussuchen. Bei ihnen geht es ums dringende Überleben. Deutschland brennt. Die Bestandaufnahme der letzten zehn Monate zeichnet ein klares Bild: Ein Mann tötet Walter Lübcke, der Tatverdächtige ist ein bekannter Nazi. In Halle greift ein Rechtsextremer eine Synagoge an, tötet zwei Passant*innen. In Wächtersbach schießt ein Rassist einen jungen Mann aus Eritrea an. In Halle wird auf das Büro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby geschossen. Ein rechtsextremes Netzwerk, das wohl plante, in zehn Bundesländern Moscheen anzugreifen, um dort Betende zu morden, wird aufgedeckt, zwölf Männer werden festgenommen. Ein Mann in Hanau erschießt zehn Menschen, neun davon aus rassistischen Motiven. Zwei mutmaßliche Brandanschläge in Döbeln – in Gebäuden, in denen sich eine Shisha-Bar und ein Döner-Imbiss befinden. Schüsse auf eine Shisha-Bar in Stuttgart. Die letzten beiden Vorfälle erst drei Tage nach Hanau. In diesem brennenden Deutschland sind also nicht alle gleichermaßen schutzlos. Deshalb ist es auch völliger Quatsch zu sagen, dass dies Angriffe „auf uns alle“ seien.
Während deutsche Medien die Namen der Angehörigen von den Opfern und anderen Interviewten ständig verwechselten oder falsch schrieben und u. a. AfD-Politiker*innen dazu befragten, fielen relativierende Fragen wie, ob „Multikulti gescheitert“ sei. Sigmar Gabriel fuhr in einem Tweet schamlos den Hufeisenkurs und setzte den Hanau-Anschlag mit brennenden Mülltonnen gleich. Kaum eine Kultur- oder Sportveranstaltung wurde abgesagt, die Normalität blieb ungestört. Das ist die Wertschätzung, die den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die Angst um ihr Leben haben müssen, gezeigt wird: Betroffenen Menschen bleiben Schweigeminuten, Karnevalssitzungen, dreiste Fragen und entmenschlichende Thesen. Sie werden mit ihrer Wut und Angst alleine gelassen.
Bei einem Terroranschlag, der sich auf die weiße Mehrheitsgesellschaft gerichtet hätte, wäre die Reaktion womöglich anders ausgefallen. Die Opfer wären echte Menschen mit eigener Geschichte und Persönlichkeit, es wären Individuen. Man sollte keine Opfer gegen andere ausspielen, hier geht es um etwas anderes: der Schmerz wird unterschiedlich bewertet. Deshalb findet das Glücksbärchen-Aktivismusvideo mit dem Schauspieler Lars Eidinger, in dem er in Bezug auf Hanau von Liebe spricht und dabei weint, mehr Resonanz als Videos von betroffenen Menschen, in denen sie konkret über rassistische Strukturen sprechen und Konsequenzen einfordern. Anschläge mit nicht weißen Opfern werden nicht als Katastrophen wahrgenommen, sie lösen keine flächendeckenden, konsequenten, substanziellen Reaktionen in der Mehrheitsgesellschaft aus. Selbst in so einer Situation wird betroffenen Gruppen kaum zugehört. Solidarität bleibt vereinzelt und nicht bedingungslos, sondern wird abhängig gemacht von dem Ausmaß der Wut der Person, die spricht. Kann sein, dass du gerade deinen Cousin verloren hast oder Angst um dein Leben hast, aber bloß nicht aggressiv darüber sprechen und von den Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft klare Positionen einfordern. Wo würden wir denn sonst landen?
So wird die Botschaft eindeutig: „Euer Schicksal interessiert uns zwar ein bisschen, aber nicht sehr, nicht immer, nicht überall. Wir sehen ein, dass es schlimm ist, was in Hanau passiert ist, möchten aber keine Rücksicht nehmen, sondern einfach in Ruhe feiern. Und wenn das schlechte Gewissen ballert, waschen wir es mit Videos weinender weißer Schauspieler rein.“ Das macht Menschen, die ohnehin zur Zielscheibe gemacht werden, anfälliger für weitere Angriffe. Das bestätigen auch Döbeln und Stuttgart.
Die weiße Mehrheitsgesellschaft fühlt erst Betroffenheit, wenn sie selbst betroffen ist, wenn Weiße bewusst als Ziel gesetzt werden. Alles, was nicht weißen Menschen passiert, bleibt zunächst erst mal zweitrangig. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland sind nicht überrascht über die letzten Ereignisse. Wenn die Mehrheitsgesellschaft überrascht ist, liegt das nur daran, dass sie bisher nicht zugehört und stattdessen konsequent weggeschaut hat.
Das Problem heißt Rassismus
27.07.2018, Missy Magazine
Mesut Özil hat sich mit einem Monster fotografieren lassen, darüber müssen wir uns nicht streiten. Aufgrund dieses Fotos von Özil ein Bekenntnis zu Deutschland zu fordern, liegt dennoch alleine an der Migrationsgeschichte seiner Familie und ist Rassismus in seiner reinsten Form. Vieles, was Recep Tayyip Erdoğan verkörpert, bleibt den Deutschen nicht erspart: Bei der Bundestagswahl 2017 haben über 20 Millionen Wahlberechtigte rechte und rechtsradikale Parteien gewählt. Deutsche können sich also nicht leisten, so zu tun, als sei ihr Land komplett frei von Menschen, die sich ein faschistisches System wünschen, als wäre das Land endgültig entnazifiziert. Während die AfD bei jeder Wahl ihre Ergebnisse verbessert, können Deutsche nicht so tun, als wäre Faschismus bloß Geschichte, als hätte Deutschland damit abgeschlossen. Und ohnehin, die Bundesregierung ist im Kuschelkurs mit Erdoğan und der AKP. Mit dem Flüchtlingsabkommen und dem Waffenhandel trägt sie aktiv zu Menschenrechtsverletzungen bei. Mit der öffentlichen Unterstützung wie Teezeremonien wird das Bild vermittelt, in der Türkei sei alles in Ordnung: Dass die Zivilgesellschaft zerstört ist, beinahe alle Regierungskritiker*innen und Oppositionspolitiker*innen im Knast sitzen und jährlich über 300 Frauenmorde stattfinden, ist für die Bundesregierung gut verträglich. Sie muss sich nicht rechtfertigen. Wenn es einen Hoffnungsschimmer gibt, dann ist es die Sichtbarkeit, die Menschen mit Rassismuserfahrungen dieser Tage erlangen. Seit Donnerstag teilen sie diese Erfahrungen in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #MeTwo. Ein Blick auf die Tweets zeigt, dass Rassismus in Deutschland nicht nur ein fester Bestandteil des Alltags ist, sondern auch strukturell und institutionell stattfindet. Manchmal ist er offensichtlich, oft aber heimtückisch und subtil. Was Özils Rücktritt also ausgelöst hat, ist keine „Integrationsdiskussion“, sondern eine Rassismusdiskussion. Deutschland hat kein Integrationsproblem, es hat ein Rassismusproblem. Sowohl der Begriff „Integration“ als auch die deutsche Debatte um ihn herum sind rassistisch. Sie beruhen auf der Annahme, dass bestimmte Menschen so anders seien, dass sie sich anpassen müssten. Im Mai schrieb Lara Fritzsche fürs SZ-Magazin: „Es ist ein Paradoxon, dass die Frau mit Kopftuch erst da zum Problem wird, wo ihre Integration gelungen ist.“ Die Frau mit Kopftuch landet also wider Erwarten in der Mitte der Gesellschaft, die Hürden auf ihrem Weg aber werden auch hier auf ihre Kultur reduziert, anstatt dass die strukturellen und institutionellen Rassismuserfahrungen entfaltet werden. „Eine gelungene Integration“ beinhaltet, dass gewisse Menschen es eh nicht schaffen würden, es sei denn, sie werden „angepasst“.
Jemanden integrieren – es müsste heißen: Räume öffnen, Hürden zerstören, Chancen geben, Teilhabe ermöglichen. Was ich lernen musste, als ich 2009 nach Deutschland gezogen bin: erstens die Sprache, zweitens den Umgang mit der Tatsache, dass Deutsche nicht spontan sind, drittens, dass sie dich unter der Woche schon um 22 Uhr nach Hause schicken, weil sie am nächsten Tag arbeiten müssen. Mehr nicht. Integration war nicht mein Problem. Mein Problem sind eher die Rassismuserfahrungen, die ich mache, und der Stress, den mir der unsichere Status gibt. Ich muss mir aber trotzdem ständig anhören, wie gut integriert ich sei, und ich finde es sehr, sehr arrogant.
Rassismus in Deutschland ist kein Mythos, er existiert und hat einen hohen Preis für viele Menschen. Wir sollten nicht darüber sprechen, inwiefern die anderen angepasst werden müssen, sondern darüber, dass Menschen bei der Jobsuche ausgeschlossen werden und wie wir das ändern können. Auch darüber, dass Menschen keine Wohnung bekommen, weil sie keinen „deutsch“ klingenden Namen haben. Dringend müssen wir anfangen, darüber zu sprechen, dass Menschen auf der Straße angespuckt und körperlich angegriffen werden und Schutz- und Präventionsmaßnahmen entwickeln. Wir müssen Lösungen finden. Ob ein Mensch, der andere körperliche und äußere Merkmale hat, wie Hautfarbe oder Kopftuch, automatisch jemand ist, die*der verändert werden muss, und ob sie es verdienen, dass man sich mit ihnen solidarisiert? Darüber müssen wir nicht diskutieren.
Positioniert euch
04.09.2018, Missy Magazine
In Chemnitz kam letzte Woche der Rassismus zum Ausbruch: Neonazis sind auf die Straße gegangen, riefen rassistische Parolen, zeigten den Hitlergruß, jagten rassifizierte Menschen durch die Straßen und bedrohten diese mit dem Tod. Das heißt, sie sind willkürlich und grundlos auf Menschen losgegangen, die sie aufgrund ihres Aussehens für nicht-deutsch gehalten haben, als seien diese Krähen, die von der Saat weggescheucht werden müssen.
Der Auslöser des Neonaziaufmarsches ist der gewaltsame Mord an Daniel H. am vergangenen Sonntag. Ein Blick auf sein Facebook-Profil jedoch erweckt den Eindruck, dass sein Tod den Neonazis möglicherweise Freude bereitet hätte, wäre der Täter kein Migrant. Daniel H. war nämlich nicht weiß und er war ein Linker, der sich öffentlich gegen Pegida, AfD und Co geäußert hat. Offenbar kein Grund für die Neonazis, seinen Tod nicht als Anlass zu nehmen, um für rassistische Meinungsmache zu mobilisieren und Menschen körperlich anzugreifen. Und das alles konnten sie fast ungestört durchziehen.
Es wird gesagt, die sächsische Polizei sei überfordert gewesen. Der Begriff „Überforderung“ gibt zu verstehen, dass die Polizei nicht über die Mittel verfüge, die Situation unter Kontrolle zu bringen und die von den Nazis angegriffenen Menschen zu schützen. Da aber die sächsische Polizei schon bei kleineren Demonstrationen, sobald diese von antifaschistischen Strukturen organisiert werden, teilweise mit mehreren Wasserwerfern, Hubschraubern und SEK Präsenz aufwarten kann (z.B. wie bei der Demo in Wurzen, die im August unter dem Motto „Keine Stimme den Faschos. Rechten Foren den Raum nehmen!“ lief), ist die Schlussfolgerung unvermeidbar, dass sie nicht unbedingt überfordert sein müsste. Die Kapazitäten sind offenbar vorhanden, sobald linke Gruppen demonstrieren, bei Nazis ist die Polizei plötzlich überfordert.
Als Außenstehende müssen sich Menschen in aller Welt fragen, wie man den Hitlergruß in einem Land zeigen kann, das für den Holocaust verantwortlich ist. Jene, die auf den Straßen Menschen mit dem Tod drohen, sind teilweise die Enkelkinder der Nazis, die während des Nationalsozialismus Millionen von jüdischen Menschen und anderen Opfern systematisch ermordet oder deren Mord ermöglicht haben. Ein anderer Teil von diesen sitzt heute im Bundestag.
Deutschland hat offenbar nichts aus der Geschichte gelernt, würden viele denken. Ich denke aber, dass deutsche Faschist*innen ganz viel aus der Geschichte gelernt haben. Sie wissen, wie es geht. Sie wissen, wie der Nährboden für systematischen Mord bereitet werden kann, und zwar indem eine Gruppe von Menschen entmenschlicht wird. Und sie sind gut darin. Noch am Dienstag schrieb Karolin Schwarz in einem Bericht für „VICE“, wie rasch sich eine Falschmeldung über einen zweiten Mord in Chemnitz verbreitet hat und dass diese Meldung nicht gelöscht wurde, auch nachdem klar war, dass es sich um eine Falschmeldung handelte. Die Falschmeldungen sind eben Falschmeldungen, der Umgang der öffentlich-rechtlichen sagt etwas mehr darüber, wie sich die Mitte der Gesellschaft den Rassismus in Deutschland vorstellt. Beispielsweise wurde die erste Sendung von „Hart aber fair“, die nach den Ausschreitungen in Chemnitz gesendet wurde, mit der Frage „Gibt es wirklich die tägliche Ausgrenzung?“ eröffnet. Zwei der vier Gäste, der SPD-Politiker Karlheinz Endruschart und die Autorin Tuba Sarica, haben während der gesamten Sendung versucht, den strukturellen und institutionellen Rassismus in Deutschland zu legitimieren und zu verharmlosen, indem sie immer wieder die Aufmerksamkeit auf den Rassismus innerhalb von Randgruppen lenkten. Ein klassischer Trick, um Rassismusdiskussionen zu blocken und das Problem unsichtbar zu halten.