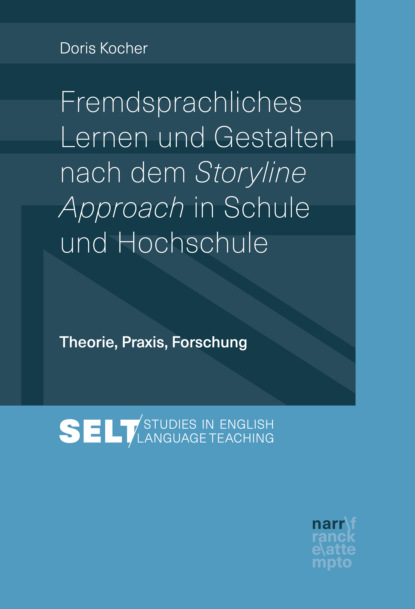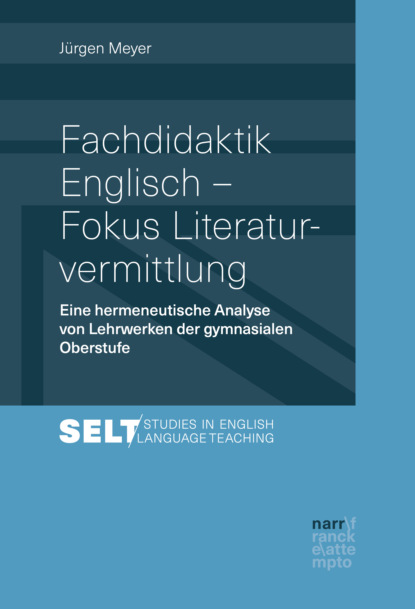Lernen mit Bewegung und Lernen in Entspannung
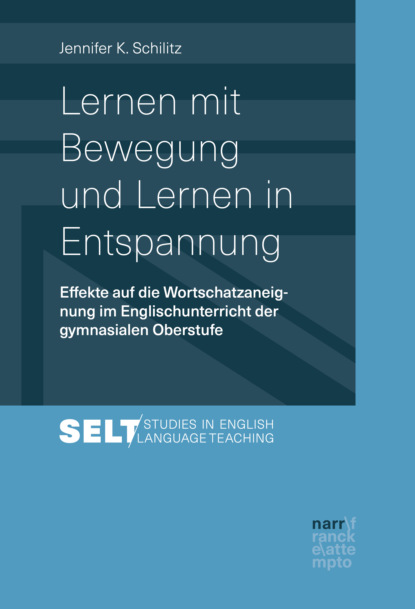
- -
- 100%
- +


Jennifer K. Schilitz
Lernen mit Bewegung und Lernen in Entspannung
Effekte auf die Wortschatzaneignung im Englischunterricht der gymnasialen Oberstufe
[bad img format]
Dissertation an der Freien Universität Berlin, Didaktik des Englischen
Erstbetreuerin: Prof. Dr. Michaela Sambanis
Zweitbetreuer: Prof. Dr. Engelbert Thaler
© 2021 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.narr.de eMail: info@narr.de
ISSN 2367-3826
ISBN 978-3-8233-8508-0 (Print)
ISBN 978-3-8233-0311-4 (ePub)
Mein aufrichtiger Dank gilt als Erstes meiner Doktormutter, Frau Prof. Dr. Michaela Sambanis, deren freundliche, zugewandte und kompetente Begleitung meines Promotionsprojektes von der Konzeption bis zur Fertigstellung mit stets konstruktiven Hinweisen besonders wertvoll für das Verfassen meiner Dissertation und die Erweiterung meines wissenschaftlichen Horizonts waren. Ihre ermutigende und erfrischende Art inspiriert immer wieder aufs Neue und ließ in all den Jahren wiederholt den Wunsch aufkommen, jede Doktorandin und jeder Doktorand möge eine solch hervorragende Erstbetreuung erleben dürfen. Durchdachte und konstruktive Anmerkungen zu Fragen erfolgten zumeist bereits am selben Tag und ihre Freundlichkeit, Klarheit und Genauigkeit machen sie neben ihrer ausgezeichneten fachlichen Kompetenz auch menschlich zu einer ganz besonderen Person, deren Verhalten mir u.a. in meiner Funktion als Gymnasiallehrerin ein Vorbild ist. Ich bin mir der Tatsache bewusst, was für ein großes Glück ich durch ihre Erstbetreuung erfahren durfte und bin von Herzen dankbar dafür.
Weiter bedanke ich mich bei Prof. Dr. Engelbert Thaler für die Zweitbetreuung meines Promotionsprojektes. Seine Werke begleiteten mich bereits durch das Lehramtsstudium und inspirierten und formten in einem nicht zu unterschätzenden Maße meine Sicht auf meine Aufgaben und meinen Fokus als Fremdsprachenlehrerin. Seine Zweitbetreuung meiner Arbeit bedeutet für mich eine große Ehre.
Unermesslich großer Dank gebührt meinem wundervollen Ehemann Christian, der mir über all die Jahre überhaupt erst ermöglicht hat, diese Promotion durchzuführen, mir Zeitfenster gegönnt hat, in denen ich konzentriert schreiben durfte, mir anderweitige Aufgaben abgenommen und gemeinsam Gedankenfäden des Projektes überprüft hat. Außerdem danke ich meinen vier wunderbaren Kindern, Jasmin, Johannes, Christopher und Charlotte, die viel Geduld aufweisen mussten, wenn ich ihnen nicht rund um die Uhr mit meiner Nähe zur Verfügung stehen konnte und die mich das eine oder andere Mal mit vor Begeisterung leuchtenden Augen in die Uni begleitet haben. Zudem danke ich meinen Eltern und meinen Geschwistern für alle Unterstützung.
Weiter bedanke ich mich bei Bernhard Uwe Hermes, Dr. Daniel Köhler und Dr. Christoph Hertzberg für hilfreiche Hinweise und ihren wertvollen Beitrag, sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch durch Ermutigung über all die Jahre. Dies gilt ebenfalls für das Doktorandenkolloquium, hierbei insbesondere Dr. Christiane Klempin und Natasha Janzen Ulbricht. Auch Enno Görlich, Michelle Tursi, Sibel Karamese, Merit Lais und Damaris Hilliger danke ich sehr.
Weiter danke ich den Gymnasien, die sich für die Durchführung meiner Studien zur Verfügung gestellt haben, insbesondere dabei den jeweiligen Lehrkräften und den 128 Versuchsteilnehmenden.
Zuletzt möchte ich augenzwinkernd noch der Serie The Big Bang Theory danken, dass sie mit Humor meine Liebe zur Wissenschaft immer wieder neu entfacht hat.
Michaela Sambanis, Freie Universität Berlin Geleitwort zur Dissertation von Jennifer K. Schilitz
Christian Andrä (2020: 5), Sport- und Erziehungswissenschaftler an der Universität Potsdam, schreibt im aktuellen Handbuch Bewegtes Lernen: „Bewegung hat nicht nur unzählige positive Auswirkungen auf unseren Körper, sondern gleichzeitig einen kaum zu unterschätzenden Effekt auf unser Gehirn. Alle unsere kognitiven Funktionen können grundsätzlich von Bewegung profitieren […].“ Durch zahlreiche Studien sind positive Effekte für die Verbindung von Lernen und Bewegung nachgewiesen, auch für das Lernen von Fremdsprachen, allerdings bislang vor allem für jüngere Kinder oder für Erwachsene. Für die Gruppe der Jugendlichen sowie speziell die der Abiturient*innen zeichnet sich hingegen Forschungsbedarf ab, und in diese Lücke greift die vorliegende Arbeit ein. Sie ist im Feld der Lexikvermittlung und -aneignung verortet und verbindet eine Auseinandersetzung mit themenrelevanten Publikationen mit praxisbezogener Forschung.
Frau Schilitz betrachtet in ihrer Arbeit das Lernen neuer Vokabeln mit Bewegungen nicht isoliert, sondern im Vergleich zu weiteren Vorgehensweisen, u.a. dem Lernen in Entspannung oder dem Vokabellernen mittels Liste und Abdecken einer Spalte. So gelingt es ihr, für die einzelnen Verfahren wichtige Hinweise zu generieren, sie aber auch, insbesondere im Hinblick auf den jeweils erzielten Lernertrag, miteinander zu vergleichen.
Als Lehrkraft an einem Berliner Gymnasium verfolgt Frau Schilitz mit ihrer Doktorarbeit an der Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft vor allem das Ziel der Perspektivierung auf den Unterricht. Die vorliegende Schrift eröffnet interessante Einblicke und gibt wertvolle Anstöße für die Weiterentwicklung der Praxis des Fremdsprachenunterrichts in der Oberstufe. Ferner stößt sie Fragen für weitere Forschung an.
Mit ihrer Dissertation verortet sich Frau Schilitz in einem der Schwerpunkte des Lehrstuhls der Didaktik des Englischen an der FU Berlin. Als empirisch forschende Abteilung verfolgt die Didaktik des Englischen an der FU das Ziel, Fragen zu beleuchten, die für die Praxis des Englischunterrichts von Bedeutung sind. Dabei werden auch Wissensbestände anderer Disziplinen, insbesondere der Neurowissenschaften, in den Blick genommen. Ein wesentliches Ziel ist die sorgsam gestaltete Verbindung von Wissenschaft und Praxis sowie das Schaffen von Anstößen für einen intensiven, wertschätzend geführten Dialog. Die vorliegende Publikation gibt solche Anstöße und zeigt außerdem beispielhaft auf, wie Lehrkräfte zu Forschenden werden können.
Berlin, im Frühsommer 2021 Prof. Dr. M. Sambanis
Tabellen-, Abbildungs- und Abkürzungsverzeichnis
Tabelle 1 Ebbinghaus’sche Behaltensleistung sinnloser Silben nach einmaligem Lernen Tabelle 2 Originalzitat und Formulierungsalternative zur Vermeidung von DSF Tabelle 3 Originalzitate und Formulierungsalternativen zur Vermeidung von DSF Tabelle 4 Kurzfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln durch Lernen in Einzelarbeit im Anschluss an das Lernen nach 20-minütiger Pause Tabelle 5 Mittelfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln durch Lernen in Einzelarbeit nach einer sechswöchigen Interimsphase Tabelle 6 Kurzfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln durch Lernen in Partnerarbeit im Anschluss an das Lernen nach 20-minütiger Pause Tabelle 7 Mittelfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln durch Lernen in Partnerarbeit nach sechswöchiger Interimsphase Tabelle 8 Vergleich der vier Vokabellernvarianten in Bezug auf die kurzfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln im Anschluss an das Lernen nach 20-minütiger Pause Tabelle 9 Vergleich der vier Vokabellernvarianten in Bezug auf die mittelfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln im Anschluss an das Lernen nach 20-minütiger Pause Tabelle 10 Mittelwert, Standardabweichung, Median und Modalwert der Studie 2 hinsichtlich der kurzfristigen Behaltensleistung Tabelle 11 Mittelwerte, Standardabweichung, Median und Modalwert der Studie 2 hinsichtlich der mittelfristigen Behaltensleistung 2018 Tabelle 12 Verwendung von Gesten beim Sprechen Tabelle 13 Sport in der Freizeit Tabelle 14 Persönliches Empfinden bezüglich des Bewegungslernens Tabelle 15 Einschätzung des Nutzens des Bewegungslernens Tabelle 16 Einschätzung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der behaltenen Vokabeln durch das LmB im Vergleich zum AF Tabelle 17 Festlegung der Bewegungen Tabelle 18 Ort des Lernens der Vokabeln mit sinntragenden Bewegungen Tabelle 19 Verwendung eines Videos mit Bewegungen zum eigenständigen Lernen Tabelle 20 Gemittelte Behaltensleistung von Vokabeln anhand beider Vokabellernvarianten (AF, LmB) aufgeteilt nach Integration von Sport in den Alltag der SuS Tabelle 21 Behaltensleistung von Vokabeln anhand des LmB aufgeteilt nach Integration von Sport in die Freizeit der SuS Tabelle 22 Anzahl der SuS, die durch das Bewegungslernen mehr Vokabeln behalten haben als durch das Abfragen, aufgeteilt nach Integration von Sport in den Alltag der SuS Tabelle 23 Sport in der Freizeit und persönliches Empfinden bezüglich des Bewegungslernens Tabelle 24 Kurzfristige Behaltensleistung der SuS, die das LmB als angenehm empfunden haben Tabelle 25 Kurz- und mittelfristige Behaltensleistung in Verbindung mit persönlichem Empfinden in Bezug auf das Bewegungslernen Tabelle 26 Persönliches Empfinden in Bezug auf das Bewegungslernen und Behaltensleistung durch das Bewegungslernen im Vergleich zum gegenseitigen Abfragen Tabelle 27 Selbsteinschätzung (in %) der Probandinnen und Probanden bezüglich der Behaltensleistung nach Vokabellernvariante Tabelle 28 Vergleich der Behaltensleistung der Studien 1 und 2 mit der Behaltensleistung von Ebbinghaus (1885) Abbildung 1 Ebbinghaus’sche Behaltensleistung sinnloser Silben nach einmaligem Lernen Abbildung 2 Sprachlernstrategien Abbildung 3 Graphik nach Vaitls Abbildung der „[s]chematische[n] Darstellung der Entwicklung eines Entspannungszustandes anhand von charakteristischen EEG-Veränderungen“ Abbildung 4 Graphik nach der Abbildung „Theory of change“ Abbildung 5 Ausgewählte Lernvarianten zur Überprüfung der Behaltensleistung Abbildung 6 Forschungsdesign erweitertes lateinisches Quadrat, Studie 1 Abbildung 7 Kurzfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln durch Lernen in Einzelarbeit im Anschluss an das Lernen nach 20-minütiger Pause Abbildung 8 Mittelfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln durch Lernen in Einzelarbeit nach einer sechswöchigen Interimsphase Abbildung 9 Kurzfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln durch Lernen in Partnerarbeit im Anschluss an das Lernen nach 20-minütiger Pause Abbildung 10 Mittelfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln durch Lernen in Partnerarbeit nach sechswöchiger Interimsphase Abbildung 11 Vergleich der vier Vokabellernvarianten in Bezug auf die kurzfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln im Anschluss an das Lernen nach 20-minütiger Pause Abbildung 12 Vergleich der vier Vokabellernvarianten in Bezug auf die mittelfristige Behaltensleistung von jeweils 9 Vokabeln im Anschluss an das Lernen nach 20-minütiger Pause Abbildung 13 Forschungsdesign erweitertes lateinisches Quadrat, Studie 2 Abbildung 14 Kurzzeitbehaltensleistung von jeweils 20 Vokabeln direkt nach dem Lernen nach 20-minütiger Pause Abbildung 15 Mittelfristige Behaltensleistung von jeweils 20 Vokabeln nach sechs-wöchiger Interimsphase Abbildung 16 Sport in der Freizeit Abbildung 17 Persönliches Empfinden bezüglich des Bewegungslernens Abbildung 18 Einschätzung des Nutzens des Bewegungslernens Abbildung 19 Einschätzung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der behaltenen Vokabeln durch das LmB im Vergleich zum AF Abbildung 20 Behaltensleistung von jeweils 20 Vokabeln und Sport im Alltag Abbildung 21 Behaltensleistung von Vokabeln anhand des LmBs aufgeteilt nach Integration von Sport in die Freizeit der SuS Abbildung 22 Behaltensleistung durch Bewegungslernen vs. Abfragen und Sport in der Freizeit Abbildung 23 Sport in der Freizeit und persönliches Empfinden bezüglich des Bewegungslernens Abbildung 24 Persönliches Empfinden in Bezug auf das Bewegungslernen und Behaltensleistung durch das Bewegungslernen im Vergleich zum gegenseitigen Abfragen Abbildung 25 Selbsteinschätzung (in %) der Probandinnen und Probanden bezüglich der Behaltensleistung nach Vokabellernvariante Abbildung 26 Vergleich der Behaltensleistung der Studien 1 und 2 mit der Behaltensleistung von Ebbinghaus (1885) Abbildung 27 Vokabeln geordnet nach Wortart, Set I, Einzelarbeit Abbildung 28 Vokabeln geordnet nach Wortart, Set II, Partnerarbeit Abbildung 29 Durchführung der Studie 2 am Beispiel der Gruppe 3, bekannte Vokabellernvarianten Abbildung 30 Durchführung der Studie 2 am Beispiel der Gruppe 3, unbekannte Vokabellernvarianten Abbildung 31 Schwereübung in Anlehnung an Schiffler Abbildung 32 Merkhilfen science beim LiE Abbildung 33 Merkhilfen media beim LiE Abbildung 34 Bewegungen Studie 1, science Abbildung 35 Test zur Gewöhnung an die Lernvariante, media Abbildung 36 Test zur Überprüfung der kurzfristigen Behaltensleistung Studie 1, Stunde 2, media Abbildung 37 Test zur Gewöhnung an die Lernvariante, science Abbildung 38 Test zur Überprüfung der kurzfristigen Behaltensleistung Studie 1, Stunde 2, science Abbildung 39 Test zur Überprüfung der mittelfristigen Behaltensleistung Studie 1, media Abbildung 40 Test zur Überprüfung der kurzfristigen Behaltensleistung Studie 1, science Abbildung 41 Auswertungsschablone Studie 1, science Abbildung 42 Vokabeln geordnet nach Wortart, Studie 2 Abbildung 43 Durchführung am Beispiel der Gruppe 2, bekannte Vokabellernvariante Abbildung 44 Durchführung am Beispiel der Gruppe 2, unbekannte Vokabellernvarianten Abbildung 45 Bewegungen Studie 2, media Abbildung 46 Bewegungen Studie 2, science AF Abfragen Anh. Anhang innerhalb der vorliegenden Schrift DSF Double-Subject Fallacy DCT Dual Coding Theory EC Embodied Cognition F Forscherin FSU Fremdsprachenunterricht GER Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen IVA Intelligent Virtual Agent Kap. Kapitel innerhalb der vorliegenden Schrift L2 Zweitsprache L2B Learning to BREATHE LiE Lernen in Entspannung LmB Lernen mit Bewegung MZP Messzeitpunkt SuS Schülerinnen und Schüler Studie 1 Studie Schilitz 2013 Studie 2 Studie Schilitz 2017/18 SuS Schülerinnen und Schüler TPR Total Physical Response V Vokabel(n) ZD Zudecken ZNL Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen1 Einleitung
Jugendliche Fremdsprachenlernende müssen für den Englischunterricht in der gymnasialen Oberstufe einen großen und exakten Wortschatz der englischen Sprache zu verschiedenen Themengebieten wie beispielsweise dem Individuum in der Gesellschaft, Utopien und Dystopien, dem Einfluss von Medien auf eine Gesellschaft oder auch zu Bereichen von Wissenschaft und Technik aufbauen. Die hierbei zu erwerbende Kompetenz umfasst, sowohl Gesprochenes und Geschriebenes zu verstehen als auch, sich selbst präzise in der englischen Sprache dazu zu äußern.
Da der Aufbau des Wortschatzes1 für das Fremdsprachenlernen von zentraler Bedeutung ist (vgl. Kap. 2.6; Haudeck 2008: 13) und jugendliche Fremdsprachenlernende eine Vielzahl fremdsprachiger Begriffe in häufig kurzer Zeit verinnerlichen und langfristig abrufbar halten müssen, lohnen sich Überlegungen bezüglich effizienter Vokabellernstrategien. Hierzu gehören empirische Überprüfungen, ob sich unbekanntere, aber aufgrund der Forschungslage vielversprechende Möglichkeiten des Vokabellernens gegenüber solchen von Schülerinnen und Schülern bereits eingesetzten als wirkungsvoller erweisen und daher auch die Überlegung, ob sich die Einführung neuer Vokabellernvarianten auch in der Oberstufe und somit in direkter Nähe zum Abitur noch lohnt, was ein Forschungsdesiderat darstellt.
Zu diesem Zweck wurde die Behaltensleistung englischer Vokabeln in einem Quasi-Experiment anhand von zwei den Lernenden bekannten (1. klassisches Listenlernen mit dem Zudecken einer Seite sowie 2. gegenseitiges Abfragen anhand einer Vokabelliste) mit zwei den Schülerinnen und Schülern unbekannteren Vokabellernvarianten (3. dem Lernen in Entspannung wie auch 4. dem Lernen mit sinntragenden Bewegungen) hinsichtlich des kurzfristigen wie auch mittelfristigen Lernertrags in zwei Studien miteinander verglichen. Zusätzlich werden innerhalb der zweiten Studie mögliche Verbindungen von persönlichen Präferenzen, Selbsteinschätzungen sowie Gewohnheiten der Schülerinnen und Schüler und den Behaltensleistungen in den Vokabeltests aufgezeigt.
Anhand dieses Promotionsprojektes2 werden somit durch Transferforschung als Bindeglied Theorien aus Fremdsprachendidaktik und Neurowissenschaft in die Unterrichtspraxis des Englischunterrichts am Gymnasium übersetzt, ihr Nutzen empirisch überprüft und hieraus resultierende Erkenntnisse an die Forschungsgemeinschaft rückgemeldet. Verortet ist diese Dissertation in der Englischdidaktik, wobei sie in Bezug auf das Vokabellernen im Allgemeinen an Studien von Stork (2003), Neveling (2004) und Haudeck (2008), in Bezug auf das Bewegungslernen an Studien von Hille et al. (2010), Macedonia (2003, 2011) sowie hinsichtlich des Entspannungslernens an Studien von Schiffler (1989), Schonert-Reichl und Hymel (2007) und Broderick und Metz (2009) anschließt. Ein Alleinstellungsmerkmal stellt in diesem Forschungsprojekt die Überprüfung von Effekten verschiedener Vokabellernvarianten bei Schülerinnen und Schülern im elften Jahrgang und damit in zeitlich großer Nähe zum Abitur dar, da sonst häufig Grundschulkinder oder Erwachsene (hier vor allem Studierende) für Studien dieser Art als Probandinnen und Probanden eingesetzt werden (vgl. Kapitel 6.7.2 und 6.8.2).
So soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Erweiterung der Wissensbasis des Fremdsprachenunterrichts (FSU) in der Didaktik des Englischen in Bezug auf das Vokabellernen in der Oberstufe leisten.
Gegliedert ist diese Dissertation in einen theoretischen und einen empirischen Teil, wobei Verknüpfungen von Theorie und Praxis durch Bezüge untereinander hergestellt werden. Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Information darüber, was es leisten soll, d.h. es wird präzisiert, welche für die vorliegende Schrift relevanten Fragen beantwortet werden sollen, um diese anschließend im Hauptteil des Kapitels detailliert zu erörtern. Jedes Kapitel schließt eine kurze Zusammenfassung ab, in der die wesentlichsten Punkte aufgeführt werden, um zuletzt jeweils Implikationen für Wissenschaft, Unterrichtspraxis und außerschulisches Lernen abzuleiten.