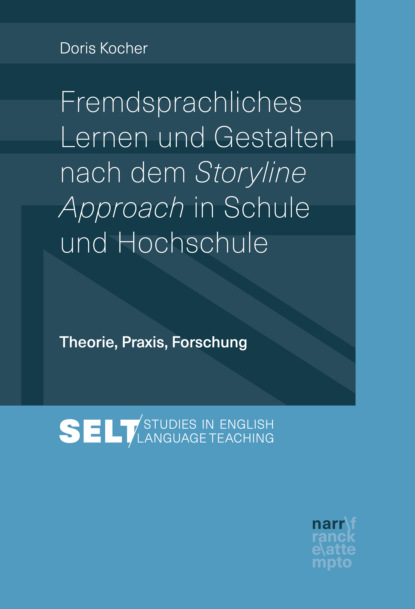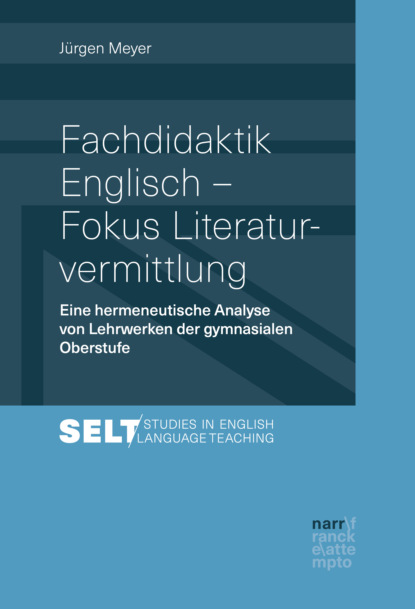Lernen mit Bewegung und Lernen in Entspannung
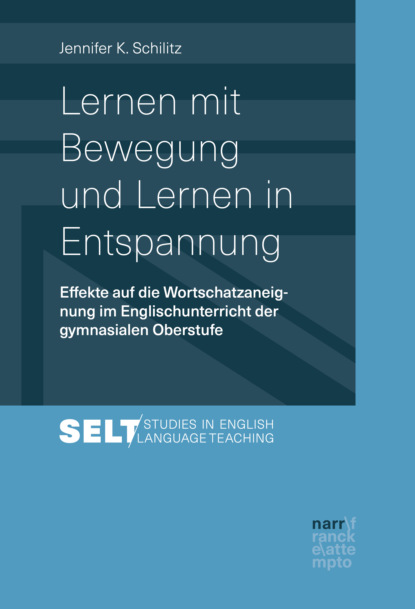
- -
- 100%
- +
Dadurch, dass eine Person einem Wort auf verschiedene Weisen begegnet und es mit anderen Wörtern, Emotionen und dem eigenen Weltwissen verknüpft, werden Assoziationen geschaffen, aus denen vielzählige, untereinander verknüpfte Netzwerke für mitunter Begriffs-, Wortfamilien-, Klang- oder auch affektive Netze entstehen (vgl. ebd.: 57f., Neveling 2004: 41ff.). Dies vereinfacht es, neue Wörter aufzunehmen, zu speichern und letztendlich abzurufen.
Nachdem erörtert wurde, worum es sich bei dem mentalen Lexikon handelt und inwiefern Wörter für die rezeptive sowie produktive Verwendung zur Verfügung gestellt werden, ist von Interesse, auf welche Weise Wörter überhaupt erst zur Speicherung ins mentale Lexikon und damit ins Langzeitgedächtnis gelangen. Dies ist Gegenstand des nun folgenden Teilkapitels über das Gedächtnis.
2.5 Das Gedächtnis
Das Gedächtnis ist „die Fähigkeit eines Organismus, Informationen zu speichern […] und sie auf Abruf hin wieder verfügbar zu haben“ (Michel & Novak 2004: 148). Die Idee, zu erfahren, an welcher Stelle im Gehirn das Gedächtnis verortet ist, klingt interessant. Jedoch lässt sich „eine einzelne Hirnregion, die der ‚Sitz des Gedächtnisses wäre‘“ (Arndt & Sambanis 2017: 147), nicht lokalisieren, da die Speicherung von Informationen die Beteiligung nicht nur einer, sondern mehrerer Hirnregionen, u.a. des Hippocampus, des Frontalhirns oder auch der Basalganglien (vgl. ebd.: 151) umfasst.1
Die Frage, wie das Gedächtnis funktioniert und womit es zu vergleichen ist, beschäftigt Menschen bereits seit der Antike. Zahlreiche Metaphern für das Gedächtnis wurden aufgestellt, und das Harald Weinrich (1964: 26) zufolge aus gutem Grund: „Wir können einen Gegenstand wie die Memoria nicht ohne Metaphern denken.“ Auch Lakoff und Johnson (1999: 235, zitiert nach Goschler 2006: 10) sind sich sicher: „It is virtually impossible to think or talk about the mind in any serious way without conceptualizing it metaphorically.“ Bei Platon war es die Wachstafel, bei Diderot die Bibliothek und Schopenhauer sah das Gedächtnis als Tuch, bei welchem sich die Erinnerungen als Falten darstellen (vgl. Weinrich 1964: 24f.). Dabei sind die Metaphern abhängig vom jeweiligen Forschungsstand (vgl. Goschler 2006: 9). Da er nicht mehr auf Wachstafeln schrieb, sah Racine das Gedächtnis als Buch der Memoria, Bergson verglich es mit einem Fotoapparat (vgl. Weinrich 1964: 25) und mit dem Fortschreiten der Technik war ab den 1950er Jahren die Computermetapher sehr verbreitet (vgl. Goschler 2006: 155; Gibbs Jr. 2005: 5).
Die Faszination für das menschliche Gedächtnis ist verständlich, ist es doch sowohl für grundlegende Alltagshandlungen als auch für höhere kognitive Prozesse unabdingbar:
Ein menschliches Gedächtnis, das imstande ist zu lernen und neue Informationen längerfristig speichern kann, referiert demnach unter anderem auf die persönliche Vergangenheit und Erlebnisse. Ein Organismus muss eine gewisse Art von „Vorprogrammierung“ bereithalten, um ein Gedächtnis und daraus resultierende Lernvorgänge und Operationen überhaupt zu ermöglichen. (Steinhauser 2011: 8)
Somit ist auch für die Vermittlung von Wissen ein möglichst genaues Verständnis des menschlichen Gedächtnisses von hoher Relevanz, wofür Forschung in kognitiven Bereichen notwendig ist:
The primary purpose of education is to transmit knowledge; consequently, much educational and cognitive research has attempted to identify the basic psychological mechanisms by which information in texts and other educational sources is represented. (Clark & Paivio 1991: 158)
In Bezug auf den Aufbau und die Funktionsweise des Gedächtnisses sind für die vorliegende Schrift folgende Bereiche von besonderem Interesse:
1 die Differenzierung verschiedener Gedächtnismodelle,
2 die Gedächtnisprozesse, die eine Information von der ersten Begegnung bis zur endgültigen Speicherung durchlaufen kann,
3 verschiedene Gedächtnismodelle,
4 neurobiologische Grundlagen des Gedächtnisses,
5 Ursachen des Vergessens und Möglichkeiten der Verbesserung des Gedächtnisses und
6 die Anfänge der experimentellen Gedächtnisforschung, die bis zur Gegenwart noch Relevanz haben.
2.5.1 Gedächtnisarten
Stork (2003: 65) weist darauf hin, dass „nicht nur verschiedene Gedächtnisspeicher, sondern auch sog. Gedächtnissysteme“ voneinander unterschieden werden können und spricht in diesem Kontext von „Gedächtnisarten“ (ebd.). Diese werden häufig paarweise beschrieben und gegeneinander kontrastiert: So unterscheidet man das deklarative von dem prozeduralen Gedächtnis, das episodische von dem semantischen und das implizite von dem expliziten Gedächtnis (vgl. ebd.).
Das deklarative Wissen entspricht dem Faktenwissen, wie z. B. Jahreszahlen, das eine Person entweder hat oder nicht (Alles-oder-nichts-Prinzip) und das häufig verbal vermittelt werden kann, während prozedurales Wissen, wie z. B. Fahrradfahren, eher Fertigkeiten entspricht, in Teilen vorhanden sein kann, durch Übung erworben wird und oft besser gezeigt als erklärt werden kann (vgl. ebd., Michel & Novak 2004: 149). „Deklaratives Wissen wird häufig beschrieben als ‚Wissen, dass‘ (knowing that) und prozedurales Wissen als ‚Wissen, wie‘ (knowing how).“ (Stork 2003: 65)
Tulving (1972) gliedert das deklarative Gedächtnis in zwei Unterformen: das episodische und das semantische Gedächtnis, wobei ersteres auf Erfahrungen aus persönlichen Erlebnissen basiert, während sich das zweite auf Kenntnisse über Sachverhalte, Weltwissen, aber auch auf die Bedeutung von Begriffen und Wörtern bezieht (vgl. Stork 2003: 66).
Die Fähigkeiten im impliziten Gedächtnis werden gekonnt oder verbessert, ohne dass sich die betreffende Person bewusst an die Erfahrung erinnern kann, die dazu geführt hat. Im Gegensatz dazu erfordert das explizite Gedächtnis das bewusste Erinnern. (vgl. ebd.)
2.5.2 Gedächtnisprozesse und die Relevanz der Aufmerksamkeit
Die Phasen der Informationsverarbeitung im Gedächtnis gliedern sich in Aufnahme (encoding), Speicherung (storage) und Abruf (retrieval) einer Information. Da die Aufmerksamkeit zum Zeitpunkt der Enkodierung eine zentrale Rolle spielt, wird sie an dieser Stelle ebenfalls beleuchtet.
2.5.2.1 Aufmerksamkeit
Es gilt „Aufmerksamkeit sowohl als Eigenschaft des lernenden Individuums als auch im pädagogisch-didaktischen Sinne als Bestandteil und Voraussetzung des Lehr-und Lernprozesses zu betrachten“ (Arndt & Sambanis 2017: 59). Spitzer (2009: 155) merkt an, dass „[j]e aufmerksamer ein Mensch ist, desto besser wird er bestimmte Inhalte behalten“, und unterscheidet die grundsätzliche Aufmerksamkeit (Vigilanz) von der selektiven Aufmerksamkeit, bei der sich eine Person auf einen bestimmten Bereich, z. B. einen Aspekt, einen Ort oder einen anderen Wahrnehmungsgegenstand, fokussiert (vgl. Spitzer 2009: 155).
Während die Vigilanz die Aktivierung des Gehirns überhaupt betrifft, bewirkt die selektive Aufmerksamkeit eine Zunahme der Aktivierung genau derjenigen Gehirnareale, welche die jeweils aufmerksam und damit bevorzugt behandelte Information verarbeiten. (ebd.)
Sollen Gedächtnisinhalte gespeichert werden, ist somit die selektive Aufmerksamkeit von hoher Relevanz, woraus sich schlussfolgern lässt: „Wie intensiv wir die prinzipiell vorhandenen Verarbeitungskapazitäten nutzen können, ist also abhängig von unserer Wachheit“ (Arndt & Sambanis 2017: 59). Aufmerksamkeit stellt allerdings eine nicht unerschöpfliche Ressource dar, weswegen gut abgewogen werden muss, worauf sie gelenkt werden soll, was impliziert, dass „die Hinwendung zu etwas Bestimmten“ (ebd.) mit der „Nichtbeachtung von etwas anderem“ (ebd.) einhergeht. Dabei hat die Begrenzung unserer Aufmerksamkeit „sowohl strukturelle wie auch energetische Ursachen, die im Aufbau und der Funktionsweise unseres Gehirns als Organ begründet liegen“ (ebd.). Ist die nötige Aufmerksamkeit gegeben, sind an der Verankerung neuen Wissens im Gehirn zwei Vorgehen maßgeblich beteiligt, nämlich die Enkodierung sowie die Konsolidierung.
2.5.2.2 Enkodierung und Konsolidierung
Über die Sinnesorgane gelangen Reizinformationen aus der Umwelt ins Gehirn, wo sie zunächst durch sensorische Prozesse in einen neuronalen Code umgewandelt werden, um somit in für Neuronen lesbare Informationen übersetzt bzw. verschlüsselt zu werden. Dies geschieht durch das Enkodieren (vgl. Sambanis & Walter 2019: 33). Jedoch sind einmal encodierte Reize nicht dauerhaft verfügbar, sondern zerfallen, um den hierfür zur Verfügung stehenden wertvollen und begrenzten Speicherplatz im Arbeitsgedächtnis wieder für neue Informationen freizugeben. Sollen Inhalte dauerhaft gespeichert werden, erfolgt ihre Sicherung durch einen zweiten Prozess: die Konsolidierung.
Konsolidierung bedeutet Verfestigen, in Zusammenhang mit Lernprozessen auch längerfristige Speicherung, Erreichen von Abrufbarkeit und Anwendbarkeit. (Sambanis 2013: 83)
Eben da liegt eine ernstzunehmende Herausforderung beim Lernen von Wörtern:
Die Erfahrungen mit Lehr- und Lernprozessen zeigen, dass die größten Schwierigkeiten des Wörterlernens in der Phase des Behaltens, d.h. dem langfristigen Speichern im mentalen Lexikon auftreten. (Neveling 2004: 12)
Sambanis und Walter (2019: 34) definieren Konsolidierung als „das Zeitfenster, in dem Prozesse der Festigung von Gedächtnisinhalten (vielfach einhergehend mit Löschprozessen) ablaufen“. Während der Konsolidierung finden „aus neurowissenschaftlicher Sicht Umbauprozesse auf der Ebene der synaptischen Verbindungen zwischen Nervenzellen“ (Arndt & Sambanis 2017: 170) statt. Über die Dauer der Konsolidierungsphase herrscht bei verschiedenen Autoren Uneinigkeit, wobei von einigen Stunden oder wenigen Tagen bis hin zu Monaten oder Jahren ausgegangen wird (vgl. Brand & Markowitsch 2009: 73). Die encodierte Information wird im Gedächtnis gespeichert und für einen späteren Abruf, das Erinnern, bereitgehalten (vgl. Becker-Carus & Wendt 2017: 355). Für die Konsolidierung spielt auch Schlaf eine Rolle. Im Schlaf werden Informationen an den Hippocampus weitergegeben (vgl. Sambanis 2013: 85). Der Mythos des aktiven Lernens unbekannter Inhalte im Schlaf kann allerdings nicht bestätigt werden.
Während sich die Annahme, im Schlaf könnten aktive Aufbauprozesse stattfinden, also beispielsweise über Kopfhörer Wörter gelernt werden, als irrig, wenn auch marktstrategisch reizvoll erwiesen hat, wird im Schlaf intensiv nachbereitet, letztlich also doch gelernt, allerdings eben konsolidierend. (ebd.)
2.5.2.3 Lexikalischer Abruf
Es lohnt, Vorgänge lexikalischer Speicherung zu kennen und Lerngelegenheiten darauf basierend auszurichten, da dies den Abruf erleichtert (vgl. Neveling 2004: 49f.). Als förderlich für einen gezielten Abruf und die hierfür notwendige Grundlage einer möglichst langfristigen Speicherung erweisen sich verschiedene Faktoren, die Neveling (ebd.: 57) folgendermaßen listet: So sollten Begriffe „mehrkanalig“ zur Verfügung gestellt und in „sinnhaltige Verbindungen mit den bestehenden Wortknoten“ (ebd.) gebracht werden. Zudem intensivieren „[m]ultiple und multimodale Einordnungen durch den Lerner selbst […] die Verarbeitungstiefe“ und verstärken „die Möglichkeit, über mehrere Verbindungsspuren zu dem gesuchten Wort zu gelangen.“ (ebd.) Einander ähnliche Wörter können zu Interferenzen führen und sollten deshalb mit etwas Abstand zueinander gelernt werden. „Wörter mit niedriger Semantizität hingegen sollen mit hochsemantischen relationiert werden“ (ebd.), ergo mit „konkreten Wörtern, Bildern und affektiv belegten Erlebnissen.“ (ebd.) Um dem Zerfall von Gedächtnisspuren entgegenzuwirken und zugleich „partiell benachbarte Wortknoten“ (ebd.) zu aktivieren, zeigen sich Wiederholungen als dienlich.
Für den lexikalischen Zugriff, womit der Abruf auf gespeicherte Wörter für den rezeptiven oder produktiven Gebrauch gemeint ist, gibt es verschiedene Modelle wie die Kaskaden-Aktivierungsmodelle und die discrete-serial-Modelle, die immer auf den Vorstellungen des mentalen Lexikons beruhen (vgl. Kehrein 2013: 16).
Discrete-serial-Modellen zufolge werden nur ausgewählte Lemmata phonologisch aktiviert, während bei Kaskaden-Aktivierungsmodellen angenommen wird, dass alle durch das Gedächtnis aktivierten lexikalischen Knoten eine entsprechende – schwächere oder stärkere – phonologische Aktivierung verursachen. (Teymoortash 2010: 96)
Jedoch ist bei einem erfolgreichen Abruf der gesuchten lexikalischen Einheit nicht nur der Zugriff auf die Information maßgeblich, denn „[j]eder Abruf führt grundsätzlich auch zu einer Neueinspeicherung (Re-Enkodierung) des Inhalts“ (Brand & Markowitsch 2009: 75), was den Vorteil hat, dass aufgrund des Abrufs der Inhalt erneut gefestigt und somit stabiler wird. Dies birgt allerdings auch eine Gefahr, da es „nicht selten zu Verfälschungen bei der Re-Enkodierung [kommt], d.h. dass sich die Inhalte sukzessive und unmerklich verändern können“ (Brand & Markowitsch 2009: 75).
2.5.3 Speichertheorien
In der Forschung wurden für ein grundlegendes Verständnis des Gedächtnisses zahlreiche Modelle entwickelt. Von Interesse sind hier strukturalistische Modelle wie das Modell der Mehrspeichertheorie (multi-component-model) von Atkinson und Shiffrin (1969), das Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley und Hitch (1974) und das Langzeitgedächtnismodell von Squire (1987, 1992), funktionalistische Modelle wie das Modell der Verarbeitungstiefe von Craig und Lockhart (1972) sowie das strukturell-funktionale Modell nach Paivio (1971). Zudem wird die Theorie der Embodied Cognition in diesem Zusammenhang betrachtet.
2.5.3.1 Die Mehrspeichertheorie
Gemäß der Mehrspeichertheorie (multi-component-model) von Atkinson und Shiffrin (1969) werden Informationen in verschiedene, aufeinanderfolgend relevante Speicher geleitet. Im sensorischen Gedächtnis (sensory buffer), auch Ul-trakurzzeitgedächtnis genannt, werden Reize (z. B. Töne oder Bilder) aus der Umwelt aufgenommen und für einige Sekundenbruchteile bereitgehalten. Bei ausreichender Aufmerksamkeit werden sie an das Kurzzeitgedächtnis (short term memory) weitergeleitet und bearbeitet, weswegen es aufgrund der Informationsverarbeitungen, die hier geschehen, nach Baddeley (1986) auch Arbeitsgedächtnis genannt (working memory) wird. Zwei Hilfssysteme, die phonoligische Schleife (phonological loop) und der visuell-räumliche Skizzenblock (sketchpad) unterstehen dem Arbeitsgedächtnis und machen seine hauptsächlichen Aufgaben, „die Lenkung von Aufmerksamkeit und die Kontrolle, Koordination und Integration von Informationen“ (Stork 2003: 58), möglich.
Im Langzeitgedächtnis können Informationen und Erinnerungen dauerhaft gespeichert und abrufbereit gehalten werden (vgl. Becker-Carus & Wendt 2017: 356), wobei die Kapazität unbegrenzt ist. In Bezug auf das Fremdsprachenlernen ist zudem von Interesse, dass „[d]as bevorzugte Repräsentationsformat im Langzeitgedächtnis […] im Falle von verbalem Material die Bedeutungsrepräsentation (semantische Kodierung) [ist]“ (Stork 2003: 59). Beim Erinnern werden Informationen aus dem Langzeitgedächtnis dem Arbeitsgedächtnis wieder zur Verfügung gestellt.
2.5.3.2 Die Theorie der Verarbeitungstiefe
Während in der Mehrspeichertheorie von unterschiedlichen Speichersystemen ausgegangen wird, steht dem Gedächtnis in der von Craig und Lockhart (1972) entwickelten Theorie der Verarbeitungstiefe1 (depth of processing) nur ein einziger Gedächtnisspeicher zur Verfügung und die Behaltensleistung einer Information weist eine Abhängigkeit zur Tiefe ihrer Verarbeitung auf (vgl. Stork 2003: 61), obwohl sie, ähnlich den Grundgedanken der Mehrspeichertheorie, bestätigen: „certain analytic operations must preceed others“ (Craig & Lockhart 1972: 675). Unterteilt wird in flachere und tiefere Verarbeitungsebenen:
Preliminary stages are concerned with the analysis of such physical or sensory features as lines, angles, brightness, pitch, and loudness, while later stages are more concerned with matching the input against stored abstractions from past learning; that is, later stages are concerned with pattern recognition and the extraction of meaning. This conception of a series or hierarchy of processing stages is often referred to as "depth of processing" where greater "depth" implies a greater degree of semantic or cognitive analysis. After the stimulus has been recognized, it may undergo further processing by enrichment or elaboration. For example, after a word is recognized, it may trigger associations, images or stories on the basis of the subject's past experience with the word. (ebd.)
Dabei unterscheiden sie oberflächlicheres (Typ 1) Üben, bei welchem lediglich bereits Gelerntes wiederholt wird von einem Wiederholen, das eine tiefere Verarbeitung (Typ 2) beinhaltet, wobei sich zweitere für den Abruf von Informationen als vorteilhafter erweist:
This Type I processing, that is, repetition of analyses which have already been carried out, may be contrasted with Type II processing which involves deeper analysis of the stimulus. Only this second type of rehearsal should lead to improved memory performance. (ebd: 676)
Neveling (2017: 378) weist darauf hin, dass nach dieser Theorie für die produktive Wortbeherrschung eine tiefere Verarbeitung vonnöten ist.
2.5.3.3 Die Theorie der dualen Kodierung
In seiner strukturell-funktionalen Theorie der dualen Kodierung (dual coding theory = DCT) geht Paivio (1971) davon aus, dass Informationen in zwei verschiedenen Systemen, einem verbalen und einem imaginalen, gespeichert werden (vgl. Clark & Paivio 1991: 151f.).
According to DCT, mental representations are associated with theoretically distinct verbal and nonverbal symbolic modes and retain properties of the concrete sensorimotor events on which they are based. (ebd)
Wenngleich beide Kodierungssysteme unabhängig voneinander arbeiten, sind sie doch im Austausch ihrer Informationen miteinander verbunden. Das verbale System verarbeitet sprachliche Informationen als „visual, auditory, articulatory, and other modality-specific verbal codes“ (ebd.), während das imaginale System, schneller als das verbale, sämtliche nichtsprachlichen Informationen als Vorstellungsbilder verarbeitet (vgl. Stork 2003: 62). Nonverbale Vorstellungsbilder können nicht nur visueller, sondern ebenfalls entsprechend anderen sensorischen Eigenschaften z. B. haptischer oder auditiver Natur sein und somit Bilder, Töne, Emotionen etc. umfassen (vgl. Clark & Paivio 1991: 151). Die Verarbeitung ist in drei Ebenen möglich. Auf der untersten, der repräsentationalen Ebene, arbeitet jedes der Systeme einzeln, auf der zweiten, der referentiellen Ebene, verbinden beide Systeme verbale und nonverbale Repräsentationen in einem komplexen assoziativen Netzwerk zu referential connections.1 Durch solch miteinander verbundene verbale und imaginale Codes werden Ausführungen wie das Zuordnen von Bildern zu Wörtern oder das Benennen von Vorstellungsbildern ermöglicht. (vgl. ebd.: 153).
Bei abstrakten Begriffen wird nur die repräsentationale Ebene des verbalen Systems angesprochen, während bei der Verarbeitung von Bildern sowohl das imaginale als auch das verbale System in die Verarbeitung einbezogen ist. Anschauliche Begriffe werden besser verarbeitet als abstrakte Begriffe, weil sie zwar verbal verarbeitet werden, aber eine imaginale Kodierung nahe liegt […]. (Stork 2003: 63)
Als für die Behaltensleistung förderlich erweist sich somit vor allem, wenn Lerninhalte „in beiden Systemen verarbeitet und somit doppelt kodiert werden“ (Haudeck 2008: 25).
2.5.3.4 Die Theorie der Embodied Cognition
Entgegen etablierten Ansichten der Kognitionswissenschaft (Kognitivismus, Computertionalismus1, in Teilen auch noch Dualismus, zu Letzterem vgl. Kap. 3.1), bei denen eine „zentrale Informationsverarbeitungseinheit, die als Verteilungsstation Daten verschiedener Sinnesmodalitäten“ (Hoffmann 2016: 161) empfängt, verarbeitet und abspeichert, wird von Vertretern verkörperter Kognition
ein modularisiertes Bild des bewusstseinsfähigen Organismus gezeichnet, in dem es keine zentrale Verarbeitungseinheit gibt, sondern eine Vielzahl sowohl mentaler als auch physischer Teilsysteme (Module), die in einem dynamischen Prozess einander wechselseitig beeinflussen und weiterentwickeln. (ebd.)
Somit sind Begriffe nicht abstrakt und unabhängig, sondern in den Sinnes- und motorischen Systemen des Gehirns abgespeichert und daher verkörpert. Auf die Theorie der Embodied Cognition wird in Kapitel 3.2 in Bezug auf das Lernen mit Bewegungen (Embodied Learning) u.a. in Verbindung zu Sprache vertieft eingegangen.
2.5.4 Neurobiologische Grundlagen des Gedächtnisses
Neuronen bilden die Grundlage von Nervensystemen. Sie bestehen aus drei Teilen, einem Zellkörper, den Dendriten und einem Axon und ermöglichen es, über große Entfernungen anhand elektrischer und chemischer Signale Informationen weiterzuleiten. Die Dendriten nehmen das Signal auf, der Zellkörper verrechnet es, es wird vom Axon weitergeleitet und von der Synapse an weitere Neuronen übermittelt. Da sich die Dendriten der Neuronen nicht berühren, werden die Signale an den Synapsen über den synaptischen Spalt weitergegeben. Durch starke elektrische Signale, die sogenannten Aktionspotentiale1, wird die Spannung in den Neuronen kurzfristig geändert, was die Ausschüttung von erregenden oder hemmenden Neurotransmittern zur Folge hat (vgl. Sambanis 2013: 11). Für das Lernen müssen nun Spuren im Gedächtnis ausgebildet werden. Eine Gedächtnisspur, auch Engramm genannt, wird als eine „von einem spezifischen Gedächtnisinhalt (Information) hervorgerufene, dauernde, strukturelle beziehungsweise elektrochemisch-physiologische Veränderung im Gehirn verstanden“ (Becker-Carus & Wendt 2017: 405) Dies geschieht nach der sogenannten Hebb’schen Regel2:
Die simultane oder leicht zeitverschobene Erregung von präsynaptischer und postsynaptischer Zelle führt nach mehrfacher und dauerhafter Paarung zu einer Stärkung der Verbindung zwischen ihnen. (ebd.: 406)
Shatz (1992: 64), Professorin für Neurobiologie in Kalifornien, formte aus dieser Erkenntnis den berühmten Satz „cells that fire together wire together“. Der Neurowissenschaftler und Psychiater Spitzer verwendet für solche Gedächtnisspuren häufig die Metapher einer Spur im Schnee, die durch wiederholten Gebrauch desselben Weges entsteht (vgl. Sambanis 2013: 14). Zunächst ist eine Gedächtnisspur jedoch noch fragil und wird erst durch eine Phase der Konsolidierung stabiler:
Experimentell ließ sich inzwischen nachweisen, dass jeweils zunächst eine auf bioelektrischen Grundlagen beruhende Erinnerungsspur angelegt wird, die dann durch Konsolidierung in stabile und erstaunlich widerstandsfähige Engramme umgewandelt wird. Grundlage der bioelektrischen Speicherung sind reverberatorische Erregungskreise3. (Becker-Carus & Wendt 2017: 405)
Gedächtnisspuren als „Repräsentationen der Außenwelt“4 (Spitzer 2009: 12) können Handlungen und Ziele, aber auch Zusammenhänge und Werte beinhalten (vgl. ebd.: 13). „Die Gesamtheit aller Engramme – und es sind wahrscheinlich Milliarden – ergibt das Gedächtnis.“ (Gruber 2018: 95)5
2.5.5 Ursachen des Vergessens
Dem Behalten von Informationen steht das Vergessen gegenüber:
Behalten und Vergessen sind komplementäre Prozesse. Was nicht behalten wird, wird vergessen. Die Faktoren, die das Behalten positiv beeinflussen, beeinflussen das Vergessen negativ. (Dörner 1996: 174)
Als „Gegenpol zur Gedächtnisleistung“ (Kehrein 2013: 11) kann das Vergessen diverse Ursachen haben. Anhand der verschiedenen Gedächtnistheorien, aber auch neurowissenschaftlicher Vorgänge gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, warum eine Information vergessen wird und somit auf diese kein Zugriff besteht. Platons Metapher der wächsernen Tafel entsprechend funktioniert das Erinnern nicht, wenn das Abbild auf der Tafel verwischt oder zu Beginn schon nicht genug Kraft hatte, sich einzuprägen, wobei beide von Platon gegebenen Erklärungen auch heute noch neben anderen Begründungen als Ursachen des Vergessens für möglich gehalten werden (vgl. Becker-Carus & Wendt 2017: 382).