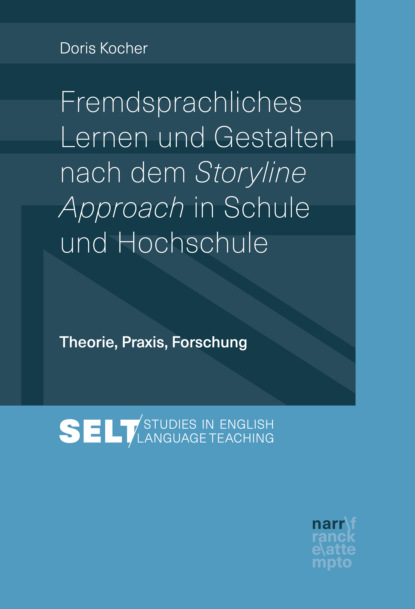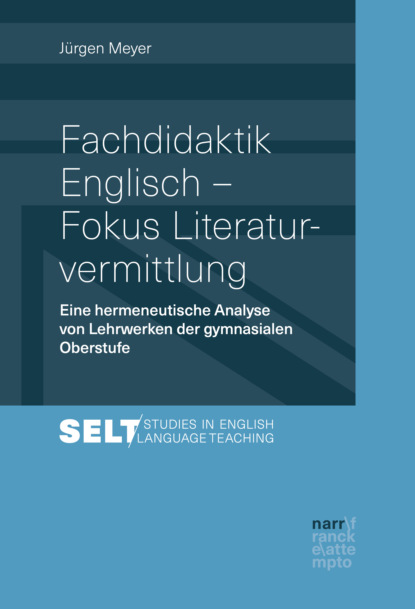Lernen mit Bewegung und Lernen in Entspannung
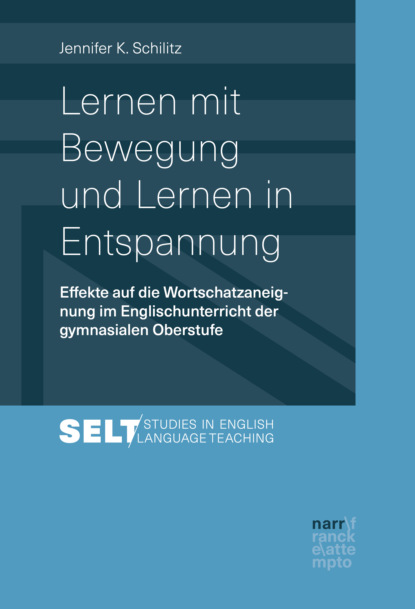
- -
- 100%
- +
Reinfried (2006: 182) sieht für das Vergessen aus neurowissenschaftlicher Sicht die neuronale Inaktivität als ausschlaggebend. Werden die entsprechenden Neuronen nicht häufig genug aktiviert, ist es möglich, dass gelernte Inhalte nicht mehr abrufbar sind:
Eine Information ist so lange nicht mehr aktiviert worden, dass die sie speichernden Neuronen an synaptischer ‚Regsamkeit‘ verloren haben. Zuerst sinkt der Zugriff auf diese Information unter einen kritischen Schwellenwert, der je nach aktueller körperlicher Verfassung schwankend ist, schließlich kann sich die ‚Gedächtnisspur‘ völlig auflösen. (ebd.)
Hierbei spielt der Faktor Zeit eine Rolle, da ohne Wiederholung des Lerninhalts „die Stärke einer Gedächtnisspur […] kontinuierlich mit der Zeit zerfällt, bis sich die Spur schließlich vollständig aufgelöst hat.“ (Stork 2003: 60) Jedoch geben Becker-Carus und Wendt (2017: 386) zu bedenken:
Experimentelle Belege gibt es für das Nichteinprägen und die Nichtzugänglichkeit von Informationen. Ein Zerfall von Informationen im Langzeitgedächtnis kann dagegen nicht experimentell belegt werden.
Eine weitere Erklärung für das Vergessen besagt, dass diejenigen „stützenden Assoziationen, die zu einer Information hinführen, verblassen. Der Zugang zur Information ist dadurch erschwert.“ (Reinfried 2006: 182). Dies geschieht, wenn nicht ausreichend geeignete Hinweisreize (retrieval cues) zur Verfügung stehen (vgl. Stork 2003: 60).
Zudem können Interferenzen (Überlagerungen) den Abruf von Gelerntem behindern, was „durch Ähnlichkeit zweier zu unterschiedlichen Zeitpunkten erlernten Informationen stark begünstigt“ wird (Reinfried 2006: 182). Auch emotionale Faktoren können von Bedeutung sein, dass etwas behalten oder vielleicht sogar absichtlich verdrängt wird (vgl. Becker-Carus & Wendt 2017: 382).
Denkbar ist gleichfalls, dass sich die gesuchte Information gar nicht erst oder nicht ausreichend eingeprägt hat und daher nicht abrufbar ist, was bedeutet, dass sie nach dem Mehrspeichermodell nicht vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher überführt wurde. In Bezug auf den Kurzzeitspeicher wäre ebenso möglich, dass ältere Informationen ersetzt werden oder entfallen, um den begrenzten Platz des Arbeitsgedächtnisses wieder freizugeben. Bei der Theorie der Verarbeitungstiefe wäre ein Vergessen aufgrund einer mangelnden Tiefe der Verarbeitung denkbar, was bedeutet, dass der Inhalt eher auf flachen Ebenen verarbeitet wurde. Bekannt ist auch das Phänomen, dass eine Information nicht komplett verloren gegangen ist, sondern einem quasi „auf der Zunge liegt“, was der Theorie der Nichtabrufbarkeit zugehörig ist (vgl. Stork 2003: 60).
Nach Glanzer und Cunitz (1966) macht in einer Wortliste die Positionierung des zu lernenden Wortes übrigens einen Unterschied in der Behaltensleistung. Versuchspersonen wurden Wortlisten mit 20 bis 40 Items gegeben, welche auswendiggelernt und anschließend reproduziert werden sollten, wobei die Reihenfolge irrelevant war. Aus diesen Ergebnissen ergibt sich die sogenannte serielle Positionskurve, die aufzeigt, dass die ersten, vor allem aber die letzten Wörter der Liste am besten behalten werden, während die Begriffe in der Mitte der Liste nur wenig abrufbar waren. Die zuletzt gelernten Wörter sind deshalb so gut reproduzierbar, da sie zum Zeitpunkt des Abrufs noch im Kurzzeitgedächtnis gespeichert waren (Rezenzeffekt), während für die ersten Wörter verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit aufgebracht wurde (Primäreffekt) (vgl. Glowalla: 238f.). Informationen solcher Art können helfen, Vorgänge des Lernens und Vergessens zu verstehen und auf sie zu reagieren.
Durch Kenntnis darüber, warum Lerninhalte vergessen werden, kann durch gezielte Techniken und Strategien gegengesteuert werden, um das Behalten zu fördern (vgl. Kapitel 2.7). Für das Lernen fremdsprachiger Wörter ist jedoch nicht nur relevant, warum, sondern auch wann vergessen wird und daraus resultierend, zu welchen Zeitpunkten das Gedächtnis Wiederholungen benötigt. Hierzu sind Erkenntnisse aus der Wissenschaft von Interesse. Der wohl berühmteste Vertreter experimenteller Gedächtnisforschung findet sich in Ebbinghaus.
2.5.6 Experimentelle Gedächtnisforschung – die Ebbinghaus’sche Vergessenskurve
Ebbinghaus war einer der Ersten, der sich, in Studien im Selbstversuch, mit Behaltensleistungen des Gedächtnisses befasste und damit in der experimentellen Psychologie einen wertvollen Grundstein legte, auf den sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen bis heute beziehen. Murre und Dros (2015: 24) konstatieren: „It is hard to overestimate the importance of Hermann Ebbinghaus’ contribution to experimental psychology.“ Nachdem er erste Versuche der Behaltensleistung mit dem Erlernen lateinischer und griechischer Verse durchführte, bemerkte er, dass die Reproduktion durch Assoziationen und Sinnzusammenhänge maßgeblich erleichtert wurde, woraus er schloss, für die Überprüfung von Behaltensleistungen verbal „reines“ Material zu benötigen. Hierfür setzte er Trigramme, zufällige Buchstabenkombinationen aus Konsonant, Vokal und wieder einem Konsonanten ein (vgl. Becker-Carus & Wendt 2017: 357). Dieses Material hatte für Ebbinghaus (1885: 31f.) den Vorteil, „verhältnismäſsig einfach und verhältnismäſsig gleichartig“ zu sein1. So lernte er Reihen dieser sinnlosen Silben auswendig und überprüfte, wie viel er zu welchem Zeitpunkt noch abrufen konnte2. Seine Forschungsfrage hierzu lautete:
[W]enn Silbenreihen einer bestimmten Art auswendig gelernt und dann sich selbst überlassen werden, in welcher Weise werden sie, lediglich unter dem Einfluſs der Zeit, respektive des diese erfüllenden alltäglichen Lebens, allmählich vergessen? (ebd.: 90)
Die Ergebnisse publizierte er 1885 in seinem Buch Über das Gedächtnis. Hieraus entstand die Ebbinghaus’sche Vergessenskurve, die bis heute als Referenz für das Vergessen gilt, wenngleich die mangelde Vergleichbarkeit sinnloser Silben mit anderen Lerninhalten kritisiert wird (vgl. Reinfried 2006: 182). Er maß, wie viel er noch abrufen konnte und zwar nach knapp 20 Minuten, nach einer guten Stunde, nach acht Stunden, 24 Stunden, sechs Tagen sowie nach einem Monat. Die Prozentzahl des noch Gewussten, resultierte in den Ebbinghaus’schen Versuchen in folgenden Ergebnissen: Knapp 20 Minuten nach dem Lernen sind noch 58 % abrufbar. Nach einer Stunde sind es nur noch 44 %, nach knapp neun Stunden 36 %, nach einem Tag 34 %, nach zwei Tagen 28 %, nach sechs Tagen 25 % und schließlich nach 31 Tagen 21 % (vgl. Ebbinghaus 1885: 94 – 102). Will man dies graphisch darstellen, ergibt sich folgende Kurve, die auch die Ebbinghaus’sche Vergessenskurve genannt wird:

Abb. 1 (selbst erstellt): Ebbinghaus’sche Behaltensleistung sinnloser Silben nach einmaligem Lernen (vgl. Ebbinghaus 1885: 94–103)
Zeit nach erstem Lernen Behaltensleistung 20 min 58,2 % 1 Stunde 44,2 % 9 Stunden 35,8 % 1 Tag 33,7 % 2 Tage 27,8 % 6 Tage 25,4 % 31 Tage 21,1 %Tab. 1 (selbst erstellt): Ebbinghaus’sche Behaltensleistung sinnloser Silben nach einmaligem Lernen (vgl. ebd.):
Der größte Verfall erfolgt innerhalb der ersten 20 Minuten, anschließend findet das Vergessen langsamer statt. In Replikationen der Studie (u.a. Heller, Mack & Seitz 1991; Murre & Dros 2015) kamen ähnliche Resultate zustande. Das Wissen darum, wie schnell ein Lerninhalt vergessen wird oder umgekehrt, mit welcher Behaltensleistung zu rechnen ist, kann für Entscheidungen in der fremdsprachlichen Wortschatzvermittlung, aber auch für Lernende selbst von Nutzen sein, da erstens eine klare Vorstellung davon besteht, wie viel vermutlich behalten wird und zweitens, zu welchen Zeitpunkten Wiederholungen sinnvoller sind als zu anderen.3 Jedoch gibt Reinfried (2006: 182) zu bedenken:
Die Behaltenskurven, die von pädagogischen Psychologen bereit gestellt werden, sind für die Fremdsprachendidaktik nur von geringem Nutzen – allzu sehr hängen Behaltensresultate nämlich von der Eigenart des Lernmaterials und den Lernumständen ab.
Ebbinghaus selbst räumte ein, dass die Behaltensleistung durch sinnvolles Lernmaterial verändert würde aufgrund von entstehenden Assoziationen, der Ästhetik der Verse oder auch deren Lächerlichkeit. Sinntragendes Lernmaterial würde daher in seine Untersuchungen „eine Fülle von unregelmäſsig wechselnden und deshalb störenden Einflüssen ins Spiel bringen.“ (Ebbinghaus 1885: 32).
Michel und Novak (2007: 151) bilden in ihrem psychologischen Lexikon verschiedene Gedächtniskurven für unterschiedliche Lerninhalte ab, wobei Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten auch nach einem Monat noch fast zu 100 %, Gedichte noch etwas mehr als zur Hälfte, Prosa etwas weniger als 50 % und sinnlose Silben wie die von Ebbinghaus nur noch zu einem Fünftel abrufbar sind. Allerdings führen Michel und Novak (ebd.) keinerlei Quellen und Studien an, auf die sie sich hierbei berufen und auch die beigefügte Graphik der verschiedenen Vergessenskurven ist ungenau dargestellt, weswegen die eben genannten Aussagen in Bezug auf das Vergessen mit Vorsicht betrachtet werden müssen. Es stellt sich zudem die Frage, mit welchem der angegebenen Lerninhalte sich fremdsprachige Vokabeln am ehesten vergleichen lassen. Da es sich bei Vokabeln eindeutig nicht um Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten handelt und weder Reim noch Ästhetik der Sprache beim Vokabellernen im Vordergrund stehen, können diese bereits ausgeschlossen werden. Für Prosa, die an einen zusammenhängenden Text denken lässt, sind einzelne zu erlernende Begriffe zu kurz. Damit münden diese Überlegungen erneut in die Antizipation der Ebbinghaus’schen Vergessenskurve bei einmaligem Vokabellernen, dies allerdings in dem Bewusstsein, dass sinntragende Begriffe deutlich mehr Assoziationen wecken können, wodurch sie sich in einigen Fällen vermutlich etwas besser einprägen lassen können als das Ebbinghaus’sche Versuchsmaterial. Es darf jedoch vermutet werden, dass ein unbekanntes Wort in der Fremdsprache für Lernende zunächst auch einer Ansammlung sinnloser Silben ähnelt. Zudem können ebenso bei sinnlosen Silben Assoziationen geweckt werden. Es kann somit nur eine Annäherung an die Erwartung der Behaltensleistung fremdsprachiger Vokabeln durch die Lernenden erfolgen. Da die Ebbinghaus’sche Vergessenskurve aber mehrfach erfolgreich repliziert wurde (vgl. u.a. Heller, Mack & Seitz 1991; Murre & Dros 2015) und in diesem Kontext als die verlässlichste Referenz gilt, wird sie später zu einem Vergleich der Behaltensleistungen von Schülerinnen und Schülern im Englischunterricht der gymnasialen Oberstufe anhand verschiedener Varianten des Vokabellernens herangezogen (vgl. Kap. 6.7.10.2; Kap. 6.9).
Wenngleich mögliche Zweifel an der Geschwindigkeit und Menge des Vergessens für die verschiedenen Lerninhalte verständlich sein mögen, lässt sich folgende Erkenntnis dennoch ableiten:
„Die Vergessensrate ist generell hoch, das „Verblassen“ einer einmal erworbenen Information ein kontinuierlicher Prozess.“ (Reinfried 2006: 182) Das Lernen von Informationen, so u.a. fremdsprachlicher Vokabeln, bedeutet daher immer eine Arbeit gegen das Vergessen, weswegen Möglichkeiten zur Steigerung der Behaltensleistung für das Wörterlernen lohnend scheinen. Bevor jedoch auf Vokabellerntechniken und ‑strategien näher eingegangen wird (vgl. Kap. 2.7), soll zunächst betrachtet werden, welche Relevanz die Wortschatzaneignung im Englischunterricht der gymnasialen Oberstufe einnimmt und was von den Schülerinnen und Schülern erwartet wird.
2.6 Fremdsprachlicher Wortschatzaufbau im Schulkontext
Ein präziser englischer Wortschatz ist für eine den Schülerinnen und Schülern erfolgreiche Teilnahme am Englischunterricht unerlässlich. Mit ansteigendem Sprachniveau erhöhen sich zumeist auch Anzahl und Komplexität der zu lernenden Wörter. Sie sind die Basis, um sich in der Oberstufe bis hin zum Abitur kompetent und zudem kritisch mit Themen wie science and technology oder auch the impact of the media on society auseinanderzusetzen. Für jeden der Themenbereiche sind ein oder mehrere explizite und umfangreiche Wortfelder maßgeblich, was dem Bereich der Verfügbarkeit sprachlicher Mittel zugehörig ist, dessen Relevanz von der Kultusministerkonferenz in den Bildungsstandards verankert wurde:
Die Schülerinnen und Schüler greifen bei der Sprachrezeption und -produktion auf ein breites Repertoire lexikalischer, grammatischer, textueller und diskursiver Strukturen zurück, um die Fremdsprache auch als Arbeitssprache in der Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten zu verwenden. (Bildungsstandards 2012: 18)
Eine Aufteilung der Ausprägung der Wortschatzbeherrschung erfolgt im GER1 anhand einer Skala, die von einem Niveau A12 bzw. A2, dem Beherrschen eines „begrenzten Wortschatz[es] in Zusammenhang mit konkreten Alltagsbedürfnissen“ bis hin zum Niveau C2, welches eine „[d]urchgängig korrekte und angemessene Verwendung des Wortschatzes“ verlangt, reicht (Europarat 2001: 113). Während in der elementaren Sprachverwendung (A1, A2) grundlegende Kenntnisse erwartet werden können, sollte auf mittlerer Stufe (B1, B2) eine selbstständige Sprachverwendung erfolgen, wohingegen beim höchstmöglichen Niveau, der kompetenten Sprachverwendung (C1, C2), fachkundige oder sogar nahezu muttersprachenähnliche Kenntnisse vonnöten sind (vgl. Europarat 2001: 35). Für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe, die in dieser Schrift von besonderem Interesse sind, wird das Sprachniveau B2 erwartet (vgl. Anlage 22 zum GER).
Der Aufbau eines solchen umfangreichen Repertoires lexikalischer Einheiten ist auf verschiedene Weisen möglich. Thaler (2012: 225) differenziert drei Formen des Wortschatzerwerbs. Hierzu gehört ein „unterrichtlich gesteuerter Wortschatzerwerb: Wortschatzvermittlung durch die Lehrkraft, systematische und gezielte Wortschatzarbeit“ (ebd.), was sich zum einen aufgrund eines gezielt progressiven Vorgehens förderlich auswirken kann, sich jedoch nicht kongruent zu den Interessen der Schülerinnen und Schüler verhalten muss und somit demotivierend wirken kann (vgl. ebd.). Entsprechend motivierender könnte sich ein „lernergesteuerter Wortschatzerwerb: vom Lerner initiiertes und gesteuertes Vokabellernen, autonomes und (idealerweise) lebenslanges Lernen“ (ebd.) auswirken. Jedoch „kann die Auswahl von Vokabeln beim lernergesteuerten Wortschatzerwerb in einem unausgewogenen oder nicht vernetzten Wortschatz resultieren“ (ebd.). Eine weitere Möglichkeit des Aufbaus oder der Erweiterung des Wortschatzes bietet eine beinahe mühelose Aufnahme von Begriffen, auch inzidenteller Wortschatzerwerb genannt. Dieser erfolgt nebenbei durch das Lesen von Websites oder Büchern, ebenso durch Radiohören oder Filmeschauen in der Zielsprache. Auch hier kann die Aneignung von Wörtern unstrukturiert und einseitig erfolgen und zudem mögliches Potential von Wörtern unbeachtet lassen (vgl. ebd.). Welche Art der fremdsprachlichen Wortschatzaneignung zu welcher Person passt, ist unterschiedlich. Dennoch wird sich für die meisten Lernenden eine Mischung der drei Möglichkeiten als förderlich erweisen:
Different learners will obviously need emphasis on different types of words (whether high-frequency or specialized vocabulary), but nearly all students can benefit from a judicious blend of intentional and incidental learning. Even advanced learners with large vocabularies can continue to fill out their lexical knowledge, as many (or most) of the words in their mental lexicons will only be partially mastered. After all, even native speakers continue to learn new words throughout their lifetimes. (Schmidt 2007: 841)
Wenngleich sowohl der inzidentelle als auch der lernergesteuerte Wortschatzerwerb scheinbar ohne Einflussnahme von Lehrkräften vonstattengehen, sieht Thaler (2012: 225) in Bezug auf das lebenslange Lernen für Lehrerinnen und Lehrer auch hier eine Aufgabe:
Werden im Unterricht Lernstrategien und Kriterien für die Auswahl und Anordnung von Wortschatz vermittelt, kann dies helfen, die Nachteile des lernergesteuerten und inzidentellen Wortschatzerwerbs zu mindern.
Der unterrichtlich gesteuerte Aufbau eines reichhaltigen Wortschatzes in der zu erlernenden Sprache erfolgt häufig durch die gezielte Aneignung fremdsprachiger Vokabeln. Jedoch sind die Begriffe Vokabel und Wort bei Schülerinnen und Schülern unterschiedlich belegt.
Den im Unterrichtskontext gängigen Begriff ‚Vokabel‘ reduzieren SuS erfahrungsgemäß auf formale (Lern-)Kontexte und assoziieren ihn oft negativ. ‚Wörtern‘ hingegen schreiben sie viel mehr und viel umfassendere Merkmale zu: semantische, kommunikative bis hin zu poetischen. Da bekannt ist, wie sehr die Sichtweisen von Lernenden den Lernerfolg beeinflussen, erscheint der Begriff der Vokabel für schulisches Lernen nur bedingt geeignet. (Neveling 2017: 378)
So plädiert Neveling (ebd.: 349) dafür, „den Begriff der ‚Vokabel‘ abzuschaffen und auch in Lernkontexten zu dem des ‚Wortes‘ überzugehen“. Dennoch wird in der hier vorliegenden Arbeit auch der Terminus Vokabel verwendet, da er, wie eben dargestellt, zwar unbeliebt, jedoch im Unterrichtskontext sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Lehrkräften nach wie vor gebräuchlich ist. Zudem wird der Einsatz klassischer Vokabellisten in dieser Schrift noch von Bedeutung sein (vgl. Kap. 6.7.5; Kap. 6.8.5).
Der Wert der Wortschatzarbeit und ihre Notwendigkeit für das Fremdsprachenlernen gelten als unbestritten.
Wortschatzarbeit wird sowohl von Lehrkräften als auch von Lernern als zentraler und grundlegender Tätigkeitsbereich beim Erlernen einer Fremdsprache angesehen. (Haudeck 2008: 13)
Thaler (2012: 226) unterscheidet sechs Phasen der Wortschatzvermittlung:
Um lexikalische Kompetenz aufzubauen, müssen die richtigen Wörter 1. ausgewählt, 2. abwechslungsreich präsentiert, 3. ‚merk-würdig‘ verankert, 4. sinnvoll geübt, 5. kontinuierlich gelernt und 6. automatisch in der Kommunikation angewendet werden.
Hierbei sind die Aufgabenbereiche häufig eindeutig verteilt:
Traditionell findet die Einführung neuen Wortschatzes durch die Lehrkraft im Unterricht statt, während die Aufgabe des Wiederholens und Einprägens zur Sicherung des überdauernden Memorierens in den häufigsten Fällen außerhalb des Klassenzimmers erledigt werden soll. Hierzu gehört das sogenannte ‚Vokabelpauken‘ oder ‚Büffeln von Vokabeln‘, das auf einer entsprechenden Hausaufgabe beruht oder zur Vorbereitung auf einen Test oder eine Klassenarbeit dient. (Haudeck 2008: 111)
Das Auslagern des Vokabellernens aus dem Unterricht resultiert häufig aus Zeitmangel (vgl. Thaler 2012: 231), denn die Aneignung von fremdsprachigem Wortschatz ist zeitintensiv (vgl. u.a. Reinfried 2006: 176) und idealerweise werden nicht nur die entsprechenden Vokabeln in Listen gelernt, sondern die Verwendung des Begriffs, u.a. anhand nebenstehender Beispielsätze, wird verinnerlicht. Da das Lernen von Wörtern mehr und weniger effektiv gestaltet werden kann, sollten Lernende mit dieser grundlegenden Aufgabe nicht allein gelassen werden, selbst wenn das Memorieren der Vokabeln außerhalb des Unterrichts erfolgt. Lehrkräfte müssen ihre Schülerinnen und Schüler mit Techniken und Strategien ausstatten, die das Lernen der Begriffe zielführend unterstützen. Im Hinblick auf die zentrale Rolle eines reichhaltigen Wortschatzes für den souveränen Gebrauch einer Fremdsprache ist die Frage naheliegend, auf welche Weise sich fremdsprachige Wörter am effizientesten und am nachhaltigsten einprägen lassen. Da jedoch „die Aneignung eines umfangreichen Vokabulars unter den Bedingungen des schulischen Fremdsprachenlernens eine große Herausforderung“ darstellt (Haß 2006: 114), ist es „unerlässlich, dass Lehrer_innen Unterstützung aus dem Bereich der Wissenschaft erhalten und annehmen“ (Kehrein 2013: 5). Hierfür lohnt der Blick auf Techniken und Strategien für das Einprägen von Wörtern.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.