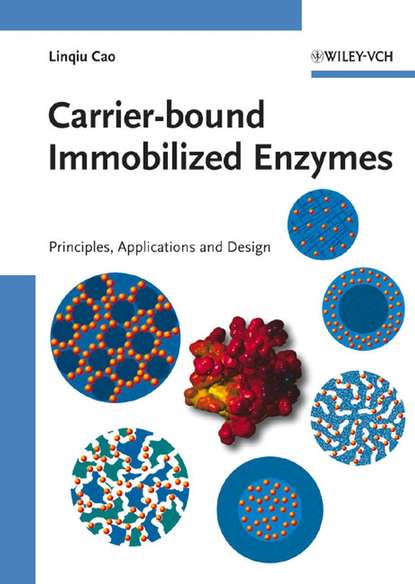Die Leiche im Landwehrkanal

- -
- 100%
- +
Kußmaul seufzte und wies in Richtung der Linden. Sie spazierten los. In der Stadt wimmelte es von Menschen. Die Arbeiter kamen von den Baustellen, aus Manufacturen oder Fabriken. Kolporteure boten Schund und Plunder feil, Waschweiber schleppten Körbe. Feine Herrschaften widmeten sich dem Abendamüsement. Über das Pflaster donnerten Kutschen und Pferdeomnibusse. Gontard fand es absurd, dass sie ausgerechnet in diesem Gewühl von Passanten ungestört blieben. Zwar schlichen auch seltsame graue Gestalten durch das Gewimmel, aber die waren sicher auf dem Weg in die Caféhäuser und Salons der Stadt. Denn hier draußen kümmerte sich jeder um sich selbst und um nichts anderes.
»Was, sagtest du, war der Verblichene vom Berufe?«, fragte Kußmaul laut.
»Privat-Secretär bei einem Adligen, von Traunstein heißt der. Warum fragst du?«
»Ein bürgerlicher Schreiberling also.« Kußmaul hob die Hand und fächelte sich Luft ins Gesicht. »Riechst du da nicht den Ärger, der auf dich zukommt? Auf uns?«
»O Freund, du siehst ja Gespenster!«
Kußmaul schnaufte. »Es ist gerade mal zwei Jahre her, dass wir auf den Barrikaden standen, bis der dicke König seinen Hut vor dem Pöbel gezogen hat. Und schau dich um! Die ganze Stadt ist voller Spitzel. Die Vogtei platzt aus allen Nähten, und dabei sind viele außer Landes gegangen. Ich sehe also Gespenster?«
Der Mediciner hatte wohl recht, dachte Gontard, Preußen war derzeit nicht gerade ein Schlaraffenland für Freigeister. Und ohne Frage führte der Freund seine Reden über Friedrich Wilhelm I V. besser nicht in Hörweite pommerscher Offiziere. Gontard sagte: »Es ist erst einmal nur eine Leiche im Landwehrkanal. Und ich will doch lediglich wissen, woran der Mann gestorben ist.«
Kußmaul seufzte. »Ich weiß, dass ich dich nicht zurückhalten kann, wenn du eine Leiche gefunden hast. Ich sehe mir den Knaben an. Hoffentlich gibt das keine Scherereien!«
Tagebucheintrag No. 1, 22. August 1850
Drei Tage sind nun schon vergangen. Drei Nächte ohne Schlaf. Ich bin müde. Ständig fallen meine Augen zu. Doch dann bin ich sofort wieder hellwach. Und ich sehe immer wieder dieses Bild: Der Mann fällt.
Dabei geht es mir gut. In der Schreibstube hat keiner etwas bemerkt. Da bin ich sicher. Die anderen Herren, etwa in den Amtsstuben, begegnen mir mit der Gemächlichkeit der Augusttage. Da falle ich auch todmüde nicht auf. Ich sitze an meinem Secretär und kümmere mich um die Correspondenz. Leider lenkt mich das kaum ab. Immer wieder gerate ich in Gedanken. Und ich sehe den Mann fallen.
Am Nachmittag verlasse ich das Bureau und weiß nichts mit mir anzufangen. Ich könnte ein Buch lesen, eine Ausfahrt mit dem Pferdeomnibus machen, in ein Caféhaus gehen. Aber nein. Ich schleppe mich zum Thiergarten. Es dämmert schon, und kaum jemand ist hier. Wahrscheinlich sind alle schon zu Hause oder in der Gastwirtschaft. Ich spaziere durch die Auen, aber es hilft nichts. Die Ruhe ist noch schlimmer als das Treiben in der Stadt. Nun ist Abend, und ich sehne den Morgen herbei.
Es ist schon seltsam. Ich habe Hunderte von Menschen sterben sehen. Ach was, Tausende. Damals bei Waterloo. 35 Jahre ist das her. Wir haben den Franzmännern eingeheizt. Die sind umgefallen wie die Fliegen. Ich weiß noch, wie das gestunken hat. Die ganzen Leichen haben angefangen vor sich hin zu modern. Natürlich sind auch ein paar von unseren treuen Kameraden auf dem Feld geblieben. Wir haben getrauert. Und wenn ich jetzt daran denke, fallen mir auch die schrecklichen Bilder ein. Abgeschlagene Gliedmaßen und Köpfe. Aufgeschlitzte und zerrissene Körper. Doch ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, so durcheinander gewesen zu sein wie heute im Thiergarten. Wegen einem Mann.
Vielleicht sind tausend Tote leichter erträglich als ein einzelner. Die Franzmänner waren uns sowieso egal. Da haben wir bei jedem Kadaver gejubelt. Aber auch bei unseren Toten konnten wir uns nicht lange mit der Trauer aufhalten. Kaum gedachten wir eines gefallenen Kameraden, blieb der nächste auf dem Feld. Eine alltägliche Tragödie. Bittere Rituale.
Ein paar zarte Geister haben das natürlich nicht vertragen. Erst sind sie still geworden, haben nicht mehr gesprochen. Dann nicht mehr gekämpft. Sie sind aufs Schlachtfeld geschlichen wie alte Männer. Zumeist mussten wir bald ihrer gedenken.
Auch ich habe schlechte Erinnerungen aus dem Krieg mit nach Hause gebracht. Die jedoch kamen mir selten und unvermittelt in den Sinn. Manchmal in der Nacht. Dann habe ich mir klargemacht, dass ich auf der richtigen Seite stand. Ich habe getan, was getan werden musste. Das Richtige.
Das sage ich mir auch heute: Ich habe vor drei Tagen das Richtige getan! Daran kann es keinen Zweifel geben. Und wenn der Kerl noch hundert Mal vor meinem inneren Auge zu Boden stürzt. Der ist doch selbst schuld.
Ja, ich habe abgedrückt. Ich habe auf sein Herz gezielt, und allem Anschein nach habe ich getroffen. Aber ich wäre doch niemals ohne Grund an diesen gottverlassenen Ort vor den Thoren der Residenzstadt geritten. Und ich schieße auch nicht ohne Sinn und Verstand auf Menschen.
Was hat dieser Puch sich gedacht? Dass er den Herrn über meine Zukunft spielen darf? Dass ich zusehe, wie er meinen Ruf zerstört? Mein Leben verpfuscht? Nein, ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Wenn nötig, auch mit der Waffe in der Hand. Da sei der Herrgott mein Richter – ich habe nur getan, was ich tun musste. Wie auf dem Schlachtfeld.
Immerhin habe ich jetzt ein wenig zur Ruhe gefunden. Ich werde zu Bett gehen und schlafen. Das mit dem Tagebuch führe ich fort. Gleich morgen. Bis dahin habe ich eine Nacht vor mir. Den Schlaf eines Gerechten. Denn der bin ich. Soll der Mann doch ins Wasser fallen, wie er will.
Zwei
Freitag, 23. August 1850
Christian Philipp von Gontard schritt durch das Treppenhaus zum Bureau seines Lehrstuhls. Seine Schritte hallten durch das Gemäuer. Er war zeitig in die Vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule gegangen, denn noch herrschten draußen Unter den Linden erträgliche Temperaturen. Nicht nur er schien auf diesen Gedanken gekommen zu sein, denn als er am Treppenabsatz kurz stehenblieb, klackten weiterhin Stiefel über die Stufen. Die Geräusche kamen von oben.
Gontard überlegte, ob er umkehren sollte. So früh am Tage fehlte ihm die Lust zur Konversation, und im Labor warteten die Proben vom Landwehrkanal. Aber vielleicht ging der Mann über ihm auch ganz woandershin, zu einem anderen Lehrstuhl oder ins Rektorat. Sicher reichte es, ein wenig zu trödeln, um dem anderen aus dem Weg zu gehen. Gontard schlenderte gemächlich in die nächste Etage. Dort lehnte er sich an das Geländer und hörte die Schritte verhallen.
Jetzt herrschte Stille in der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule. Gontard eilte, nun da die Gefahr von Zwiegesprächen am Morgen gebannt schien, zu seinem Lehrstuhl. Im zweiten Geschoss bog er in den Gang und traute seinen Augen nicht: Ausgerechnet vor seinem Bureau stand eine Gestalt in derart militärischer Haltung, dass Gontard sie kurz für eine Statue hielt. Nur, wo sollte die herkommen? Nein, es musste sich um den Mann handeln, dessen Schritte er gerade gehört hatte. Das Gesicht konnte er im Zwielicht des Ganges nicht erkennen, genauso wenig den Dienstgrad des Mannes.
Gontard dachte erneut daran umzukehren. Doch wie würde das aussehen? Es gab kein Zurück. Aber immerhin war es sein Lehrstuhl, sein Reich. Er würde mit dem Mann zwei, drei Sätze wechseln und ihn dann abwimmeln. Gontard merkte, wie seine Schritte zackig wurden.
»Guten Morgen, Herr Oberst-Lieutenant!« Die Gestalt trat in die Mitte des Ganges.
Gontard erkannte Lieutenant von Heye. Der junge Offizier belegte seine Ballistik-Vorlesung. Er gehörte zu den Studenten, denen Gontard eine große Karriere in der preußischen Armee vorhersagte. Er verfügte über beste Beziehungen, war eine attraktive Erscheinung und zeigte gute Leistungen. Leider ließ er das seine Kommilitonen und Lehrkräfte regelmäßig wissen.
»Guten Morgen, Lieutenant! Was wünschen Sie zu dieser Morgenstunde?«
»Ich möchte mich freiwillig melden. Ich hörte, Sie suchen Studenten, die den Unfall am Landwehrkanal untersuchen.«
Gontard fixierte seinen Studenten. Der wirkte bei allem Hochmut arglos. Gontard hatte gestern in einem Seminar wirklich von dem Erdrutsch berichtet. Es war nicht ausgeschlossen, dass einer der Studenten das am Abend in der Kneipe weitererzählt hatte. Verwerflich wäre das nicht, Gontard suchte schließlich Freiwillige. Dennoch, etwas machte ihn skeptisch. Er fragte deshalb: »Und das fällt Ihnen mitten in der Nacht ein? Hätte das nicht Zeit bis zum Seminar gehabt?«
»Ich dachte, Sie könnten mich vielleicht über die Aufgaben ins Bild setzten. Und gleich nach den Vorlesungen mache ich mich dann ans Werk.«
Gontards Misstrauen verstärkte sich. Dieser Enthusiasmus war völlig untypisch für einen Studiosus an der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule. Hier lernten die Offiziere Seiner Majestät, und die pflegten nach Erledigung der nötigsten Arbeit zu Bierstuben zu eilen oder nach Schürzen zu jagen. Gontard schwieg.
Heye zögerte ebenfalls einen Augenblick, bevor er hinzufügte: »Ich habe gehört, mit dem Unglück ist auch ein Criminalfall verbunden …«
Daher wehte also der Wind, dachte Gontard. Von der Leiche hatte er am Vortag im Seminar allerdings nichts erwähnt.
»Ich habe den Verstorbenen ein paarmal im Haushalt der Familie von Traunstein gesehen und daher ein gewisses Interesse an der Sache.«
»Sie kannten diesen Puch?«
»Nun ja, kennen ist zuviel gesagt. Mein Vater und Herrmann von Traunstein sind befreundet.« Heye verlor für einen Moment seine Überheblichkeit, so wie ein Ritter, der sein Schild senkt. »Deswegen war auch ich oft ein Gast der Familie.«
»Und was hatten Sie für einen Eindruck von Puch?« Heye guckte, als habe Gontard ihn bei einer Peinlichkeit erwischt, und antwortete: »Ich habe ihn kaum wahrgenommen, es handelte sich bei Puch schließlich nur um einen Secretär.«
»Immerhin ist er Ihnen in Erinnerung geblieben.«
»Ich … ich … interessiere mich nun mal für Menschen …« Gontard sah den Lieutenant scharf an. Da gewährte der junge Offizier einen Blick hinter seine großtuerische Fassade, und schon wurde das große Nichts offenbar. Nur nicht lachen, dachte Gontard. Er wollte den Jungen weiter in die Enge treiben. Vielleicht verriet der doch mehr über Puch.
»Mein Vater hat gemeint, ich solle mich mit solchen Leuten nicht weiter abgeben.«
»Weshalb?«
»Weshalb? Es war ein Hinweis meines Vaters. Und um ehrlich zu sein, galt mein Interesse im Haus von Traunstein nicht den Bediensteten.« Lieutenant von Heye verschanzte sich wieder hinter seinem Panzer aus Hochmut.
»Und wäre der Mann nicht tot, würden Sie auch kein Abenteuer in der Untersuchung des Erdrutsches vermuten.« Gontard zuckte mit den Schultern. »Ich fürchte, besonders spannend wird die Arbeit im Labor nicht werden. Wir müssen den Untergrund analysieren und selbstverständlich auch die verwendeten Baustoffe. Da sind akribische Helfer gefragt und keine Draufgänger.« Im Grunde konnten ihm die Beweggründe Heyes egal sein – und ein unsympathischer Freiwilliger war besser als keiner.
Heye lächelte und sagte: »Wollen Sie nun, dass ich bei den Studien mitarbeite? Dann könnten Sie mir im Labor gleich ein paar Proben aushändigen.«
Das Dienstmädchen öffnete die Tür und bat Gontard hinein. Die Maid zählte vielleicht achtzehn Jahre und hatte ein hübsches Gesicht, eine Frisur nach der neusten Mode sowie einen unglaublich breiten Hintern. Damit passte sie genau in das Foyer der Traunstein’schen Villa. Der Raum sah aus, als wüsste er selbst nicht, in welche Zeit er gehörte. Die spätbarocke Garderobe wirkte so schwer, dass Gontard fürchtete, sie würde durch das zusätzliche Gewicht seiner Pickelhaube durch die Dielen brechen. Gleich daneben hing ein Familienbild nach Biedermeier-Art – Spitzweg hätte es nicht kitschiger hinbekommen.
»Wen wünscht der Herr zu sprechen?«, fragte das Dienstmädchen.
Gontard überreichte ihr seine Karte und sagte: »Ich müsste Herrn von Traunstein in einer sehr dringenden Angelegenheit sprechen. Es wäre mir außerordentlich wichtig, dass er für einen unangemeldeten Gast ein paar Minuten Zeit erübrigen kann.«
Das Mädchen verschwand durch die Flügeltür, und Gontard stand allein im Foyer. Er schaute auf die Uhr. Es war kurz nach zwei. Die Vorlesungen hatte er hinter sich gebracht, und Heye untersuchte die Proben im Labor. Selbst wenn er Herrmann von Traunstein für ein längeres Gespräch gewinnen konnte, blieb genug Zeit, um noch einmal zu Lenné an den Landwehrkanal zu reiten.
»Ein Offizier der Königlichen Armee in meinem bescheidenen Haus! Ich bin Herrmann von Traunstein. Was verschafft mir die Ehre?« In der Flügeltür stand ein Mann in einem dunklen Anzug und mit einem buschigen Backenbart. Dafür hatte sich das Haar von Stirn und Haupt zurückgezogen, graue Locken umringten die Halbglatze wie ein Heiligenschein.
»Es ist eine Angelegenheit, die Sie nur mittelbar betrifft. Dennoch ist sie von einiger Bedeutung, weil es sich vermutlich um ein Kapitalverbrechen handelt.«
»Oh«, Traunstein wies mit der Hand in das Zimmer hinter der Flügeltür, »da bin ich selbstverständlich gern behilflich. Kommen Sie doch herein!«
Gontard betrat einen Salon mit ockerfarbenen Wänden und mehreren Regalen, in denen Bücher mit Prägedruck im Ledereinband aufgereiht standen wie eine Kompagnie zum Appell. Traunstein folgte ihm und hieß ihn in »der Bibliothek« willkommen. Auf einer Chaiselongue saß eine junge Frau, vielleicht die Tochter des alten Traunstein. Gontard hatte das Gefühl, die Dame schon einmal gesehen zu haben.
»Darf ich vorstellen, meine liebe Frau, Martha von Traunstein. Mein Sonnenschein und der Glanz dieses Hauses.«
Die Frau errötete, und Gontard fand, dass sie gerade dadurch die Worte des Alten bestätigte. Er verbeugte sich.
Martha von Traunstein erhob sich, machte einen Knicks, blickte ihn an, als wolle sie ihn von oben bis unten vermessen, und sagte: »Ein Offizier zu Gast. Das ist mir eine Freude. Darf ich Ihnen etwas bringen lassen? Einen Cognac?«
Gontard nickte, noch während er über die Antwort nachdachte. Die Herrin des Hauses rief das Mädchen.
Herrmann von Traunstein wies Gontard einen Platz an einem Tisch zu und sagte: »Was führt Sie zu mir, Herr Oberst-Lieutenant?«
Gontard setzte sich und antwortete: »Es geht um Ihren Secretär.«
»Ach herrjeh! Was hat der Puch denn schon wieder angestellt?«
»Schon wieder? Hat es öfter Ärger gegeben wegen ihm?«
»Nun ja …« Traunstein zögerte. »Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll … Er ist kein einfacher Charakter.«
»Hat er seine Arbeit vernachlässigt?«
»Ach was, Herr Oberst-Lieutenant! Er ist ein sehr fleißiger Mann und sehr zuverlässig. Erst am Montag hat er für mich Anweisungen an den Verwalter eines meiner Güter notiert. Seine Formulierungen sind nicht immer die geradlinigsten, aber stets korrekt. Er hat nur …«, Traunstein suchte anscheinend erneut nach den richtigen Worten, »… diese Flausen in seinem Kopf. Das ist manchmal nicht einfach.«
Martha von Traunstein brachte ein Tablett mit zwei Cognac-Schwenkern und einer Flasche zum Nachschenken. Sie hatte sich ein seidenes Tuch über die Schultern geworfen und verabschiedete sich mit herzlichen Worten zu einem Spaziergang.
»Den haben wir von unserer letzten Reise nach Paris mitgebracht. Ein vorzüglicher Tropfen«, sagte Traunstein und nippte am Glas.
Auch Gontard trank. Der Schnaps schmeckte so weich, dass die Kehle beim Schlucken kaum zu spüren war. Er kehrte zum Thema zurück. »Herr Puch ist kein junger Mann mehr, nicht wahr?«
»Nein.« Traunstein lachte. »Er ist, wie man so schön sagt, im besten Alter. Nur verhält er sich nicht so. Er ist noch immer Junggeselle und wohnt in einem Zimmer zur Untermiete. Eine feste Anstellung hat er auch nicht. Ich glaube, er hält sich für einen Schriftsteller, einen Dichter gar.«
»Ist er denn einer?«
»Da fragen Sie den Falschen. Ich lese zumeist die Abrechnungsbücher unserer Landgüter oder Amtspapiere, wenn ich um einen Rat gefragt werde. Mit der schöngeistigen Literatur bin ich weniger vertraut.«
Gontard wiegte den Cognac-Schwenker und sah Traunstein fest an. »Hatte Herr Puch Feinde?«
»Feinde? Das ist ein starkes Wort. Er macht sich nicht nur Freunde. Auch nicht mit seinen liberalen Reden, die er selbst in aller Öffentlichkeit hält.« Traunstein hielt Gontards Blick stand, während er seinen Kopf wiegte.
»Aber er hat Manieren. Ich jedenfalls habe bislang keinen Grund gesehen, auf seine Dienste zu verzichten. Was ist denn nun mit ihm?«
»Er ist tot. Wir haben seine Leiche im Landwehrkanal gefunden. Vermutlich wurde er erschossen.«
Traunstein saß für einen Augenblick starr wie eine Skulptur. Dann trank er einen großen Schluck Cognac.
Gontard spazierte zwischen den Villen stadteinwärts. Es blieb genug Zeit für ein paar Minuten Erholung, bevor er zum Landwehrkanal ritt – Zeit, noch einmal über das Gespräch mit Traunstein nachzudenken. Der Alte hatte nicht mehr viel gesagt, ihn aber höflich eingeladen, jederzeit weitere Fragen zu stellen. Darauf würde Gontard zurückkommen, da war er sich sicher. Doch zunächst musste er sich darüber klar werden, wonach er suchen sollte. Kam der Mörder aus Puchs Bekanntenkreis? Mit wem hatte der verkannte Dichter zu Lebzeiten Umgang gehabt? Oder war alles ganz anders? Lag Kußmaul richtig, und hinter alldem steckte die Politik?
Er musste mehr über Puch erfahren, so viel stand fest. Noch nicht einmal von Puchs Äußerem hatte Gontard ein eindeutiges Bild, dafür war die Wasserleiche viel zu entstellt gewesen. Ob es ein Bildnis von Puch gab? Und wenn ja, wo?
Puch wohnte zur Untermiete, das hatte Traunstein erwähnt. Also bekam Gontard die Adresse nicht einfach über Adressregister heraus. Lenné kannte das Opfer auch, Gontard konnte ihn in Bälde befragen. Bei dem Gedanken verspürte er kurz den Drang, seine Schritte zu beschleunigen. Aber nein, es blieben nur noch ein paar hundert Meter, dann ließ er die Thiergarten-Siedlung hinter sich und kam in die Stadt, ins Gewimmel. Die letzten Schritte lang wollte er noch die Ruhe der Vorstadt genießen. Kein Mensch war hier auf der Straße.
Zumindest fast keiner, denn Gontard hörte, wie sich Schritte von hinten näherten. Es waren Tippelschrittchen. Er drehte sich herum und sah Martha von Traunstein herbeieilen.
»Gut, dass ich Sie noch antreffe, Herr Offizier!«, rief sie ihm zu.
Gontard blieb stehen und schaute die Dame an. Im Sonnenlicht wirkte sie hell und zart wie ein Engel. Ihm kam es beinahe vor, als könne er durch sie hindurchschauen. Vermutlich kam der Eindruck daher, dass ein heller Hut ihre brünetten Locken verbarg. Erneut war da dieses Gefühl, dass er die Frau schon einmal gesehen hatte.
»Ich habe beim Herausgehen gehört, dass Cornelius der Grund für Ihren Besuch war.«
»Cornelius?«
»Puch, Herrmanns Secretär. Was ist mit ihm?«
Gontard sah, wie Martha von Traunstein sich mit der bloßen Hand Luft zufächelte. War sie nervös, oder setzte ihr nur die Hitze zu? Er sagte: »Er ist tot.«
»O mein Gott! Wie ist das passiert?«
»Vermutlich wurde er erschossen.«
»Nicht möglich!«
»Warum nicht?«
»Nun, Cornelius war …« Die Dame seufzte. Sie zog ihr Tuch vor dem Busen zu, als fröstelte sie, und fragte: »Kann ich Ihnen vertrauen, Herr Offizier?«
Ihre Handbewegung und die Frage kamen Gontard theatralisch vor, so wie eine einstudierte Geste – eine, die schon Tausende von Malen ausgeführt worden war. Er nickte.
Martha von Traunstein schlug die Augen auf. »Er war so ein sensibler Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er in eine Gewalttat verwickelt sein soll. Nicht einmal als Opfer.«
»Sie kannten ihn gut?«
»Ich halte Sie nicht für dumm, Herr Offizier.« Martha von Traunstein lächelte, und da war er wieder, der Engel.
»Wenn Sie herumfragen, wird Ihnen bald jemand davon erzählen. Ich hatte ein Verhältnis mit Cornelius Puch. Aber das ist lange her. Ich habe das beendet. Er hat das akzeptiert. Und wir sind Freunde geworden.«
Gontard runzelte die Stirn. Er glaubte nicht an verlassene Liebhaber, die ihrer Angebeteten täglich begegneten und sich damit zufriedengaben. Martha von Traunstein schaute arglos aus ihren braunen Augen. So guckten Frauen, um von ihren Worten abzulenken, dachte Gontard. Er schwieg.
Martha von Traunstein ließ ihr Tuch los und ergriff Gontards Hand. »Er war bis zuletzt voller Sanftmut. Das können Sie mir glauben.«
Ihre Hand lag so leicht auf der Gontards, dass dieser fürchtete, ein Windstoß könnte die Finger hinfortwehen. Das wäre schade. So einen Moment reiner Poesie erlebte Gontard nicht häufig – mit Henriette schon seit Jahren nicht mehr, und auch sonst nicht, als verheirateter Mann.
Gontard fragte: »Weiß Ihr Gatte davon?«
»Herrmann ist ein älterer Herr. Schon als er mich ehelichte, wusste er, dass ich gewisse Bedürfnisse habe. Ich bin diskret, und er behelligt mich nicht mit Nachstellungen.« Sie zog ihre Hand zurück und begann erneut, an ihrem Tuch herumzuspielen.
Jetzt gab es schon zwei Männer mit Hörnern und Verständnis – und einen von beiden hatte er gestern tot im Landwehrkanal gefunden. Gontard fragte: »Haben Sie in letzter Zeit beobachtet, dass Ihr Mann und Herr Puch Streit hatten?«
Martha von Traunstein schaute so entsetzt, als habe Gontard ihr Prügel angedroht. Sie antwortete: »Herr Oberst-Lieutenant, was denken Sie! Natürlich nicht. Cornelius war stets ein treuer Diener unseres Hauses. Und Herrmann hat seine Arbeit hoch geschätzt. Selbst wenn Herrmann etwas von unserer längst vergangenen Liaison bemerkt hat, würde er sich nie zu einer unbedachten Tat hinreißen lassen.« Martha von Traunstein unterstrich ihre Worte, indem sie mit dem Zeigefinger in der Luft herumwedelte.
Bei dieser theatralischen Geste fiel Gontard ein, woher er die junge Dame kannte. Sie sang an der Oper. Er hatte sie erst letztlich als Agathe im Freischütz gesehen. Wann war das? Im vergangenen Frühjahr? Oder im Winter? Er sollte öfter in die Oper gehen. Am besten mit Henriette.
»Sie werden dieses Gespräch doch vertraulich behandeln, Herr Oberst-Lieutenant? Sie sind doch ein Ehrenmann.«
»Das ist selbstverständlich.« Gontard deutete eine Verbeugung an. »Sie könnten mir indes einen Gefallen tun, indem Sie mir die Adresse des Herrn Puch verraten.«
Martha von Traunstein nickte ernst. »Er wohnt im Scheunenviertel. Ich werde nachschauen, wie seine Vermieterin hieß, und Ihnen die genaue Adresse zukommen lassen.«
Warum hatte er den Jungen nur mitgenommen? Paul Quappe ärgerte sich. Die Papiere hätte er für seinen Herrn auch allein von der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule holen können. Aber nein, er musste Ferdinand von Gontards Bettelei erhören, und nun hatte er seine Quengelei zu ertragen.
»Ich würde nur zu gern mehr über den Mordfall wissen.« Ferdinand rief die Worte durch den Straßenlärm Unter den Linden. Eine Frau mit einem riesigen Bastkorb drehte sich zu ihnen herum und starrte sie mit offenem Mund an. Sie hatte die Figur einer Küchenmamsell, die täglich schwere Töpfe und Tiegel wuchten musste und dabei nicht zu knapp von den herrschaftlichen Speisen kostete.
Quappe klemmte die Rolle mit den Papieren fester unter den Arm. Mit der freien Hand schnappte er Ferdinand bei der Jacke und zog ihn zur Seite. Er lenkte den jungen Herrn vorbei an der Mamsell mit dem Korb, an der Familie mit den zeternden Kindern, am Bettler an der Straßenecke und hinein in die Neustädtische Kirchstraße. Hier ließ der Trubel nach, und auch das Gepolter der Fuhrwerke schallte nur aus dem Hintergrund in die Nebenstraße.
Quappe eilte noch ein paar Schritte weiter weg von den Linden und sagte: »Junga Herr, Sie bring’n mir inne Bredullje. Redn Se bitte von na leidijen Meuchelei nich vor die janzen Leute!«
»Ich werde mich beherrschen, Herr Quappe.« Ferdinand blickte zum Trubel zurück. »Aber Sie müssen doch zugeben, dass der Mordfall aufregend ist!«